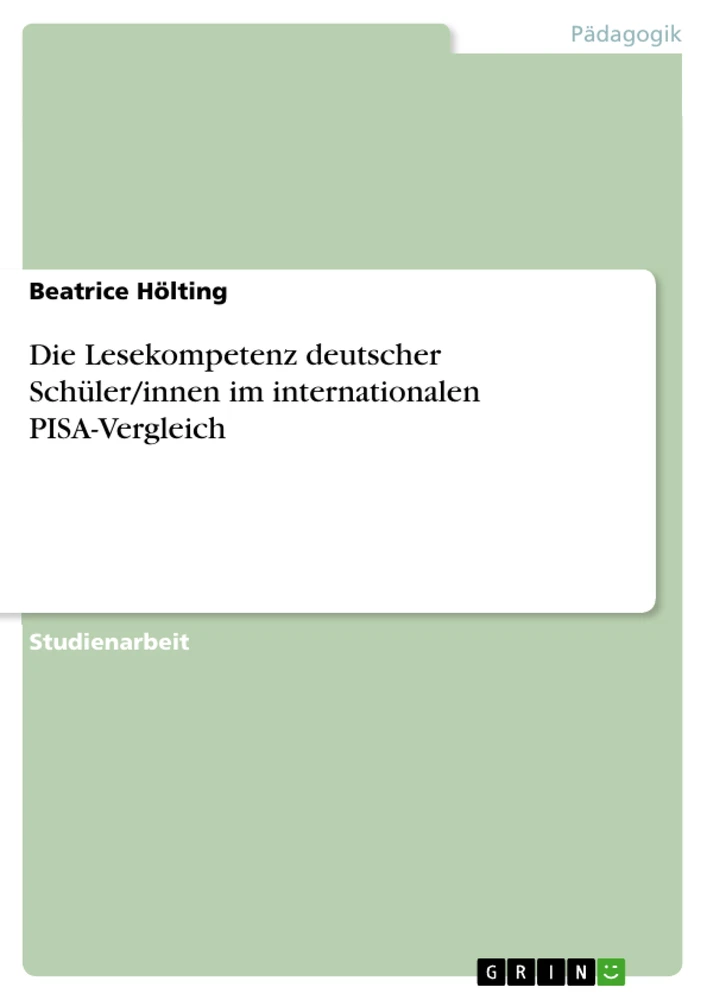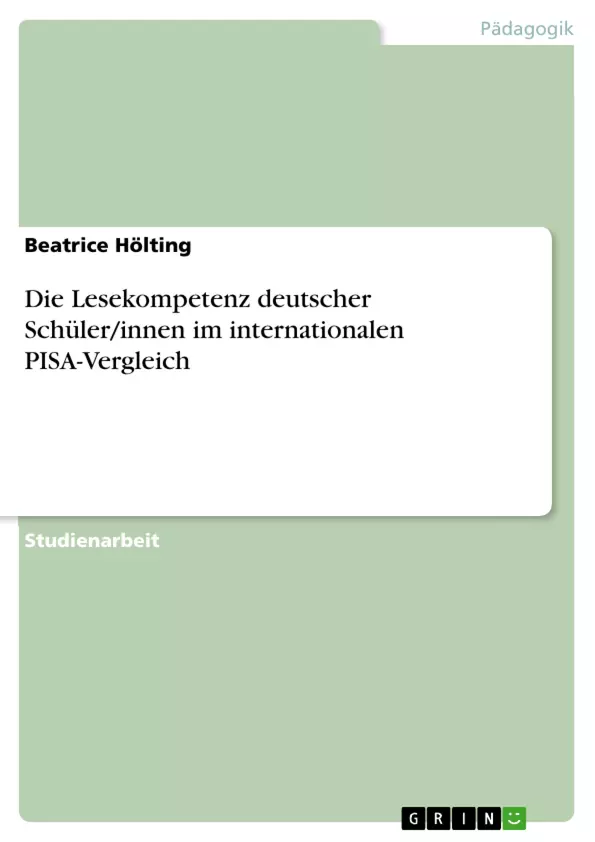Der Begriff der Lesekompetenz umfasst nicht allein die Fähigkeit zu lesen, sondern umfasst laut PISA auch die Kompetenz, „geschriebene Texte unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen Struktur zu verstehen und in einem größeren Zusammenhang einordnen zu können.“ Des Weiteren umschließt die Lesekompetenz die Fähigkeit, Texte auf vielfältige Weise sachgemäß zu nutzen. Demnach ist die Lesekompetenz ein wichtiges Instrument für das Erreichen persönlicher Zielsetzungen, der Weiterentwicklung des eigenen Wissens sowie der eigenen Fähigkeiten. Nur auf diese Weise kann die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben garantiert werden.2
[...]
1 Toman, Hans: Die PISA-Vergleichsstudie und der öffentliche Meinungsaustausch. Das Lesebuch einer kritischen Bestandsaufnahme. Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren 2011. S. 12.
2 Vgl. ebd. S. 12.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lesekompetenz
- Definition
- Entstehung von Lesekompetenz durch Lesesozialisation
- Der Einfluss des Vorwissens für die Lesekompetenz
- Hospitationserfahrungen mit Blick auf die Lesekompetenz
- Die PISA-Studie
- Aufbau, Ziele
- Kompetenzstufen im Lesen
- Ergebnisse der PISA-Studie hinsichtlich der Lesekompetenz
- PISA 2000
- PISA 2003
- PISA 2006
- PISA 2009
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Lesekompetenz von 15-jährigen Schüler/innen im internationalen PISA-Vergleich zu beleuchten. Dabei werden zunächst die Grundlagen der Lesekompetenz, insbesondere deren Definition und Entwicklung im Kontext der Lesesozialisation, erläutert.
- Die Bedeutung der Lesekompetenz für den schulischen und gesellschaftlichen Erfolg
- Die Entstehung von Lesekompetenz durch frühzeitige Lesesozialisation
- Der Einfluss von Vorwissen auf die Lesekompetenz
- Die PISA-Studie als internationaler Vergleich der Lesekompetenz
- Die Ergebnisse der PISA-Studie hinsichtlich der Lesekompetenz deutscher Schüler/innen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Lesekompetenz ein und beschreibt den Kontext der Hausarbeit. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Lesekompetenz definiert und ihre Entstehung durch die Lesesozialisation erläutert. Das dritte Kapitel beleuchtet den Einfluss des Vorwissens auf die Lesekompetenz. Kapitel vier widmet sich der PISA-Studie, ihrer Methodik und ihren Zielen. Die Ergebnisse der PISA-Studie hinsichtlich der Lesekompetenz deutscher Schüler/innen werden im fünften Kapitel analysiert.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, PISA-Studie, Lesesozialisation, Vorwissen, internationale Vergleichsstudien, Schülerleistungen, Bildung, Deutschdidaktik.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Lesekompetenz in der PISA-Studie definiert?
Lesekompetenz umfasst die Fähigkeit, geschriebene Texte unterschiedlicher Art zu verstehen, ihre Absichten und Strukturen einzuordnen und sie für persönliche Ziele sachgemäß zu nutzen.
Welche Rolle spielt die Lesesozialisation für die Kompetenzentwicklung?
Frühzeitige Lesesozialisation ist entscheidend für die Entstehung von Lesekompetenz und legt den Grundstein für den späteren schulischen und gesellschaftlichen Erfolg.
Wie hat Deutschland in den PISA-Studien von 2000 bis 2009 abgeschnitten?
Die Arbeit analysiert die Ergebnisse dieser Jahre und zeigt die Entwicklung der Lesekompetenz deutscher Schüler/innen im internationalen Vergleich auf.
Welchen Einfluss hat Vorwissen auf das Textverständnis?
Vorwissen ist ein wesentlicher Faktor, da es den Schülern ermöglicht, neue Informationen aus Texten in bestehende Wissensstrukturen zu integrieren und einzuordnen.
Warum ist Lesekompetenz für die gesellschaftliche Teilhabe wichtig?
Nur wer Texte versteht und nutzen kann, ist in der Lage, sein Wissen weiterzuentwickeln und aktiv an sozialen, politischen und wirtschaftlichen Prozessen teilzunehmen.
- Quote paper
- Master of Education Beatrice Hölting (Author), 2012, Die Lesekompetenz deutscher Schüler/innen im internationalen PISA-Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194311