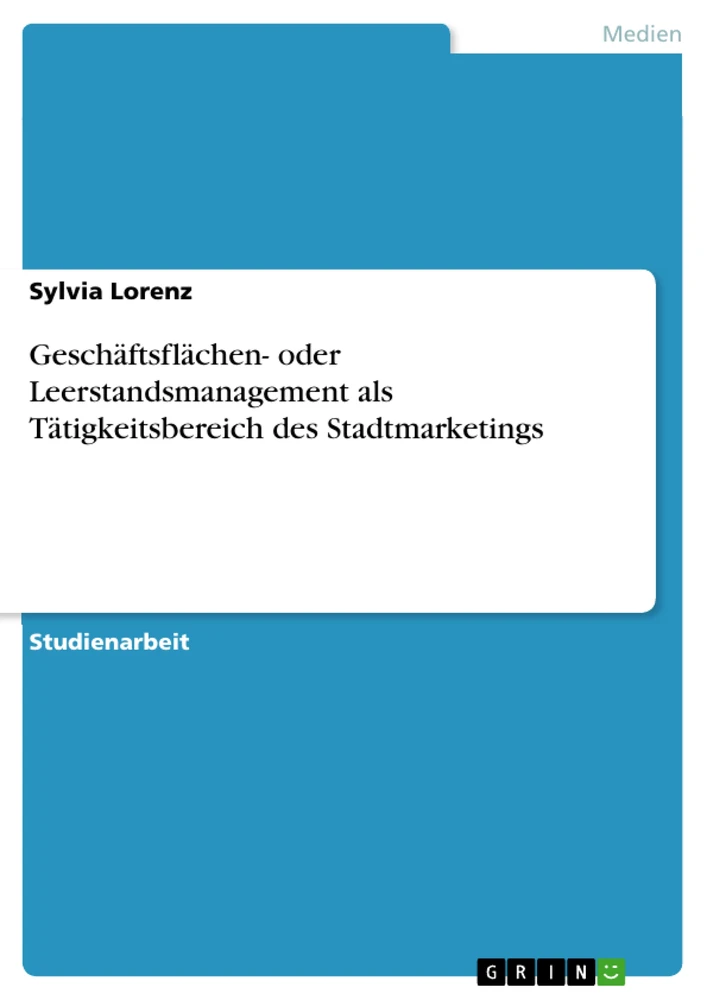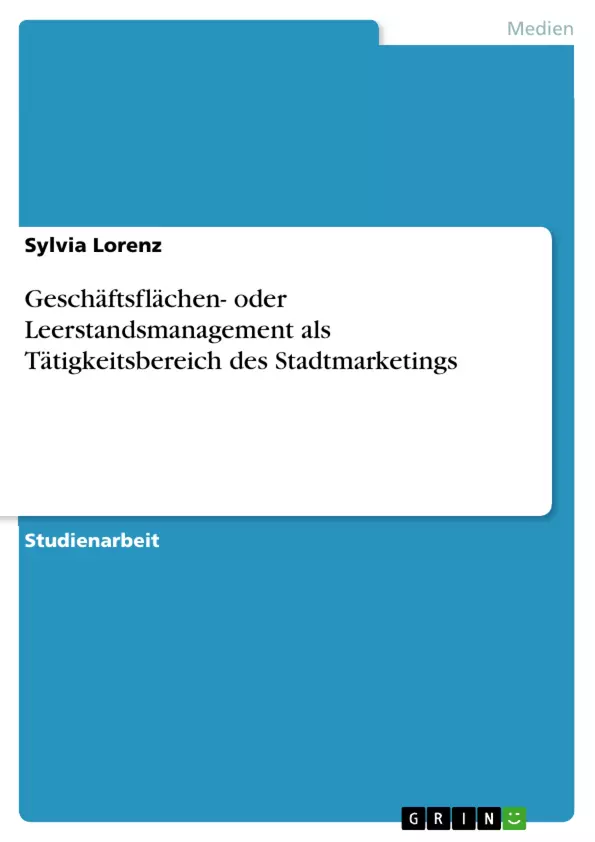Im Rahmen des sich vollziehenden Wandels politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen stehen die Kommunen unter einem enormen Druck sich den neuen Ansprüchen an den Lebens- und Wirtschaftsraum Stadt anzupassen.
Von diesem Strukturwandel ist insbesondere der Einzelhandel betroffen. In der jüngeren Vergangenheit haben sich die Leerstände im Einzelhandel zunehmend verschärft und stellen inzwischen „in fast allen deutschen Städten ein nachhaltiges Problem dar.“ (Handelsverband BAG 2004, S. 1). Obwohl die Verkaufsfläche der Stadt im Allgemeinen steigt, sinkt sie in den innerstädtischen Bereichen. Einzelhandelsformen auf der „Grünen Wiese“ oder an nichtintegrierten Standorten bauen sich stetig zu einer größeren Konkurrenz aus, sodass nicht nur in 1b-Lagen und Stadtteilzentren verstärkt Leerstände registriert werden, sondern auch in den innerstädtischen 1a-Lagen. Daneben sind länger werdende Ladenleerstandszeilen zu verzeichnen (vgl. Handelsverband BAG 2004, S. 1).
Mit der Leerstandsproblematik der Innenstädte gehen sowohl Attraktivitäts- als auch Funktionsverluste einher. Darüber hinaus sind die innerstädtischen Bereiche durch den Prozess der Uniformisierung geprägt.
Vor diesem Hintergrund hat sich in zahlreichen Städten und Gemeinden das Geschäftsflächen- bzw. Leerstandsmanagement als ein wichtiger Bestandteil des Stadtmarketings etabliert. Welche Bedeutung dem Leerstandmanagement zukommt und welche Möglichkeiten zur Bewältigung von Leerständen in den innerstädtischen Bereichen existieren, ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen für Leerstände und Folgen für den Handelsstandort Innenstadt
- Geschäftsflächen- oder Leerstandsmanagement
- Gewerberaumbörsen
- Zwischennutzungen
- Strategische Allianzen
- Shopping-Center-Konzept
- Straßenpools
- Business Improvement Districts
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung des Geschäftsflächen- bzw. Leerstandsmanagements als wichtigen Bestandteil des Stadtmarketings. Die Analyse konzentriert sich auf die Ursachen von Leerständen im Einzelhandel und deren Folgen für die Attraktivität und Funktionalität von Innenstädten. Darüber hinaus werden verschiedene Strategien zur Bewältigung von Leerständen vorgestellt.
- Die Auswirkungen des Strukturwandels im Einzelhandel auf die Innenstadt
- Ursachen für Leerstände im innerstädtischen Einzelhandel
- Die Rolle des Geschäftsflächen- und Leerstandsmanagements
- Verschiedene Ansätze zur Bewältigung von Leerständen
- Die Bedeutung des Stadtmarketings im Kontext des Leerstandsmanagements
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Hintergrund des Leerstandsproblems im Einzelhandel dar und erläutert die Bedeutung des Leerstandsmanagements für die Attraktivität und Funktionalität von Innenstädten. Kapitel 2 analysiert die Ursachen für Leerstände im Einzelhandel, die auf Veränderungen im Standort- und Betriebssystem zurückzuführen sind, sowie die Folgen für die Innenstadt. Kapitel 3 befasst sich mit verschiedenen Strategien des Geschäftsflächen- oder Leerstandsmanagements, wie z.B. Gewerberaumbörsen, Zwischennutzungen und strategische Allianzen.
Schlüsselwörter
Leerstandsmanagement, Stadtmarketing, Einzelhandel, Innenstadtentwicklung, Strukturwandel, Gewerberaumbörsen, Zwischennutzungen, Strategische Allianzen, Shopping-Center-Konzept, Straßenpools, Business Improvement Districts.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe des Leerstandsmanagements?
Es zielt darauf ab, ungenutzte Geschäftsflächen in Innenstädten wieder zu beleben, die Attraktivität des Standorts zu sichern und Funktionsverluste zu vermeiden.
Warum nehmen Leerstände im Einzelhandel zu?
Ursachen sind der Strukturwandel, die Konkurrenz durch Standorte auf der „Grünen Wiese“, Online-Handel und Veränderungen im Konsumverhalten.
Was sind Business Improvement Districts (BIDs)?
BIDs sind begrenzte Gebiete, in denen Grundeigentümer gemeinsam Maßnahmen zur Aufwertung ihres Viertels finanzieren und umsetzen.
Welche Rolle spielen Gewerberaumbörsen?
Sie dienen als Plattform zur Vermittlung zwischen Eigentümern von Leerständen und potenziellen neuen Nutzern oder Gründern.
Was versteht man unter Zwischennutzung?
Die vorübergehende Nutzung leerstehender Läden, etwa für Pop-up-Stores oder Kunstprojekte, um optische Verödung und Vandalismus zu verhindern.
- Arbeit zitieren
- Sylvia Lorenz (Autor:in), 2011, Geschäftsflächen- oder Leerstandsmanagement als Tätigkeitsbereich des Stadtmarketings, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194407