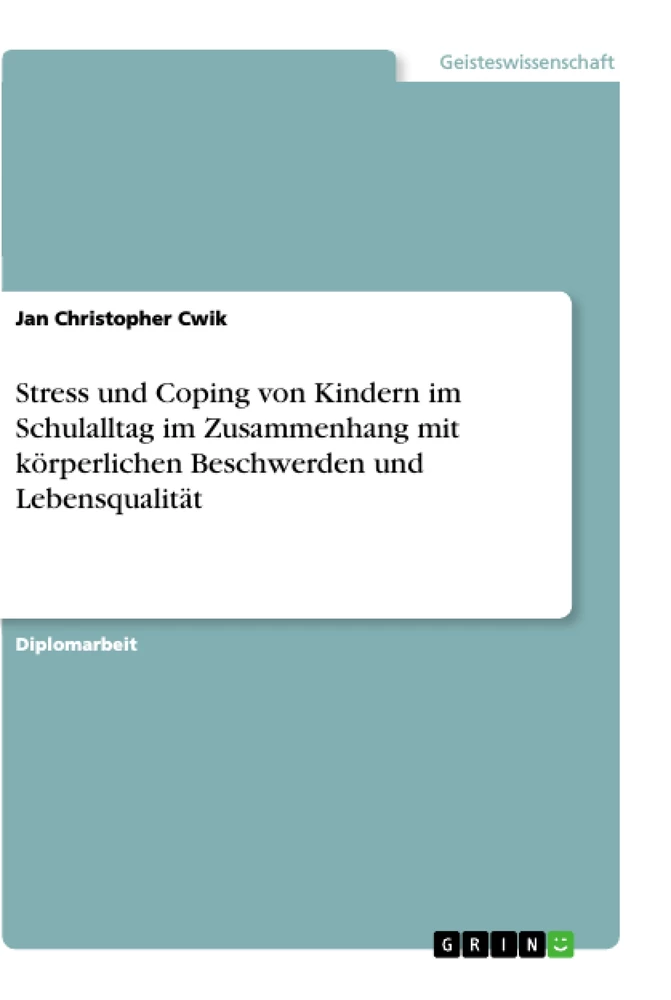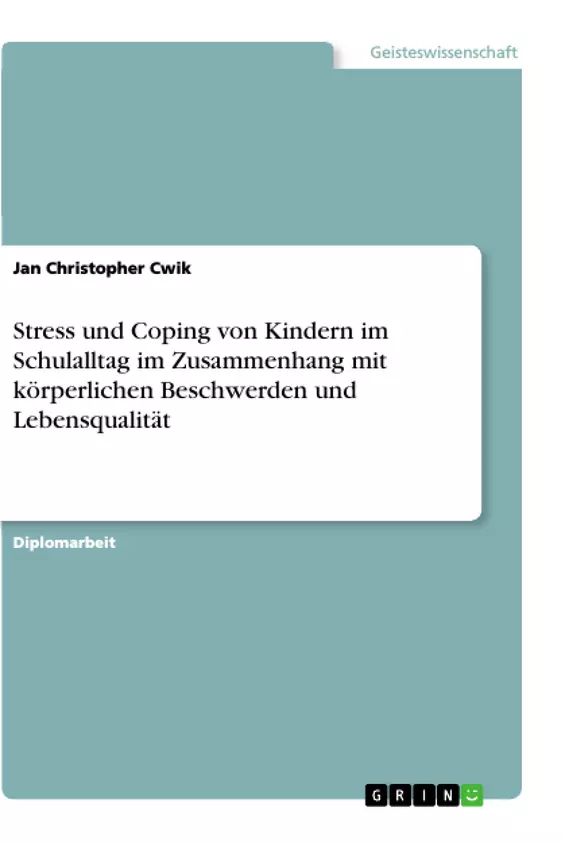Diese Studie beschäftigt sich mit den Zusammenhängen von Stressvulnerabilität und -bewältigungsstrategien sowie Geschlecht, Schulformen und Benotung bei Kindern im Schulalltag mit körperlichen Beschwerden und Lebensqualität.
Hierzu fanden bei 197 Versuchspersonen psychologische Testverfahren Anwendung. Diese erfassen neben der Stressvulnerabilität verschiedene Stressbewältigungsstrategien, basierend auf dem transaktionalen Stressmodell nach Lazarus (1966) sowie verschiedene Facetten der körperlichen Beschwerden und Lebensqualität. Zusätzlich wurden demografische Daten erhoben.
Erfasst wurden 2 Stichproben aus verschiedenen Schulformen. Zusätzlich wurden die Ergebnisse der Stressvulnerabilität und –bewältigungsstrategien als auch die Benotung mit den Ergebnissen der körperlichen Beschwerden und Lebensqualität mit Hilfe verschiedener statistischer Verfahren auf Zusammenhänge überprüft.
Die Annahme über die Zusammenhänge der Stressvulnerabilität und den Bewältigungsstrategien mit den körperlichen Beschwerden und der Lebensqualität konnten in den gemessenen Konstrukten weitestgehend bestätigt werden. Die Stressvulnerabilität und die Strategien der destruktiv-ärgerbezogenen Emotionsregulation sowie der vermeidenden Bewältigung und der problemorientierten Bewältigung waren dabei die bedeutsamsten. Die erwarteten Zusammenhänge zwischen Benotung, körperlichen Beschwerden und Lebensqualität konnten hingegen in den meisten Fällen nicht bestätigt werden.
Die erwarteten Unterschiede der körperlichen Beschwerden und der Lebensqualität zwischen Kindern mit einer hohen und Kindern mit einer niedrigen Stressvulnerabilität konnten bestätigt werden. Kinder mit einer durchschnittlichen Benotung von besser als befriedigend unterschieden sich nicht signifikant von Kindern mit einer schlechteren Benotung. Auch Geschlechtsunterschiede konnten nicht gefunden werden. Weiter zeigten sich kaum Unterschiede zwischen den Schulformen hinsichtlich der abhängigen Maße.
Der Beschwerdedruck konnte am besten durch die Ausprägung der Stressvulnerabilität und die destruktiv-ärgerbezogene Emotionsregulation vorhergesagt werden sowie die Lebensqualität durch die Stressvulnerabilität und die Bewältigungsstrategien der Suche nach sozialer Unterstützung und destruktiv- ärgerbezogenen Emotionsregulation.
Die angesprochenen Themenbereiche dieser Arbeit liefern neben neuen Erkenntnissen für die Grundlagenforschung Implikationen für eine Verbesserung von Stressbewältigungstrainings bei Kindern.
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1. Stressmodelle: Ein Überblick
2.1.1. Notfallreaktion (Cannon)
2.1.2. Das Allgemeine Adaptationssyndrom (Selye)
2.1.2.1. Die Phasen des AAS
2.1.2.1.1. Alarmphase
2.1.2.1.2. Widerstandsphase
2.1.2.1.3. Erschöpfungsphase
2.1.2.2. Bewältigung von Langzeitstress
2.1.3. Das Transaktionale Stressmodell (Lazarus)
2.1.3.1. Erste Untersuchungen
2.1.3.2. Das Stresskonzept
2.1.3.2.1. Phasen der Bewertung
2.1.3.2.1.1.Primäre Bewertung (Primary Appraisal)
2.1.3.2.1.2.Sekundäre Bewertung (Secondary Appraisal)
2.1.3.2.1.3.Neubewertung (Reappraisal)
2.1.3.2.2. Copingstrategien
2.1.3.2.2.1.Problemorientiertes Coping
2.1.3.2.2.2.Emotionsorientiertes Coping
2.1.3.2.2.3.Bewertungsorientiertes Coping
2.2. Körperliche Beschwerden 28
2.3. Lebensqualität
2.4. Aktueller Stand der Forschung
2.4.1. Aktueller Forschungsstand zu Stress und Stressbewältigungsstrategien
2.4.2. Aktueller Forschungsstand zu körperlichen Beschwerden
2.4.3. Aktueller Forschungsstand zur Lebensqualität
3. Fragestellungen und Hypothesen
3.1 Hypothesen zum Faktor Stressvulnerabilität
3.2 Hypothesen zum Faktor Coping
3.3 Hypothese zum Faktor Geschlecht
3.4 Hypothesen zum Faktor Schulform
3.5 Hypothesen zum Faktor Benotung
3.6 Hypothesen zur Regression des Beschwerdedrucks und der Lebensqualität
4. Methoden
4.1. Stichproben
4.2. Untersuchungsdesign
4.3. Untersuchungsablauf
4.4. Demografische und allgemeine Items
4.5. Untersuchungsinstrumente
4.5.1. SSKJ 3-8
4.5.1.1. Stressvulnerabilität
4.5.1.2. Stressbewältigungsstrategien
4.5.1.3. Stresssymptomatik
4.5.2. GBB-KJ
4.5.3. Kid KINDL-R 52
4.5.4. Weitere Instrumente
4.6. Reliabilitätsanalyse
4.7. Auswertungsverfahren
5. Ergebnisse
5.1. Beschreibung der Gesamtstichproben
5.1.1. Schülerverteilung zwischen den Schulformen
5.1.1.1. Stichprobe 1
5.1.1.2. Stichprobe 2
5.1.2. Schulform und Stressvulnerabilität
5.1.2.1. Stichprobe 1
5.1.2.2. Stichprobe 2
5.1.3. Schulform und Stressbewältigung
5.1.3.1. Stichprobe 1
5.1.3.2. Stichprobe 2
5.1.4. Schulform und Geschlecht
5.1.4.1. Stichprobe 1
5.1.4.2. Stichprobe 2
5.1.5. Schulform und Benotung
5.1.5.1. Stichprobe 1
5.1.5.2. Stichprobe 2
5.1.6. Geschlecht und Stressvulnerabilität
5.1.6.1. Stichprobe 1
5.1.6.2. Stichprobe 2
5.1.7. Geschlecht und Stressbewältigungsstrategien
5.1.7.1. Stichprobe 1
5.1.7.2. Stichprobe 2 72
5.1.8. Geschlecht und Benotung
5.1.8.1. Stichprobe 1
5.1.8.2. Stichprobe 2
5.2. Prüfung auf Normalverteilung und Varianzhomogenität
5.2.1. Stichprobe 1
5.2.2. Stichprobe 2
5.3. Ergebnisse zum Faktor Stressvulnerabilität
5.3.1. Korrelationen zwischen Stressvulnerabilität und körperlichen Beschwerden
5.3.1.1. Stichprobe 1
5.3.1.2. Stichprobe 2
5.3.2. Korrelationen zwischen Stressvulnerabilität und Lebensqualität
5.3.2.1. Stichprobe 1
5.3.2.2. Stichprobe 2
5.3.3. Unterschiede in der Lebensqualität zwischen Kindern mit hoher vs. niedriger Stressvulnerabilität
5.3.3.1. Stichprobe 1
5.3.3.2. Stichprobe 2
5.4. Ergebnisse zum Faktor Coping
5.4.1. Korrelationen zwischen Stressverarbeitungsstrategien und körperlichen Beschwerden
5.4.1.1. Stichprobe 1
5.4.1.2. Stichprobe 2
5.4.2. Korrelationen zwischen Stressverarbeitungsstrategien und Lebensqualität
5.4.2.1. Stichprobe 1 98
5.4.2.2. Stichprobe 2
5.5. Ergebnisse zum Faktor Geschlecht
5.5.1. Stichprobe 1
5.5.2. Stichprobe 2
5.6. Ergebnisse zum Faktor Schulform
5.6.1. Unterschiede der körperlichen Beschwerden zwischen den Schulformen
5.6.1.1. Stichprobe 1
5.6.1.2. Stichprobe 2
5.6.2. Unterschiede der Lebensqualität zwischen den Schulformen
5.6.2.1. Stichprobe 1
5.6.2.2. Stichprobe 2
5.7. Ergebnisse zum Faktor Benotung
5.7.1. Korrelationen zwischen Benotung und körperlichen Beschwerden
5.7.1.1. Stichprobe 1
5.7.1.2. Stichprobe 2
5.7.2. Korrelation zwischen Benotung und Lebensqualität
5.7.2.1. Stichprobe 1
5.7.2.2. Stichprobe 2
5.7.3. Mittelwertunterschiede zwischen Kindern mit guten und schlechten Noten
5.7.3.1. Stichprobe 1
5.7.3.2. Stichprobe 2
5.8. Regression auf den Beschwerdedruck
5.8.1. Stichprobe 1
5.8.2. Stichprobe 2 124
5.9. Regression auf die Lebensqualität
5.9.1. Stichprobe 1
5.9.2. Stichprobe 2
6. Diskussion
6.1. Bewertung des Einflusses der Stressvulnerabilität
6.1.1. Körperliche Beschwerden
6.1.2. Lebensqualität
6.2. Bewertung des Einflusses der Stressbewältigungsstrategien
6.2.1. Körperliche Beschwerden
6.2.2. Lebensqualität
6.3. Bewertung des Geschlechtseinflusses
6.3.1. Körperliche Beschwerden
6.3.2. Lebensqualität
6.4. Bewertung des Einflusses der Schulform
6.4.1. Körperliche Beschwerden
6.4.2. Lebensqualität
6.5. Bewertung des Einflusses der Benotung
6.5.1. Körperliche Beschwerden
6.5.2. Lebensqualität
7. Schlussfolgerund und Ausblick
8. Zusammenfassung
9. Literaturverzeichnis
10. Anhang
10.1. Tabellen
10.1.1. Reliabilitätsanalysen
10.1.2. Post-Hoc-Test 173
10.1.3. Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest
10.1.4. Koeffizienten der Regressionsanalysen
10.2. Abbildungen
10.2.1. Scatterplots zu den Produkt-Moment-Korrelationen
10.2.1.1. Stichprobe 1
10.2.1.2. Stichprobe 2
10.3 Elterninformationsbogen (Aus Copyright- oder Datenschutzgründen nicht enthalten)
10.4 Demografische Items und Einleitung (Aus Copyright- oder Datenschutzgründen nicht enthalten)
10.4 SSKJ 3-8 (Aus Copyright- oder Datenschutzgründen nicht enthalten)
10.5 GBB-KJ (Aus Copyright- oder Datenschutzgründen nicht enthalten)
10.6 Kid KINDL-R (Aus Copyright- oder Datenschutzgründen nicht enthalten)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1.1 Reliabilitätsanalyse des SSKJ 3-8
Tabelle 1.2 Reliabilitätsanalyse des GBB KJ
Tabelle 1.3 Reliabilitätsanalyse des Kid KINL-R
Tabelle 2.1 Univariate einfaktorielle Varianzanalyse der Stressvulnerabilität zwischen den Schulformen (Stichprobe 1)
Tabelle 2.2 Univariate einfaktorielle Varianzanalyse der Stressvulnerabilität zwischen den Schulformen (Stichprobe 2)
Tabelle 3.1 Univariate einfaktorielle Varianzanalyse der Stressbewältigungsstrategien zwischen den Schulformen (Stichprobe 1)
Tabelle 3.2 Post-Hoc-Test nach Gabriel zu den gefundenen Mittelwertunterschieden der Stressbewältigungsstrategien zwischen den Schulformen (Stichprobe 1)
Tabelle 3.3 Univariate einfaktorielle Varianzanalyse der Stressbewältigungsstrategien zwischen den Schulformen (Stichprobe 2)
Tabelle 3.4 Post-Hoc-Test nach Gabriel zu den gefundenen Mittelwertunterschieden der Stressbewältigungsstrategien zwischen den Schulformen (Stichprobe 2)
Tabelle 4.1 Häufigkeiten der Geschlechter innerhalb der Schulformen (Stichprobe 1)
Tabelle 4.2 Häufigkeiten der Geschlechter innerhalb der Schulformen (Stichprobe 2)
Tabelle 5.1 Univariate einfaktorielle Varianzanalyse der Benotung zwischen den Schulformen (Stichprobe 1) 66
Tabelle 5.2 Post-Hoc-Test nach Gabriel zu den gefundenen Mittelwertunterschieden der Benotung zwischen den Schulformen (Stichprobe 1)
Tabelle 5.3 Univariate einfaktorielle Varianzanalyse der Benotung zwischen den Schulformen (Stichprobe 2)
Tabelle 5.4 Post-Hoc-Test nach Gabriel zu den gefundenen Mittelwertunterschieden der Benotung zwischen den Schulformen (Stichprobe 2)
Tabelle 6.1 Mittelwerte der Stressvulnerabilität von Mädchen und Jungen (Stichprobe 1)
Tabelle 6.2 Mittelwerte der Stressvulnerabilität von Mädchen und Jungen (Stichprobe 2)
Tabelle 7.1 Mittelwerte der Stressbewältigungsstrategien von Mädchen und Jungen (Stichprobe 1)
Tabelle 7.2 Mittelwerte der Stressbewältigungsstrategien von Mädchen und Jungen (Stichprobe 2)
Tabelle 8.1 Mittelwerte der Benotung von Mädchen und Jungen (Stichprobe 1)
Tabelle 8.2 Mittelwerte der Benotung von Mädchen und Jungen (Stichprobe 2)
Tabelle 9.1 Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest der Variablen (Stichprobe 1)
Tabelle 9.2 Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest der Variablen (Stichprobe 2)
Tabelle 10.1 Korrelationen der Faktoren Stressvulnerabilität, körperliche Beschwerden und Beschwerdedruck (Stichprobe 1)
Tabelle 10.2 Korrelationen der Faktoren Stressvulnerabilität, körperliche Beschwerden und Beschwerdedruck (Stichprobe 2)
Tabelle 11.1 Korrelationen zwischen Stressvulnerabilität und Lebensqualität (Stichprobe 1) 82
Tabelle 11.2 Korrelationen zwischen Stressvulnerabilität und Lebensqualität (Stichprobe 2)
Tabelle 11.3 Mittelwertunterschiede zwischen Kindern mit hoher vs. niedriger Stressvulnerabilität hinsichtlich Beschwerdedruck und Lebensqualität (Stichprobe 1)
Tabelle 11.4 Mittelwertunterschiede zwischen Kindern mit hoher vs. niedriger Stressvulnerabilität hinsichtlich Beschwerdedruck und Lebensqualität (Stichprobe 2)
Tabelle 12.1 Korrelationen zwischen destruktiv-ärgerbezogener Emotionsregulation und körperlichen Beschwerden (Stichprobe 1)
Tabelle 12.2 Korrelationen zwischen vermeidender Bewältigung und körperlichen Beschwerden (Stichprobe 1)
Tabelle 12.3 Korrelationen zwischen Suche nach sozialer Unterstützung, problemorientierter Bewältigung, konstruktiv-palliativer Emotionsregulation und körperlichen Beschwerden (Stichprobe 1)
Tabelle 12.4 Korrelationen zwischen destruktiv-ärgerbezogener Emotionsregulation und körperlichen Beschwerden (Stichprobe 2)
Tabelle 12.5 Korrelationen zwischen vermeidender Bewältigung und körperlichen Beschwerden (Stichprobe 2)
Tabelle 12.6 Korrelationen zwischen Suche nach sozialer Unterstützung, problemorientierter Bewältigung, konstruktiv-palliativer Emotionsregulation und körperlichen Beschwerden (Stichprobe 2)
Tabelle 13.1 Korrelationen zwischen Suche nach sozialer Unterstützung, problemorientierter Bewältigung, destruktiv-ärgerbezogener Emotionsregulation und Lebensqualität (Stichprobe 1) 99
Tabelle 13.2 Korrelationen zwischen konstruktiv-palliativer Emotionsregulation, vermeidender Bewältigung und Lebensqualität (Stichprobe 1)
Tabelle 13.3 Korrelationen zwischen Suche nach sozialer Unterstützung, problemorientierter Bewältigung, destruktiv-ärgerbezogener Emotionsregulation und Lebensqualität (Stichprobe 2)
Tabelle 13.4 Korrelationen zwischen konstruktiv-palliativer Emotionsregulation, vermeidender Bewältigung und Lebensqualität (Stichprobe 2)
Tabelle 14.1 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden und der Lebensqualität von Jungen und Mädchen (Stichprobe 1)
Tabelle 14.2 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden und der Lebensqualität von Jungen und Mädchen (Stichprobe 2)
Tabelle 15.1 Univariate einfaktorielle Varianzanalyse der körperlichen Beschwerden zwischen den Schulformen (Stichprobe 1)
Tabelle 15.2 Univariate einfaktorielle Varianzanalyse der körperlichen Beschwerden zwischen den Schulformen (Stichprobe 2)
Tabelle 15.3 Post-Hoc-Test nach Gabriel zu den gefundenen Mittelwertunterschieden der Erschöpfungssymptomatik zwischen den Schulformen (Stichprobe 2)
Tabelle 15.4 Univariate einfaktorielle Varianzanalyse der Lebensqualität zwischen den Schulformen (Stichprobe 1)
Tabelle 16.1 Korrelationen zwischen Benotung und körperlichen Beschwerden (Stichprobe 1)
Tabelle 16.2 Korrelationen zwischen Benotung und körperlichen Beschwerden (Stichprobe 2)
Tabelle 16.3 Korrelationen zwischen Benotung und Lebensqualität (Stichprobe 1) 117
Tabelle 16.4 Korrelationen zwischen Benotung und Lebensqualität (Stichprobe 2)
Tabelle 16.5 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden von Kindern mit einer Durchschnittsnote von befriedigend oder schlechter vs. besser als befriedigend auf dem letzten Zeugnis (Stichprobe 1)
Tabelle 16.6 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden von Kindern mit einer Durchschnittsnote von befriedigend oder schlechter vs. besser als befriedigend auf dem letzten Zeugnis (Stichprobe 2)
Tabelle 17.1 Modellzusammenfassung der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 1, mit Ausreißern)
Tabelle 17.2 Koeffizienten der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 1, mit Ausreißern)
Tabelle 17.3 Modellzusammenfassung der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 1, ohne Ausreißer)
Tabelle 17.4 Koeffizienten der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 1, ohne Ausreißer)
Tabelle 17.5 Modellzusammenfassung der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 2, mit Ausreißern)
Tabelle 17.6 Koeffizienten der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 2, mit Ausreißern)
Tabelle 17.7 Modellzusammenfassung der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 2, ohne Ausreißer)
Tabelle 17.8 Koeffizienten der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 2, ohne Ausreißer)
Tabelle 18.1 Modellzusammenfassung der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 1, mit Ausreißern) 127
Tabelle 18.2 Koeffizienten der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 1, mit Ausreißern)
Tabelle 18.3 Modellzusammenfassung der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 1, ohne Ausreißer)
Tabelle 18.4 Koeffizienten der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 1, mit Ausreißern)
Tabelle 18.5 Modellzusammenfassung der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 2, mit Ausreißern)
Tabelle 18.6 Koeffizienten der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 2, mit Ausreißern)
Tabelle 18.7 Modellzusammenfassung der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 2, ohne Ausreißer)
Tabelle 18.8 Koeffizienten der Regression auf den Beschwerdedruck (Stichprobe 2, ohne Ausreißer)
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Die Person-Umwelt Beziehung als grundlegendes Stressmodell
Abb. 2.1 Die drei Phasen des allgemeinen Adaptionssyndroms (AAS)
Abb. 2.2 Grafische Darstellung des transaktionalen Stressmodells nach Lazarus (1966)
Abb. 3 Mittelwerte der Stressvulnerabilität der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 1)
Abb. 4 Mittelwerte der Stressvulnerabilität der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 2)
Abb. 5 Mittelwerte der Stressbewältigungsstrategien der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 1)
Abb. 6 Mittelwerte der Stressbewältigungsstrategien der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 2)
Abb. 7 Mittelwerte der Benotung der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 1)
Abb. 8 Mittelwerte der Benotung der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 2)
Abb. 9 Mittelwerte der Stressvulnerabilität von Mädchen und Jungen (Stichprobe 1)
Abb. 10 Mittelwerte der Stressvulnerabilität von Mädchen und Jungen (Stichprobe 2)
Abb. 11 Mittelwerte der Stressbewältigungsstrategien von Mädchen und Jungen (Stichprobe 1)
Abb. 12 Mittelwerte der Stressbewältigungsstrategien von Mädchen und Jungen (Stichprobe 2)
Abb. 13 Mittelwerte der Benotung von Mädchen und Jungen (Stichprobe 1)
Abb. 14 Mittelwerte der Benotung von Mädchen und Jungen (Stichprobe 2)
Abb. 15 Mittelwerte des Beschwerdedrucks und der Lebensqualität von Kindern mit niedriger vs. hoher Stressvulnerabilität (Stichprobe 1)
Abb. 16 Mittelwerte des Beschwerdedrucks und der Lebensqualität von Kindern mit niedriger vs. hoher Stressvulnerabilität (Stichprobe 2)
Abb. 17 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden von Mädchen und Jungen (Stichprobe 1)
Abb. 18 Mittelwert der Lebensqualität von Mädchen und Jungen (Stichprobe 1)
Abb. 19 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden von Mädchen und Jungen (Stichprobe 2)
Abb. 20 Mittelwert der Lebensqualität von Mädchen und Jungen (Stichprobe 1)
Abb. 21 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 1)
Abb. 22 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 2)
Abb. 23 Mittelwerte der Lebensqualität der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 1)
Abb. 24 Mittelwerte der Lebensqualität der Kinder an Hauptschule, Realschule und Gymnasium (Stichprobe 2)
Abb. 25 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden von Kindern mit einer Druschschnittsnote < befriedigend vs.=/> befriedigend (Stichprobe 1)
Abb. 26 Mittelwerte der Lebensqualität von Kindern mit einer Durchschnittsnote < befriedigend vs. =/> befriedigend (Stichprobe 1)
Abb. 27 Mittelwerte der körperlichen Beschwerden von Kindern mit einer Druschschnittsnote < befriedigend vs. =/> befriedigend (Stichprobe 2)
Abb. 28 Mittelwerte der Lebensqualität von Kindern mit einer Durchschnittsnote < befriedigend vs. =/> befriedigend (Stichprobe 2)
Abb. 29 Scatterplots der Korrelationen (Stichprobe 1)
Abb. 30 Scatterplots der Korrelationen (Stichprobe 2) 199
1. EINLEITUNG
Stress ist ein diffuser Begriff, der im Alltag vielseitige Anwendung findet. Man bezeichnet belastende Situationen oder Reize als Stress, stressreich oder stressig, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was Stress genau ist, welche Bedeutungen er für Körper und Psyche hat und was er langfristig mit sich bringt. Dennoch haben alle Alltagstheorien zu Stress aber eines gemeinsam - er wird immer negativ bewertet.
Forschungen zu Stress und seinen Auswirkungen wurden bisher zu einem überwiegenden Teil an Erwachsenen durchgeführt und die Ergebnisse dieser Untersuchungen auf Kinder übertragen. Dabei weiß man aus vielen anderen Forschungsgebieten, dass Kinder psychisch und physisch auf die gleichen Situationen und Reize anders reagieren, als Erwachsene es tun. So zeigen Kinder z.B. ein anderes Verhalten bei Depressionen als Erwachsene und auch bei weiteren Störungen gibt es für Kinder in den gängigen Klassifikationssystemen DSM-IV und ICD-10 spezielle Kriterien.
Die bisher durchgeführten Studien zu Stress und dessen Auswirkungen bei Kindern haben ebenfalls gezeigt, dass es Unterschiede in der Stressvulnerabilität, - bewältigung und -auswirkungen zwischen Kindern und Erwachsenen gibt (Yamamoto & Mahlios, 2001).
Betrachtet man die Forschungsgebiete zu Stress etwas genauer, so stellt man fest, dass dieser häufig im Zusammenhang mit somatoformen oder psychischen Störungen sowie Ängstlichkeit bei Kindern untersucht wird. In der vorliegenden Diplomarbeit werden die Zusammenhänge von Stressvulnerabilität und Stressbewältigung sowie die zusätzlichen Einflüsse weiterer Variablen wie Geschlecht, Benotung und Schulform - unter der Annahme, dass diese weitere Stressoren darstellen - auf körperliche Beschwerden und Lebensqualität bei Kindern untersucht.
Die Datenerhebung fand im Rahmen des normalen Schulalltags statt. Es wurden zwei Stichproben erfasst, eine kurz nach den Sommerferien und eine zwei Wochen vor den Herbstferien. Die erste Stichprobe hatte somit gerade eine längere Erholungsphase hinter sich und war noch nicht durch Vorbereitungen oder das „Schreiben“ von Klassenarbeiten und Tests belastet. Die zweite Stichprobe hingegen hatte zum Erhebungszeitpunkt mehrere Wochen Schulunterricht hinter sich, es waren bereits mehrere Klassenarbeiten und Tests geschrieben worden und auch in der Woche der Erhebung fanden mindestens zwei Klassenarbeiten statt.
Zunächst werden im Folgenden die für diese Arbeit relevanten Theorien vorgestellt. Daraufhin folgt ein Überblick über aktuelle Befunde zu Auswirkungen von Stress und Stressbewältigung sowie Einflussfaktoren auf die Ausprägung von körperlichen Beschwerden und die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Kindern. Im Anschluss werden Fragestellungen und Hypothesen aus diesen theoretischen Grundlagen und Forschungsergebnissen abgeleitet und anschließend überprüft und diskutiert.
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
Der Begriff Stress findet im Alltag vielseitige Anwendung. Haben Menschen es eilig oder sind unter Zeitdruck sprechen sie von Stress. Besteht zwischen zwei Personen ein interpersoneller Konflikt, so hört man im alltäglichen Gebrauch oft: „Die beiden haben Stress miteinander“.
Aber auch Stress als theoretisches Konstrukt und somit Forschungsgegenstand stellt einen Sammelbegriff heterogener Zusammensetzung dar. Setzt man voraus, dass eine Forschungsrichtung sich darüber definiert, auf einer einheitlichen, präzisen Definition zu basieren sowie über intersubjektiv anerkannte Methoden zu verfügen, stellt man schnell fest, dass die Stressforschung diese Kriterien mit Nichten erfüllt. Hier reicht die Definition von Stress als kurzzeitigen Reaktionen des Körpers auf einen äußeren Reiz (Cannon, 1915; Selye, 1950) bis hin zu einer körperlichen Reaktion auf lang anhaltende, kumulierende Lebensereignisse (Klauer, 1997). Gemeinsam haben alle bisherigen Untersuchungen allerdings, dass ihr Augenmerk auf dem Erleben und Verhalten eines Individuums im Zusammenhang mit Problemen der Anpassung an eine Situation liegt.
Unabhängig von der zeitlichen Dauer oder Intensität einer Situation oder eines Reizes besteht innerhalb der Stressforschung Einigkeit darüber, dass sie problematische Ereignisse betrachtet, die sich aus der Wechselbeziehung zwischen Individuum und Umwelt (vgl. Abb. 1) ergeben.
Für eine geordnete Untersuchung der Teilprozesse dieser Interaktion, lassen sich verschiedene Schwerpunkte identifizieren (Lazarus, 1966; Krohne, 1975; Levi, 1976). Eine strukturierte Analyse umfasst neben der Erfassung der Ausgangsbedingungen, auch eine Betrachtung de Prozesses sowie der daraus resultierenden Folgen.
Ausgangsbedingungen: Für eine hinreichende Analyse bedarf es zum einen der Betrachtung des stressauslösenden Potentials und der Häufigkeit von umweltbezogenen Gegebenheiten im Alltag. Hierdurch lassen sich Risikosituationen identifizieren und zugleich ermöglicht diese Betrachtung einen Blick auf stressverzögernde, -hemmende oder -abschwächende Faktoren. Zum anderen bedarf es einer personenbezogenen Analyse und deren vorliegenden Toleranz gegenüber Stress. Dies ermöglicht nicht nur Personen, die ein hohes Risiko für ausgeprägte Stressreaktionen aufweisen, zu identifizieren, sondern auch individuelle Interventionsmaßnahmen zu entwickeln.
Prozess: Die Prozessanalyse bezieht sich auf intraindividuelle Prozesse und wirft die Frage auf, welche psychischen und physischen Prozesse als Mediator hinsichtlich einer Stressreaktion fungieren. Eine Analyse der Prozesse muss hier allerdings zwischen zwei Mediatoren trennen. Zum einen der Vermittlung zwischen Auslösereiz und Stresszustand und zum anderem dem vermittelnden Prozess zwischen Stresszustand und Stressreaktion.
Folgen: Von besonderer Bedeutung ist hier die Wahrscheinlichkeit von Stressreaktionen und womit sie in Verbindung stehen. Außerdem ist eine Analyse der Häufigkeit dieser Reaktionen und ihrer Begleiterscheinungen im alltäglichen Leben von Interesse. Wesentlicher Gesichtpunkt dieser Arbeit sind Reaktionen mit Bedeutung für die Ausprägung körperlicher Beschwerden und Auswirkungen auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität.
Ein weiterer Punkt der Stressanalyse ist eine Identifikation von Faktoren, die eine Beeinflussung stressauslösender Bedingungen sowie der Prozesse, die zu einer Stressreaktion führen, ermöglichen und somit Stressreaktionen und der daraus resultierenden Folgen entgegenwirken. Dies stellt die Frage auf, wie sich Stress kontrollieren und beeinflussen lässt.
Es lässt sich also festhalten, dass Definitionen von Stress, so verschieden sie zum Teil auch sein mögen, gemeinsam haben, dass Stress mit der Anpassung einer Person an ihre Umwelt zusammenhängt (vgl. Abb. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Die Person-Umwelt-Beziehung als grundlegendes Stressmodell
Stress entsteht aufgrund von Anpassungsproblemen (Cannon, 1915; Selye, 1950; Lazarus, 1966), also wenn das Individuum einen bereits erreichten, aber sich in Gefahr befindenden Zustand verteidigen muss oder sich gegen seinen Widerstand an eine neue oder sich verändernde Situation anpassen muss. Verschiedene Stressdefinitionen betrachten hierbei jeweils unterschiedliche Teilbereiche dieser Personen-Umwelt- Beziehung. Differenzieren lassen sich die Definitionen nach reizorientierten Definitionen, welche auf die Umweltkomponente bezogen sind. Hier stellt eine Reizvariable Stress dar. Außerdem lässt sich differenzieren zwischen auf die Person bezogenen reaktionsorientierten Definitionen, bei denen Stress ausschließlich psychische oder physische Reaktionen der Person darstellt, intervenierende Definitionen, bei denen Stress eine vermittelnde Variable zwischen Person und Umwelt darstellt und Beziehungsdefinitionen, nach denen Stress erst dann vorliegt, wenn ein Ungleichgewicht innerhalb der Person-Umwelt-Beziehung besteht (vgl. Mason, 1975; Lazarus, 1966, 1974, 2006; Lazarus & Launier, 1981).
Reizorientierte Definitionen betrachten Stress als unabhängige Variable und operationalisieren ihn als bestimmte Reiz-, Situations-, Bedingungs-, Ereignis- oder Umwelteigenschaften, von denen man annimmt, dass sie mit einer Funktionsstörungen einhergehen (Wiedorn, 1955; Arnold, 1960). Unter dieser Kategorie werden unter anderem z.B. sich schnell ändernde, anhaltende oder intensive Reize zusammengefasst.
Diese Reize werden im Allgemeinen als Stressor bezeichnet. Für eine prägnante Operationalisierung empfiehlt es sich allerdings, den Begriff Stressor genauer zu definieren und zwischen Stressquellen (Personen, Umwelt, Aufgabe), Stresssituationen (konkrete Zusammenstellungen von Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren), stressrelevanten Ereignissen (Veränderungen der Situationsdeterminanten z.B. Verlust eines Freundes in Folge eines Streites) und Stressoren im eigentlichen Sinne (als stressauslösende Ereignismerkmale) zu unterscheiden (Nitsch, 1981). Erst diese Differenzierung ermöglicht eine genaue Klassifizierung und Bestimmung des Bezugs verschiedener Reize. Stress ist hiernach also eine Störgröße und stellt eine Abweichung von Regelabläufen dar (dito).
Reaktionsorientierte Definitionen sehen im Gegensatz zu reizorientierten Definitionen Stress als abhängige Variable. Stress ist hiernach eine psychische oder physische Reaktion auf einen Auslösereiz, kann sich aber auch in bestimmten Verhaltensweisen manifestieren. Allerdings konnte diese den Definitionen zugrunde liegende Unspezifität organischer Reaktionsmuster bisher nicht nachgewiesen werden (Mason, 1975). Außerdem können sehr verschiedene Reize gleiche oder zumindest ähnliche physische Reaktionen zur Folge haben. So können sowohl Ärger als auch Freude einen Blutdruckanstieg bedingen. Aufgrund dieser Einwände ist es eher ratsam, bei organismischen und psychischen Reaktionen im Sinne der reaktionsorientierten Definitionen nicht von Stress, sondern von Stressreaktionen zu sprechen (Nitsch, 1981).
Intervenierende Definitionen beschreiben Stress als einen bestimmten physiologischen Zustand, der aufgrund beschreibbarer vorausgegangener Ereignisse entstanden ist und mit Folgen für das Anpassungsverhalten verbunden ist (Lazarus, Deese & Osler, 1952; Janis & Leventhal, 1968). Nach einer solchen Definition ist Stress als ein hypothetisches Konstrukt zu sehen, das sich nur über eine Erklärung der Reiz- und Reaktionsbedingungen bestimmen lässt. Das hat zur Folge, dass man Stress nur sehr abstrakt beschreiben (Mason, 1975) und schwer operationalisieren kann (Nitsch, 1981). Außerdem ermöglicht eine Definition in diesem Sinne keinen einheitlichen Stressbegriff.
Die Beziehungsdefinition fokussiert in besonderem Maße den Zusammenhang zwischen Stress und Anpassungsprozessen, also der Beziehung zwischen Individuum und Umwelt (vgl. Abb. 1). Hiernach ist Stress nicht ein ausschließlich extern bedingter Reiz oder eine interne Reaktion, sondern bedeutet vielmehr inadäquate Anpassungsprozesse zwischen Person und Umwelt. Vor allem die aktive Zuwendung zur Umwelt und die dabei möglichen Defizite können in Störungen des Person-Umwelt- Gleichgewichts münden. Hiernach entsteht Stress erst dann, wenn ein Ungleichgewicht aufgrund fehlender Anpassungsmöglichkeiten besteht, wie es im transaktionalen Stressmodell weiter unten beschrieben wird (Lazarus, 1966, 1974, 2006; Lazarus & Launier, 1981).
Diese Auffassung von Stress ermöglicht erweiternd zu den oben aufgeführten Definitionen folgende Aussagen (Nitsch, 1981):
(1) Ist das externe Gleichgewicht gestört, kann dies ebenfalls zu einer Destabilisierung psychophysiologischer Prozesse führen, wenn die Anforderungen an das Individuum das übertreffen, was es tun kann oder will.
(2) Eine vor allem im inneren Gleichgewicht vorliegende Störung kann ebenfalls zu einem äußeren Ungleichgewicht führen, welches wiederum verstärkend auf das innere Ungleichgewicht einwirken kann.
(3) Ist das Individuum den externen Anforderungen nicht gewachsen oder ist es der Auffassung, dass die Umweltgegebenheiten unangemessen sind, hat dies Stress zur Folge. Je nachdem, welcher der beiden Fälle vorliegt, sind teilweise sehr unterschiedliche praktische Konsequenzen die Folge.
Die meisten Definitionsansätze betrachten Stress als dichotom - Stress ist vorhanden oder nicht. Allerdings erscheint diese Annahme aus praktischer Sicht wenig sinnvoll, da sie zur Operationalisierung von Stress einer Angabe einer kritischen Grenze bedarf. Allerdings lässt sich davon ausgehen, dass diese Grenze interindividuell verschieden ist (Nitsch, 1981). Dieser Umstand lässt es eher als hilfreich erscheinen, Stress als quantitativen Begriff zu betrachten, was eine Unterscheidung verschiedener Stressgrade erlaubt (Nitsch, 1981). Viele Theorien (z.B. Cannon, 1914a, 1915; Selye, 1950) differenzieren nicht zwischen Stressgraden und beschreiben Stress lediglich als eine Gleichgewichtsstörung innerhalb des Organismus. Diese Grundannahme ist für eine klar definierte und einheitliche Operationalisierung und damit einhergehende Vergleichbarkeit der Forschungsergebnisse wenig zielführend. Vorteilhaft wäre hingegen eher, Stress nicht ausschließlich auf ein Ungleichgewicht innerhalb des Organismus zu begrenzen, sondern Stress als Regelabweichung innerhalb des organismischen Gleichgewichts und damit einhergehender Betroffenheit des gesamten Systems zu definieren. (Nitsch, 1981).
Stress ist aber nicht nur negativ und hat immer schädigende Folgen, sondern kann auch positive Auswirkungen haben. So kann Stress auch als Folge auf ein positives kurz bevorstehendes Ereignis, also in Folge von Freude entstehen oder dazu beitragen, Energiereserven freizusetzen, um vor einem bissigen Hund zu flüchten. Vielmehr erscheint es also für die Erhaltung und Entwicklung der Funktionstüchtigkeit eines Individuums von Vorteil zu sein, ein gewisses Ausmaß an Stress aufzuweisen (Welford, 1973).
Aber nicht nur die Unterscheidung zwischen positivem und negativem Stress erscheint sinnvoll, sondern auch eine Unterscheidung der physiologischen Reaktionen. So beschrieb Selye (1950), dass die physiologische Reaktion unabhängig von der Stresssituation immer gleich ist und auch die gleichen Auswirkungen hat. Dies erscheint allerdings wenig hilfreich, wenn man sich z.B. einmal Nervosität als physiologische Reaktion vor Augen führt, als Reaktion auf eine bevorstehende Klassenarbeit, auf die man nicht ausreichend vorbereitet ist oder aber als Reaktion eines Kindes auf den bevorstehenden Heiligen Abend und der damit einhergehenden Bescherung - Nervosität also als Folge der Vorfreude.
Welchen biologischen Stellenwert Stress nun aber hat, lässt sich anhand der folgenden Aussagen veranschaulichen. Selye (1974, 1982) beschrieb, dass Stress unvermeidbar ist und in jeder Aktivität ein Stresspotential besteht. Stress ist aber auch lebensnotwendig. Neben seiner Bedeutung für die Funktionstüchtigkeit (Welford, 1973) fungiert er als ein Warnsignal, das dem Individuum die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit anzeigt (Nitsch, 1981). Außerdem bereitet Stress den Organismus auf die Bewältigung von Problemen vor und mobilisiert notwendige Reserven, was nicht nur die Überlebenschancen erhöhen, sondern auch mit einer Förderung künstlerischer, wissenschaftlicher und politischer Leistungen einhergehen kann (Nitsch, 1981).
Stress kann aber auch ein Risiko darstellen. Ist seine Folge eine langfristige mangelnde Anpassung oder stehen die Anpassungsprozesse in einem inadäquaten Verhältnis zu den Anforderungen, können psychosomatische Auffälligkeiten die Folge sein (Lazarus, 1966; Nitsch, 1981).
2.1. Stressmodelle: Ein Ü berblick
Die Fragestellungen nach Folgen und Auswirkungen von Stress auf Körper, Psyche und Lebensqualität, lassen sich allerdings erst dann beantworten, wenn eine differenzierte Auffassung darüber besteht, wie Stress operationalisiert werden kann. Im Folgenden werden daher grundlegende Modelle der Stressforschung bzw. für die vorliegende Untersuchung relevante Stresstheorien und -modelle genauer dargestellt.
2.1.1 Notfallreaktion (Cannon)
Walter Bradford Cannon war Physiologe und erforschte Stress auf biologischer Basis. Sein Konzept entsprang zwei verschiedenen Untersuchungsansätzen. Zum einen suchte er nach der biologischen Grundlage von Emotionen (Cannon, 1914a, 1927, 1928, 1929b), zum anderen erforschte er das Konzept des biologischen Gleichgewichts, der so genannten Homöostase (Cannon, 1929a, 1932, 1935).
Der Begriff Homöostase kommt aus dem Griechischen und ist mit „GleichStand“ zu übersetzten. Das Homöostaseprinzip umschreibt das Wirken zwischen den beiden Teilen des autonomen Nervensystems - dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Liegt also ein Gleichgewicht zwischen Aktivierungen und Hemmungen des Organismus vor, spricht man von Homöostase.
Das homöostatische System beschrieb Cannon als autonom und bedeutend für die Entlastung des zentralen Nervensystems, welches sonst durch ständige innere regulatorische Maßnahmen überlastet werden würde (Cannon, 1932).
Im Rahmen Cannons Forschungen wurde der Stressbegriff in die physiologische Forschung aufgenommen. Hiernach ist Stress eine unspezifische Reaktion auf äußere und innere Reize (Cannon, 1935). Schon früh erkannte Cannon, dass Stress nicht nur negative Aspekte hat und argumentierte, dass der Sinn der Stressreaktion darin bestehe, Energie zu mobilisieren, um das durch den Stressreiz bedingte Ungleichgewicht zu beseitigen und somit die Homöostase wieder herzustellen (Cannon, 1914b). Für die physiologische unspezifische Reaktion auf verschiedene Reize machte Cannon das sympatho-adrenale System und damit die Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Noradrenalin verantwortlich.
Diese bereiten den Organismus auf eine Reaktion z.B. in Folge einer Gefahr vor und regulieren Körperfunktionen wie Herzfrequenz, Atmung und Energiebereitstellung aus oder -speicherung in Organen wie der Leber. Der Sympathikus wirkt aktivierend und der Parasympathikus hemmend auf den Organismus.
Obwohl ein zentrales Moment der Theorie die Unspezifität der Reaktion ist, räumte Cannon später dennoch individuelle Eigenschaften wie Alter und körperlicher Fitness, einen Einfluss auf die individuelle Ausprägung des homöostatischen Ungleichgewichts ein (Cannon, 1935).
Cannon erkannte, dass das Truncus cerebri (Stammhirn) auf unerwartete Reize reflexartig reagiert und in kürzester Zeit entscheidet, ob die Situation als Gefahr einzuschätzen ist. Cannons Annahme (1927) beschreibt weiter, der Körper werde unmittelbar über eine sympathische Aktivierung auf eine Fight-or-flight-Response (Kampf-oder-Flucht-Reaktion) vorbereitet werden, welche das Überleben des Individuums sichern soll. Die darauf folgende Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin bewirkt eine Erhöhung der zentralen und kardialen Durchblutung, eine Konstriktion der peripheren Gefäße sowie eine vermehrte Herzaktivität, gesteigerte Muskeldurchblutung und Blockierung des Magen-Darm-Trakts. Es entsteht ein Ungleichgewicht (Heterostase) zugunsten des Sympathikus.
Da Sympathikus und Parasympathikus Einfluss auf verschiedene Organe haben, würde eine stetige Heterostase zugunsten des Sympathikus - also chronischer Stress - mit einer dauernden Überfunktion bzw. Unterfunktion - z.B. im Fall des Magen-Darm- Trakts - der betroffenen Organe kommen und somit mit körperlichen Auffälligkeiten einhergehen.
2.1.2 Das Allgemeine Adaptationssyndrom (Selye)
Die Beschreibung von Stress als „eine unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung“ in einer präzisen endokrinologischen Umschreibung, ist auf Selye (1936) zurückzuführen.
Hans Selye beobachtete, dass Reaktionen auf unterschiedlich belastende Reize ähnlich ausfallen. So beschrieb er, dass Patienten mit einer schweren Erkrankung, einem hohen Blutverlust nach einem Unfall oder einer länger anhaltenden Erkältung, allesamt ähnliche Symptome wie Appetitlosigkeit, schwindende Muskelkraft und sinkende Aktivität zeigen. Außerdem beschrieb er, dass man diese Leiden in ähnlicher Weise in der Mimik der betroffenen Person wieder erkennen könne (Selye, 1981).
Daher sprach er von Stress als einem Syndrom in Form eines unspezifischen Reaktionsmusters des Organismus auf anhaltende Stressreize in drei Stufen. Dieses Syndrom bezeichnete Selye als das allgemeine Adaptionssyndrom (AAS) (Selye, 1974, 1976).
Das AAS beschriebt eine Wechselwirkung zwischen einer Reaktion auf einen Reiz und dem autonomen Nervensystem (ANS) (Selye & Fortier, 1950). Besondere Beachtung legt Selye hierbei auf die subjektiv erlebte Belastung durch einen Reiz, die entscheidend dafür ist, ob durch den Stressreiz lediglich eine kurzfristige organismische Heterostase entsteht, welche durch Adaption relativ schnell wieder aufgehoben wird oder aber, ob ein langfristiges Ungleichgewicht der Homöostase entsteht, welches Krankheiten zur Folge haben kann (Selye, 1981). Diese subjektive Bedeutungszuschreibung ist ein entscheidender Unterschied zur ursprünglichen Theorie von Cannon und spiegelt in größerem Umfang den Einfluss der Psyche auf den Körper während Stress wider.
2.1.2.1 Die Phasen des AAS
Aufbauend auf der Theorie Cannons, geht auch Selye davon aus, dass ein Organismus auf einen Stressor mit einer kurzzeitigen Erhöhung der Widerstandskraft reagiert, um dann in Form von Kampf oder Flucht reagieren zu können. Hierdurch entsteht das beschriebene Ungleichgewicht der Homöostase, welches via Adaption an den Stressor wieder behoben wird. Dieser Adaptionsprozess findet in zwei Phasen statt (siehe unten). Handelt es sich allerdings um eine langfristigere Aktivierung der Widerstandskraft, folgte eine dritte Phase der Adaption (siehe unten), die mit schädigenden Folgen für den Organismus einhergehen kann (Selye, 1981).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.1: Die drei Phasen des allgemeinen Adaptionssyndroms (AAS)
2.1.2.1.1. Alarmphase.
In der Alarmphase (siehe Abb. 2.1) wird das sympathische Nervensystem (SNS) aktiviert. Der Sympathikus bekleidet eine ergotrope Wirkung, welche die Handlungsbereitschaft des Organismus nach außen erhöht. Zugunsten der erhöhten Handlungsbereitschaft steigt allerdings auch der Energiebedarf des Organismus. Um diesen Energiebedarf zu decken, steigert der Sympathikus die Ausschüttung des adrenocorticotropen Hormons aus der Hypophyse, welches anregend auf das Nebennierenmark (NNM) und die Nebennierenrinde (NNR) einwirkt. Das NNM schüttet als Folge vermehrt die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin aus.
Der beschriebene Prozess hat im Gegensatz zur Aktivierung der HypothalamusHypophysen-Nebennierenrindenachse den entscheidenden Vorteil für den Organismus, dass er innerhalb von Sekunden auf einen Stressor reagieren kann.
Ein erhöhter Adrenalinspiegel bewirkt eine Blutzuckerspiegelerhöhung durch Abbau von Glykogen aus der Leber, eine EEG-Desynchronisation - in der Form, dass α-Wellen unterdrückt werden und schnelle β-Wellen vorzufinden sind - sowie eine erhöhte Durchblutung. Der Organismus ist also auf Aktivität und Handlung eingestellt, sowohl physisch als auch mental. In der Alarmphase findet außerdem ein rascher Anstieg endokriner Opiate statt, welche die Schmerzwahrnehmung hemmen (Selye, 1953).
Auch die Erhöhung des Noradrenalinspiegels wirkt sich blutdrucksteigernd aus, indem eine Vasokonstriktion stattfindet. Außerdem findet eine Lipolyse (Fettaufspaltung) statt, die neben der Erhöhung des Blutzuckers zusätzliche Energie bereitstellt. Die sympathisch bedingte Bronchodilatation steigert die Sauerstoffaufnahme und eine zusätzliche Erhöhung der Herzfrequenz sichert ab, dass die Muskeln und das Gehirn mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden, um die bevorstehende Handlung ausführen zu können.
Bei einem länger anhaltenden Stressor wird außerdem die Ausschüttung von Somatotropin aus der Hypophyse erhöht. Dieses Hormon steigert den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel - der Körper stellt also zusätzliche Energiereserven bereit. Die Sekretion des adrenocortocotropen Hormons geht ebenfalls mit einer gesteigerten Freisetzung von Glucocorticoiden einher, die bei länger anhaltendem Stress ausgeschüttet werden.
Von besonderer Bedeutung für die Stressforschung ist das Cortisol. Eine erhöhte Cortisolausschüttung wirkt fördernd auf den Proteinabbau in den Knochen, den Muskeln und dem lympathischen Gewebe des Organismus, um weitere Energiereserven bereitzustellen. Dieser Proteinabbau steigert die Abgabe von Aminosäuren in das Blut, welche sich fördernd auf die Glucoseneubildung aus der Leber auswirken und den Blutzuckerspiegel noch einmal erhöhen. Ein weiterer Effekt der gehemmten Proteinsynthese ist allerdings auch die Unterdrückung des Immunsystems. Bei langfristigem Stress bedeutet diese Unterdrückung, dass die Entzündungshemmung beeinträchtigt ist und eine gesteigerte Affinität für Infektionen besteht.
Außerdem gibt es neuere Hinweise darauf, dass sich Cortisol degenerierend auf das neuronale System (Gould & Tanapat, 1999; Carrion, Weems & Reiss, 2007) und über diese neurodegenerative Auswirkung auf die mentale Gesundheit einwirkt (Cirulli et al., 2009).
2.1.2.1.2 Widerstandsphase.
In der zweiten Phase, der sogenannten Widerstandsphase (auch Resistenzphase genannt), erreicht die Adaption ihren Höhepunkt. Dauert die Stresssituation länger an als z.B. bei einem kurzen (wenige Sekunden) lauten Ton, findet eine dem SNS entgegenwirkende Aktivierung des parasympathischen Nervensystems (PNS) statt, um die Homöostase wieder herzustellen.
Die Konzentration von Adrenalin, Noradrenalin und Cortison bleibt allerdings vorerst unverändert. Die parasympathische Aktivierung steigert aber nun die Aldosteronausschüttung aus der NNR und bewirkt somit eine Vasokonstriktion der gleichen. Aldosteron hat des Weiteren fördernde Auswirkungen auf entzündliche Prozesse (Selye, 1953).
2.1.2.1.3 Ersch ö pfungsphase.
Bei langfristigem Stress versagt der Widerstand und die der Steuerung des SNS unterliegenden Organe können Schaden davon tragen. Ebenfalls kann eine regressive Transformation der NNR stattfinden (Selye & Fortier, 1950). Diese dritte Phase bezeichnet Selye als Erschöpfungsphase. Aufgrund der kompletten Entleerung des Aldosteron aus der NNR geht die adaptive Kapazität verloren und die Energiereserven des Körpers werden aufgebraucht. Es kommt zu einer Vergrößerung der NNR, was zu verschiedenen Symptomen und somatischen Krankheiten wie dem Conn-Syndrom und Morbus Cushing führen kann. Auch Wachstums- und Fortpflanzungsprozesse sowie das Immunsystem büßen ihre Funktionstüchtigkeit ein (Selye, 1953). Das Zusammentreffen dieser Effekte bewirkt, dass die Stressbewältigung des Körpers nachlässt. Die Erschöpfungsphase tritt allerdings nach Selye (1953) selten ein und man spricht heute eher von Kurzzeit- und Langzeitfolgen von Stress.
Pathophysiologische und pathopsychologische Konsequenzen entstehen erst dann, wenn die Stressreaktionen chronisch, kontinuierlich oder ohne physiologische Notwendigkeit auftreten (Selye, 1953), wie es z.B. bei Bullying als einer der häufigsten Formen von Schulgewalt und somit psychosozialem Stress der Fall ist (Flaspohler et al., 2009).
2.1.2.2 Bewältigung von Langzeitstress
Wiederholen sich Stresssituationen, können diese je nach Bewältigung unterschiedliche Auswirkungen auf körperliche Veränderungen oder Veränderungen des zentralen Nervensystems (ZNS) haben. Belohnend wirkt Langzeitstress (z.B. durch die Ausschüttung des Sexualhormons Testosteron), wenn eine Stresssituation zunehmend erfolgreich bewältigt wird, da eine zeitliche Verschiebung der erhöhten Hypophysen-Nebennierenrindenaktivierung nach vorne stattfindet. In diesem Fall findet eine Adaption statt und der Stress hat keine schädigende Wirkung (Selye, 1975).
Reagiert das Individuum allerdings auf länger bestehende Belastungen eher mit Vermeidung, bleiben einige der hormonellen und autonomen Reaktionen erhöht und es können - oft durch Immunsuppression und Corticosteroidaktivität verursachte - somatische Krankheiten auftreten (Selye, 1953).
So können bei wiederholten erfolglosen somatisch-muskulär orientierten Bewältigungsversuchen (aktiv) eher Erkrankungen im Muskel- und Halteapparat auftreten wie z.B. chronische Muskelschmerzen. Findet hingegen eher eine Bewältigung durch Rückzug und Passivität (passiv) statt, so sind die Folgen durch Corticosteroide bedingt und es können immunsuppressionsbedingte Organschädigungen auftreten wie z.B. Magendarmbeschwerden, Asthma oder Migräne (Selye, 1953; Gerber & Gerber von Müller, 2002). Aber auch Fettleibigkeit, Gewichtsverlust, Bluthochdruck (Selye, 1981) oder Ulcusbildungen (dito) können Folgen chronischen Stresses sein.
Selye selbst unterschied zwischen zwei Entstehungsmöglichkeiten von Krankheiten, die in Verbindung mit dem AAS stehen. In der Resistenzsphase besteht ihm zufolge (1981) eine erhöhte Anfälligkeit für somatische Krankheiten wie z.B. Asthma, Hypertonie oder einen Stressulcus. Infektanfälligkeiten, depressive Zustände oder überhöhte Ängstlichkeit hingegen stehen nach Selye mit der Erschöpfungsphase im Zusammenhang.
2.1.3 Das Transaktionale Stressmodell (Lazarus)
2.1.3.1 Erste Untersuchungen
Die ersten Untersuchungen zu Stressreaktionen führte Richard Lazarus zu Beginn der 1950er Jahre durch. Wie auch Cannon (siehe oben) betrachtete Lazarus Stress zuerst in Bezug auf Soldaten in Kampfsituationen. Dabei lag das Hauptaugenmerk zuerst auf Situationen, die während eines Kampfeinsatzes Soldaten dazu veranlassten, Verhaltensweisen zu zeigen, in denen sie „nicht mehr in der Lage sind, ihre Waffe abzufeuern, ernsthafte Beeinträchtigungen lebenswichtiger perzeptueller und motorischer Fertigkeiten zu zeigen, sich unnötig dem Feind ergeben oder neurotische bzw. sogar psychotische Symptome entwickeln“ (Lazarus, 1966, S. 11).
Aufgrund dieser Beobachtungen entstanden Folgeuntersuchungen, welche dazu dienten, für das in Kampfsituationen beschriebene Verhalten verantwortliche States und Traits zu identifizieren. Nach Kriegsende verlagerte sich sein Fokus der Stressforschung schließlich zunehmend auch auf den zivilen Bereich.
Der in den 50er Jahren in der Psychologie vorherrschende Behaviorismus spiegelte sich auch in der Stressforschung wider. Untersuchungen galten der Erforschung von beobachtbaren (Stress-)Reaktionen, die auf einen beobachtbaren (Stress-)Reiz folgten. Kognitive Prozesse fanden keine Berücksichtigung.
Auf der Grundlage einer Studie von Lazarus und Eriksen (1952) erklärte Lazarus die behavioristische Betrachtung in der Stressforschung als unzulänglich. Bestandteil dieser Studie war eine Untersuchung an 188 Studenten, welche ein Zahlen-Symbol Untertest der Wechsler Bellevue Intelligence Scale (1939) bearbeiten sollten. Vor der Bearbeitung wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass es von besonderer Bedeutung sei, ein gutes Ergebnis zu erzielen, da das Ergebnis einen guten Prädiktor für ihren weiteren Studienverlauf darstelle und daher an die Fakultät weitergeleitet werden würden. Daraufhin sollten die Versuchspersonen die Aufgaben bearbeiten. Nach dieser Bearbeitung wurde den Versuchspersonen der Experimentalgruppe mitgeteilt, sie hätten ein besonders schlechtes Ergebnis erzielt, während den Teilnehmern der Kontrollgruppe zurückgemeldet wurde, sie seien erfolgreich gewesen. Daraufhin sollten beide Versuchsgruppen eine weitere Aufgabe aus dem gleichen Intelligenztest bearbeiten. Während dieser Bearbeitung wurde den Versuchspersonen der Experimentalgruppe kontinuierlich mitgeteilt, dass ihre Leistung noch immer unterdurchschnittlich sei und den Anforderungen weiterhin nicht genügen würde, während den Studenten der Kontrollgruppe eine positive Rückmeldung gegeben wurde.
Das abhängige Maß dieser Studie war die aus der zweiten Intelligenzaufgabe resultierende Leistung. Lazarus und Eriksen beobachteten, dass trotz gleicher Experimentalbedingung die Versuchspersonen unterschiedlich auf die Stressinduzierung reagierten.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das transaktionale Stressmodell nach Lazarus?
Es beschreibt Stress als Ergebnis eines Bewertungsprozesses (primär, sekundär, Neubewertung), bei dem das Individuum entscheidet, ob eine Situation bedrohlich ist und ob Bewältigungsressourcen ausreichen.
Wie beeinflusst Stressvulnerabilität die Gesundheit von Kindern?
Kinder mit hoher Stressvulnerabilität leiden häufiger unter körperlichen Beschwerden und weisen eine geringere Lebensqualität im Vergleich zu weniger anfälligen Kindern auf.
Welche Copingstrategien sind für Kinder besonders bedeutsam?
Wichtige Strategien sind problemorientiertes Coping, emotionsorientiertes Coping (z.B. Suche nach sozialer Unterstützung) und destruktiv-ärgerbezogene Emotionsregulation.
Haben Schulnoten einen Einfluss auf körperliche Beschwerden?
Die Studie konnte in den meisten Fällen keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Benotung und dem Ausmaß körperlicher Beschwerden oder der Lebensqualität bestätigen.
Gibt es Geschlechtsunterschiede bei der Stressbewältigung?
In der vorliegenden Untersuchung konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen hinsichtlich der Stressvulnerabilität oder der körperlichen Beschwerden gefunden werden.
- Quote paper
- Jan Christopher Cwik (Author), 2010, Stress und Coping von Kindern im Schulalltag im Zusammenhang mit körperlichen Beschwerden und Lebensqualität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194416