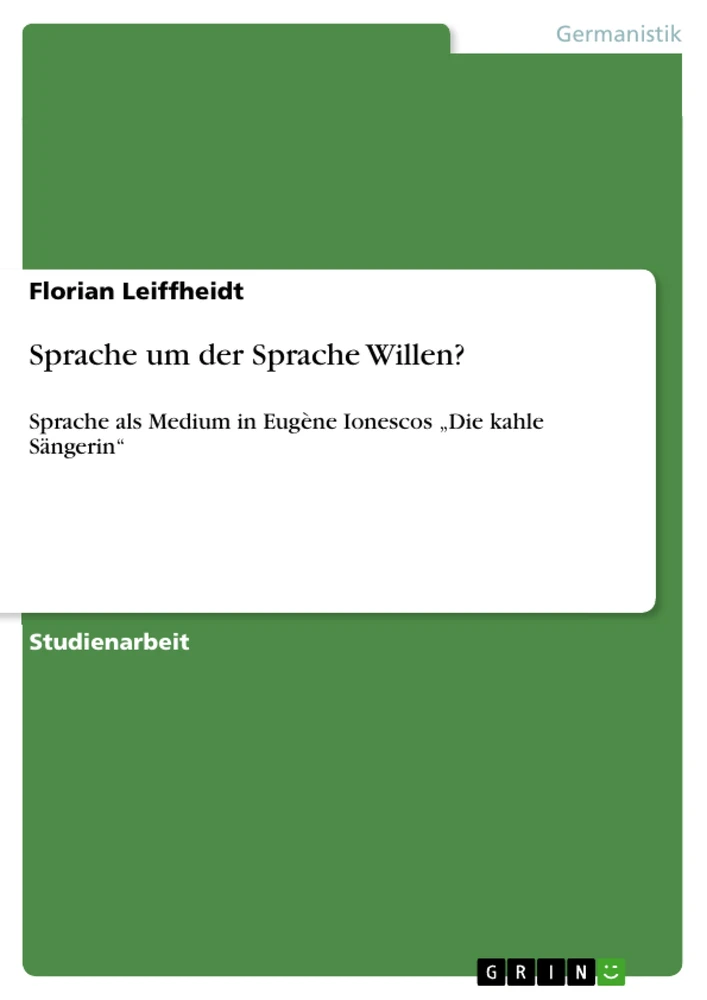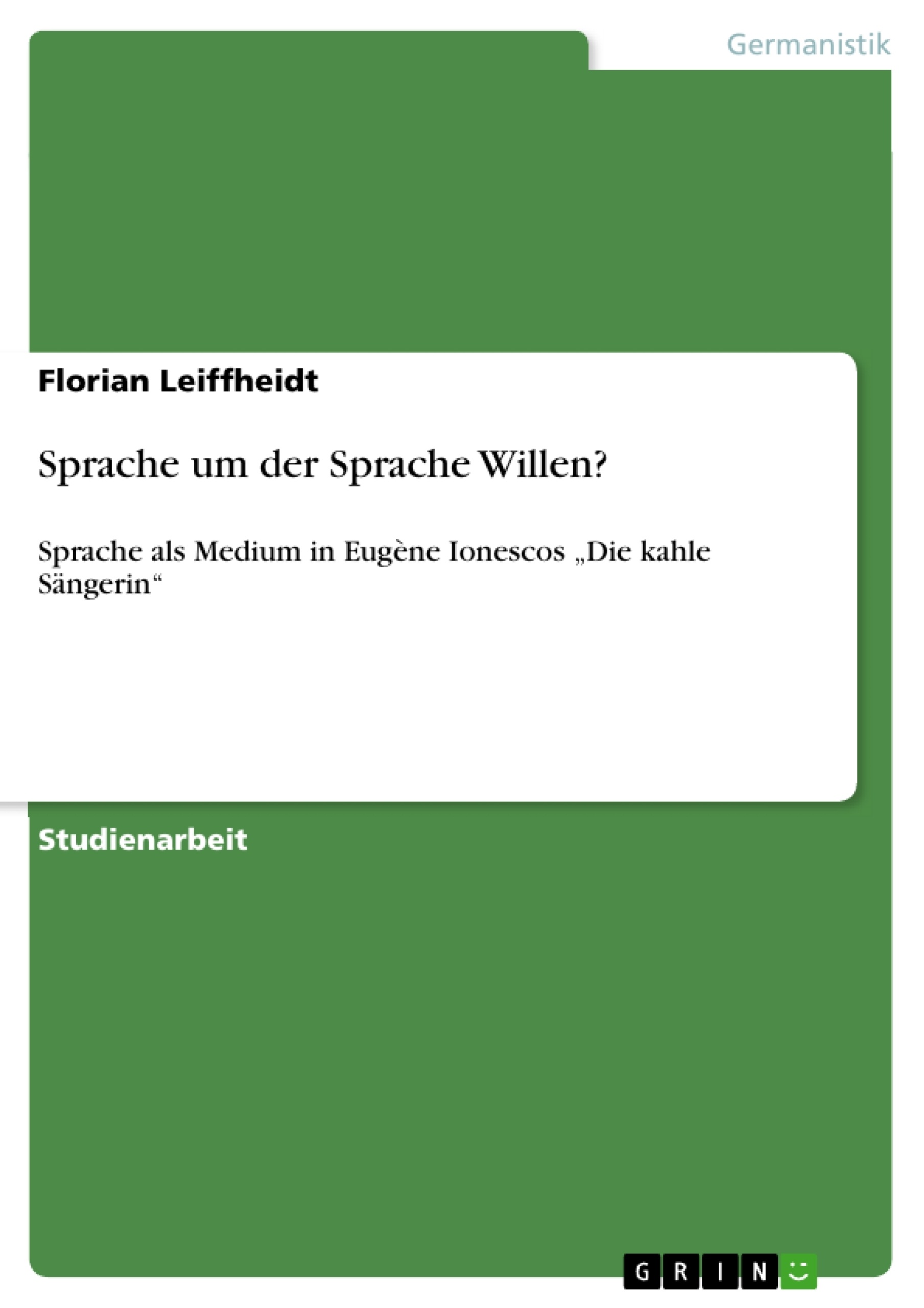Sprache als Medium dient, nicht zuletzt in Form von Bühnensprache im Theater und Film, dem Austausch von Informationen und beruht wie auch im menschlichen Zusammenleben auf Gegenseitigkeit und bestimmten Konventionen. Doch was geschieht mit dem Medium Sprache, wenn eben diese Konventionen konsequent und plakativ verletzt, nahezu negiert und zerstört werden? Eugène Ionesco (1912-1994) setzte mit seinem Erstlingswerk „Die kahle Sängerin“ (Uraufführung 1950 am Théâtre des Noctambules, Paris) eben solch einen Missbrauch der Sprache als Medium in Szene und schuf damit einen der Meilensteine in der Geschichte des Absurden Theaters in Frankreich und schließlich begründete dieses Theaterstück den internationalen Ruf des Theaterautors.
Doch wie verhält es sich mit dem Medium der Sprache in Ionescos Stück bzw. von ihm benannten Anti-Stück? Was ist das Besondere, Absurde, Tragische oder Zynische an der Sprache der Personen und welche Rückschlüsse lassen sich daraus in Bezug auf die Sprache als Medium und dessen Funktionen und Besonderheiten ziehen? Darauf möchte ich in meiner Arbeit im Folgenden eingehen. Zunächst empfehlen sich Informationen bezüglich der Entstehungsgeschichte des Stückes sowie eine Zusammenfassung seines Inhalts. Daran knüpft sich eine grobe Betrachtung zweier Szenen der „Kahlen Sängerin“ unter Berücksichtigung der Sprache als Medium sowie ihrer Gestaltung und damit verbundener Funktionen und medientheoretischer Rückschlüsse. Schließlich sollen die Betrachtungen und daraus resultierende Ergebnisse in einer Zusammenfassung komprimiert verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eugène Ionesco: „Die kahle Sängerin“
- Entstehung
- Inhaltszusammenfassung
- Die Tragödie der Sprache in Ionescos „Die kahle Sängerin“
- Ehekommunikation ad absurdum
- Vom Satz zum Wort zum Laut – De(kon)struktion durch Sprache
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Eugène Ionescos Theaterstück „Die kahle Sängerin“ und untersucht die Rolle der Sprache als Medium innerhalb des absurden Theaters. Der Fokus liegt auf der De(kon)struktion von Konventionen und der Tragödie der Sprache, die sich in der Kommunikation der Figuren zeigt.
- Die Verwendung von Sprache im absurden Theater
- Die De(kon)struktion sprachlicher Normen und Konventionen in „Die kahle Sängerin“
- Die Darstellung von Kommunikationsproblemen und Sinnverlust durch Sprache
- Die Auswirkungen der sprachlichen Gestaltung auf die Dramaturgie des Stücks
- Die Bedeutung des Mediums Sprache für die Inszenierung des Absurden
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und beleuchtet die Rolle der Sprache als Medium im Theater. Das zweite Kapitel widmet sich Eugène Ionescos „Die kahle Sängerin“ und untersucht die Entstehung des Stücks, seine Inhaltszusammenfassung und die Besonderheiten der Sprache in diesem Kontext. Im dritten Kapitel werden zwei Szenen der „Kahlen Sängerin“ im Hinblick auf die Sprache als Medium und ihre Gestaltung sowie die damit verbundenen Funktionen und medientheoretischen Rückschlüsse betrachtet.
Schlüsselwörter
Absurdes Theater, Eugène Ionesco, „Die kahle Sängerin“, Sprache als Medium, De(kon)struktion, Kommunikation, Tragödie der Sprache, Sprachlosigkeit, Sinnverlust, absurde Dramaturgie, Theatertheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Sprache in Ionescos „Die kahle Sängerin“?
Ionesco nutzt einen bewussten Missbrauch der Sprache, indem er sprachliche Konventionen verletzt, negiert und zerstört, um die Absurdität menschlicher Kommunikation darzustellen.
Warum bezeichnete Ionesco das Stück als „Anti-Stück“?
Es bricht mit traditionellen dramaturgischen Regeln und zeigt eine Welt, in der Sprache nicht mehr zur Verständigung, sondern zur De(kon)struktion von Sinn führt.
Wie wird das Thema „Ehekommunikation“ im Stück behandelt?
Das Stück führt die Kommunikation zwischen Ehepaaren ad absurdum, um die Sprachlosigkeit und den Sinnverlust im menschlichen Zusammenleben zu verdeutlichen.
Was ist die „Tragödie der Sprache“ in diesem Kontext?
Die Tragödie besteht darin, dass die Sprache als Medium versagt und sich von Sätzen zu bloßen Lauten auflöst, was die Isolation der Individuen widerspiegelt.
Welche medientheoretischen Rückschlüsse zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie das Medium Sprache im Theater funktioniert, wenn seine grundlegenden Regeln der Gegenseitigkeit und Konvention außer Kraft gesetzt werden.
- Quote paper
- Florian Leiffheidt (Author), 2011, Sprache um der Sprache Willen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194495