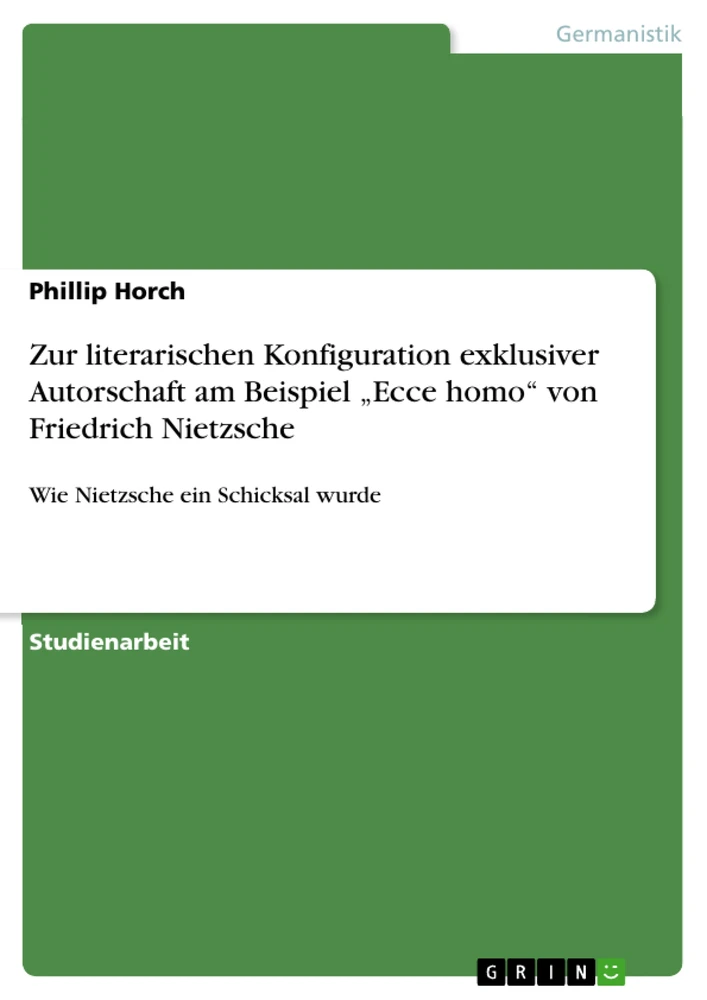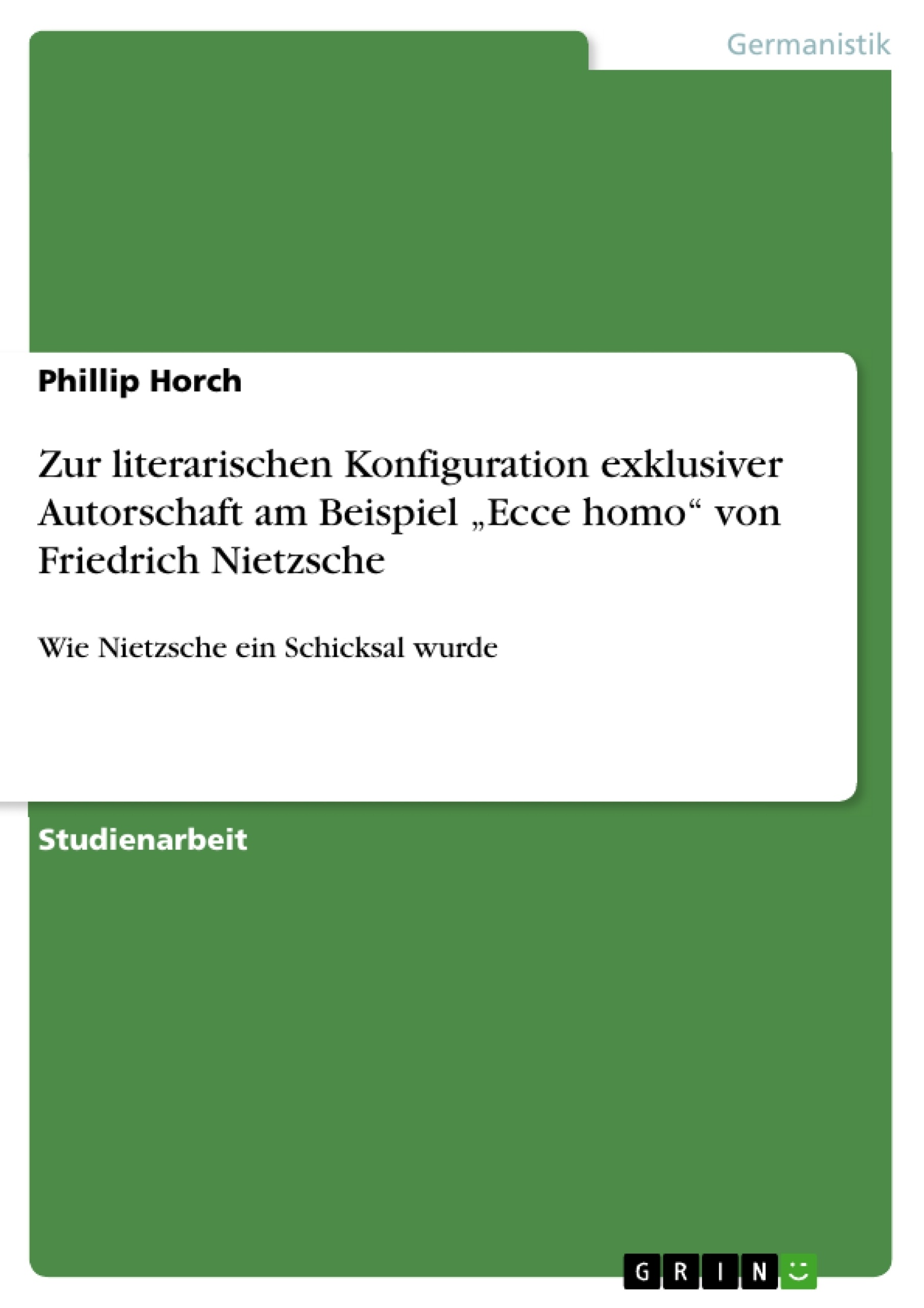„[…] was ich bin, projizierte sich auf irgendeine zufällige Realität […].“ (66)
Mit Ecce homo - Wie man wird, was man ist hat Friedrich Nietzsche ein Manifest seiner Selbst erschaffen, durch das er sich, wie der Titel programmatisch ankündigt, zu dem machen wollte, was er ist. Durch die herausragende Einzigkeit seiner Schrift, lässt sie sich schwerlich der konventionellen Kategorie „Autobiographie“ zuordnen, obwohl sie oft als eine ebensolche betitelt wird. Philippe Lejeune stellt in Der autobiographische Pakt als Grundbedingung für den Titel „Autobiographie“ die Bedingung auf, dass eine Identität zwischen dem Autor, dem Erzähler und dem Protagonisten besteht. Diese Identität ist in Ecce homo keinesfalls gegeben. Das schreibende Ich wird während der Textgenese vom Autor separiert, um mit dem vorbereitenden Schriftstück für der Antichrist zu einem Schicksal zu verschmelzen . Diese Arbeit wird die inszenatorischen Komponenten Nietzsches letzten niedergeschriebenen Werkes beleuchten und dabei untersuchen, wie sich im Werk das Verhältnis von Schrift, Textereignis und Autor(de-)figuration verhält.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstlegitimation und Inszenierung von Exklusivität in „Ecce homo“ – Wie man ein Schicksal wird
- Inszenierung des exklusiven Autors - Wer ist Friedrich Nietzsche?
- Definition durch Exklusion – Wie man wird, was man ist, indem man sagt, was man nicht ist
- Familiäre Konstellationen
- Nationale Identität
- Physiologische Aspekte
- Exklusive Inspiration
- Grundlegung zur Apotheose – Warum „Ich“ so viel besser sein muss
- Vom Autor zum Gott – Figuration als Dionysos
- Rezeptionsvorgaben: Verhältnis des exklusiven Autors und seiner Leser
- Der gute Leser
- Nietzsches Biographie als Werkkommentar
- Inszenierung des exklusiven Autors - Wer ist Friedrich Nietzsche?
- Siehe, welch ein „Ich“!
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Friedrich Nietzsches "Ecce homo" und untersucht, wie er sich in diesem Werk zum "Schicksal" macht, indem er seine einzigartige Position als Autor inszeniert. Dabei werden die strategischen Komponenten der Selbstlegitimation und die Inszenierung von Exklusivität beleuchtet.
- Inszenierung des exklusiven Autors
- Definition des Selbst durch Ausschluss und Paradoxien
- Verhältnis von Autor, Text und Ich
- Nietzsches Werk als autobiographisches Textstück
- Die Rolle der Rezeption in der Konstruktion des Autors
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Frage nach der Inszenierung von Exklusivität in "Ecce homo" dar. Es werden die Thesen von Erich Kleinschmidt und Hugh J. Silverman herangezogen, um den besonderen Charakter von Nietzsches autobiographischem Text zu beleuchten.
Das Kapitel "Selbstlegitimationsstrategien und Inszenierung von Exklusivität in „Ecce homo" Wie man ein Schicksal wird" befasst sich mit der Inszenierung des exklusiven Autors. Der Fokus liegt auf der Definition des Selbst durch Ausschluss, die Darstellung von Familienkonstellationen, nationaler Identität, physiologischen Aspekten, exklusiver Inspiration, der Grundlegung zur Apotheose und der Figuration als Dionysos.
In der weiteren Analyse werden die Rezeptionsvorgaben und das Verhältnis des exklusiven Autors zu seinen Lesern betrachtet, wobei insbesondere die Rolle des "guten Lesers" und Nietzsches Biographie als Werkkommentar untersucht werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Autorschaft, Exklusivität, Selbstlegitimation, Inszenierung, Autobiographie, "Ecce homo", Friedrich Nietzsche, Dionysos, Rezeption, "guter Leser", Umwertung aller Werte, décadent, Schicksal.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird "Ecce homo" nicht als konventionelle Autobiographie betrachtet?
Da keine Identität zwischen Autor, Erzähler und Protagonist besteht und Nietzsche sich im Text eher als "Schicksal" inszeniert, bricht das Werk mit dem klassischen autobiographischen Pakt nach Lejeune.
Welche Rolle spielt die Figur des Dionysos in dem Werk?
Nietzsche nutzt die Figuration als Dionysos zur Apotheose des eigenen Ichs, um den Übergang vom sterblichen Autor zu einer überzeitlichen Instanz darzustellen.
Wie definiert Nietzsche seine Identität in "Ecce homo"?
Er definiert sich oft durch Exklusion – indem er betont, was er nicht ist (z.B. in Bezug auf nationale Identität oder familiäre Konstellationen), um seine Exklusivität hervorzuheben.
Was versteht Nietzsche unter einem "guten Leser"?
Die Arbeit untersucht Nietzsches Rezeptionsvorgaben, nach denen ein Leser bestimmte kognitive und ästhetische Voraussetzungen erfüllen muss, um sein Werk angemessen zu erfassen.
Was ist das Ziel der Selbstinszenierung in diesem Spätwerk?
Ziel ist die Selbstlegitimation als philosophisches Schicksal und die Vorbereitung auf die "Umwertung aller Werte", die er als seine historische Mission ansah.
- Arbeit zitieren
- Phillip Horch (Autor:in), 2012, Zur literarischen Konfiguration exklusiver Autorschaft am Beispiel „Ecce homo“ von Friedrich Nietzsche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194555