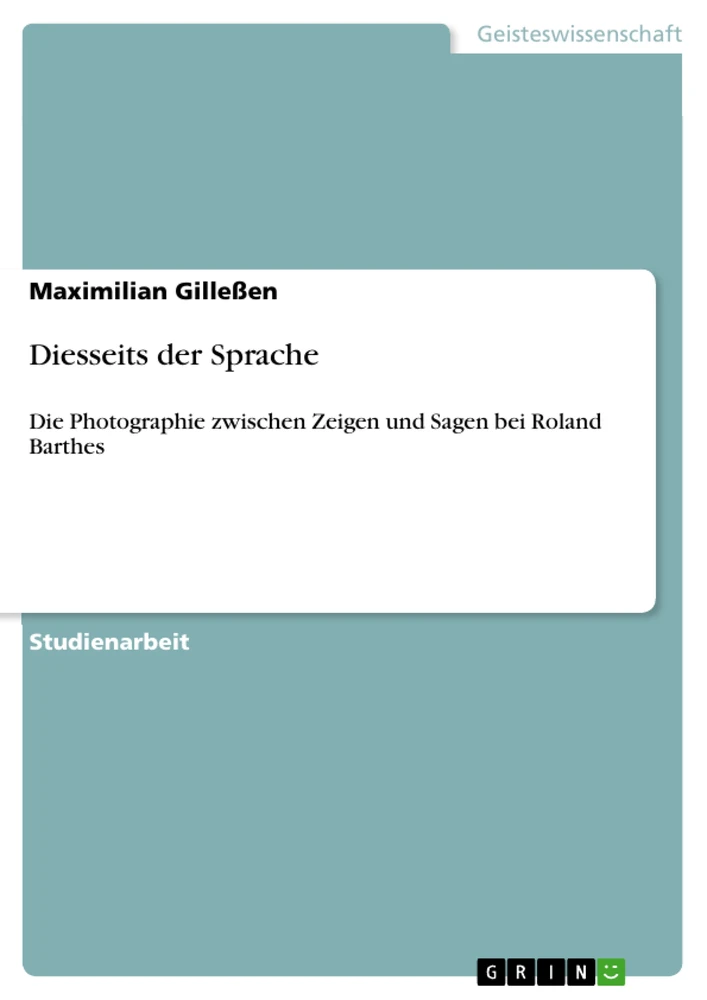Von seinen frühesten Texten an bis hin zu seinem letzten, kurz vor seinem unerwarteten Tod veröffentlichten Buch 'La Chambre Claire' zeichnet sich ein besonderes Interesse für die Photographie im Werk von Roland Barthes ab.
Dieses Interesse zeugt zugleich von einer grundlegenden Irritation, deren Produktivität es im Verlauf dieser Arbeit aufzuzeigen gilt. Denn versucht Barthes in den Analysen seiner frühen Texte vor allem die ideologischen Effekte eines Mediums zu entlarven, das aufgrund seiner vermeintlichen Objektivität die Naturalisierung geschichtlicher und sozioökonomischer Zusammenhänge erlaubt, so betont er doch zugleich die semiologisch irreduzible Referentialität des photographischen Bildes, die es jenseits aller konnotativen Zeichen zu einer „Botschaft ohne Code“ macht.
Diese Auffassung der Photographie als eines „reinen Analogons“ des Wirklichen wird schließlich für die methodologische Herangehensweise der Analysen in La Chambre Claire bestimmend sein: „[O]bschon“, wie Barthes weiterhin betont, „Codes selbstverständlich ihre Lektüre steuern“, erweist sich doch für ihn die Photographie vor jeder kulturellen Codierung als „eine Emanation des vergangenen Wirklichen“. Das endlose Gewebe der Bedeutung, der Kommunikation und der Sprache 'punktierend', verweist das photographische Bild unhintergehbar auf ein singuläres, kontingentes und zeitlich irreversibles Ereignis, dessen (Licht-)Spur es ist. Diese direkte Referenz auf ein Gewesenes trennt es strukturell von allen anderen Bildern, denn als „Beglaubigung von Präsenz“ (HK, 97) ist die Photographie, um die Unterscheidung Charles Sanders Peirces aufzugreifen, kein Ikon, sondern Index.
Aus dieser medien- und zeichentheoretischen Perspektive soll im Folgenden der Versuch geleistet werden, die Texte Roland Barthes' zur Photographie als eine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen des Sagbaren und des Zeigbaren zu deuten. Entscheidend ist dabei für ihn das Moment der rein (auf)zeigenden Geste des 'Dies, das, da', die paradoxe Wieder-Holung des Einmaligen in die Gegenwart. Jedoch bleibt diese Geste der Photographie, wie sich zeigen wird, für Barthes ambivalent: einerseits befreit sie vom 'Faschismus der Sprache1; andererseits birgt die Begegnung mit dem Nicht-Symbolisierbaren des Realen ein traumatisches Potential, in dem das Begehren nach dem anderen, die Zeitlichkeit und die Gewissheit des Todes sich unlösbar miteinander verschränken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Photographie und die Zeichen
- Photographie und Mythos
- Das photographische Paradox
- Denotation und Konnotation des photographisches Bildes
- Die Wunde des Einmaligen
- Der ontologische Status des photographischen Bildes: Die Helle Kammer
- Die photographische Spur
- Gesten des Zufalls
- Schluss: Das Bild, das Begehren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Photographie im Werk von Roland Barthes. Sie untersucht dessen jahrzehntelange Beschäftigung mit den Möglichkeiten und Grenzen des Sagbaren und des Zeigbaren in der Photographie, insbesondere die Frage, inwieweit das photographische Bild ein „reines Analogon“ des Wirklichen darstellt. Die Arbeit verfolgt dabei den Wandel in Barthes' Betrachtungsweise von der Analyse der ideologiekritischen Funktion der Photographie zu seiner späten Beschäftigung mit der „Emanation des vergangenen Wirklichen“ in der Helle Kammer.
- Die Semiotik der Photographie
- Die photographische Spur als Index
- Das Paradox des Einmaligen
- Die Ambivalenz der zeigenden Geste
- Die Beziehung von Sprache und Photographie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Barthes' kontinuierliches Interesse an der Photographie und dessen Verbindung zu einer fundamentalen Irritation heraus. Die Arbeit zeigt, wie sich diese Irritation durch die Untersuchung der ideologiekritischen Funktion der Photographie im Kontext ihrer vermeintlichen Objektivität entwickelt und schließlich zur „Botschaft ohne Code“ führt, die Barthes in seiner späten Phase als „Emanation des vergangenen Wirklichen“ betrachtet.
Kapitel 2 beleuchtet die verschiedenen Ansätze zur Analyse der Photographie im 20. Jahrhundert, die von der Wahrnehmungspsychologie über die Soziologie bis hin zur strukturalen Semiologie reichen. Die Arbeit hebt Barthes' eigenständigen Beitrag hervor, der den Widerstand des photographischen Bildes gegen die vollständige Semiotisierung und die Bedeutung dieses „Surplus“ des Bildes für seine Analysen beleuchtet.
Kapitel 3 betrachtet die Ambivalenz der zeigenden Geste der Photographie. Die Arbeit untersucht, wie diese Geste einerseits von der „Faschismus der Sprache“ befreit, andererseits aber auch das traumatisches Potential der Begegnung mit dem Nicht-Symbolisierbaren birgt.
Schlüsselwörter
Roland Barthes, Photographie, Semiotik, Index, Denotation, Konnotation, Mythos, Zeigen, Sagen, Helle Kammer, Sprache, Realität, Zufall, Begehren, Spur, Einmaligkeit, Ambivalenz
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Roland Barthes' Begriff 'Botschaft ohne Code'?
Barthes bezeichnete die Fotografie so, weil sie das Wirkliche direkt abbildet (Denotation), bevor kulturelle Interpretationen (Konnotation) hinzukommen.
Warum ist die Fotografie für Barthes ein 'Index'?
Im Sinne von C.S. Peirce ist sie eine physische Spur (Lichtspur) eines vergangenen Ereignisses, eine 'Beglaubigung von Präsenz'.
Was ist das Thema des Buches 'Die helle Kammer' (La Chambre Claire)?
Es ist Barthes' letztes Werk, in dem er die Ontologie der Fotografie, das Trauma des Realen und die Verbindung von Bild und Tod untersucht.
Was meint Barthes mit dem 'Faschismus der Sprache'?
Er beschreibt damit den Zwang der Sprache, Dinge einzuordnen und zu symbolisieren, wovon die rein zeigende Geste der Fotografie befreien kann.
Was ist der Unterschied zwischen Denotation und Konnotation beim Foto?
Denotation ist das reine Abbild ('Was ist da?'), Konnotation ist die kulturelle, ideologische oder gefühlsmäßige Bedeutung, die wir dem Bild geben.
- Quote paper
- Maximilian Gilleßen (Author), 2011, Diesseits der Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194805