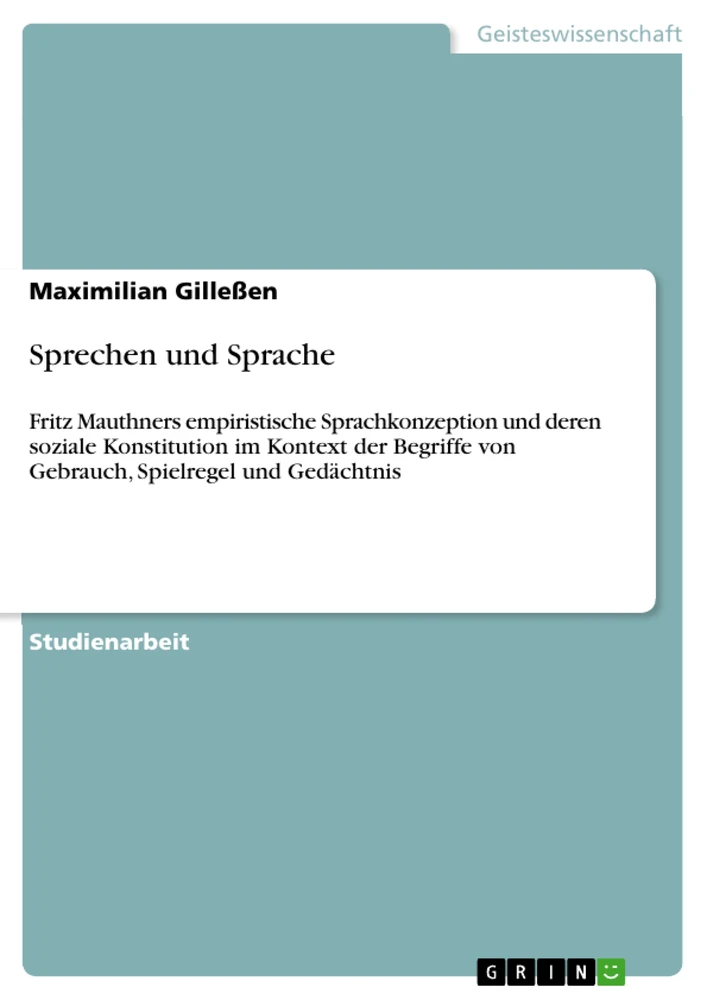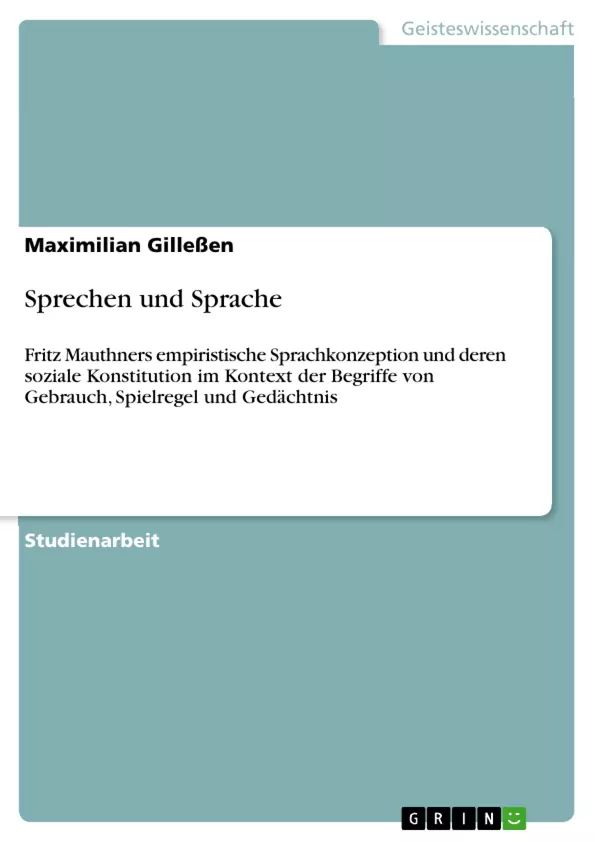Im Zentrum dieser Arbeit soll Fritz Mauthners Versuch einer Rückbindung seines Sprachbegriffs an die konkrete Dynamik individueller Sprechakte stehen. Diese sind nur kommunikabel zu erfahren, da sie immer schon in eine soziale Lebenswelt eingebunden sind. Die soziale Praxis gewinnt damit einen Vorrang vor der essentialistischen Bestimmung eines abstrakten Begriffs von Sprache, der diese als universal gegebenes System postuliert. Gebrauch, Gedächtnis, Gemeinschaft und Anerkennung werden so zu wesentlichen Begriffen der Mauthnerschen Konzeption von Sprache, die es im Folgenden in ihren immanenten Konstellationen zu erarbeiten gilt.
Eine solche empiristische Konzeption erlaubt Mauthner eine Darstellung des Verhältnisses von Individualsprachen und deren überindividuellen Eingebundensein in eine Sprachgemeinschaft, ohne – wie etwa der Saussuresche Strukturalismus oder die Vertreter einer Generativen Grammatik – auf einen metaphysischen Begriff von Sprache als vom Sprechen unabhängiges System rekurrieren zu müssen. Im Kontext der Mauthnerschen Erkenntnistheorie aber führt dieser durch das Soziale bestimmte Sprachbegriff zu schwerwiegenden anthropologischen, ästhetischen und epistemologischen Konsequenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Einführung
- Individualsprachen
- Sprache als Gebrauch
- Sprache als Spielregel
- Sprache als Gedächtnis
- Eine Metaphysik der Gewohnheit
- Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Fritz Mauthners Sprachkonzeption und analysiert, wie diese an die konkrete Dynamik individueller Sprechakte gebunden ist. Mauthner argumentiert für eine empiristische Sichtweise, die die soziale Lebenswelt und die kommunikative Praxis in den Vordergrund stellt. Er lehnt es ab, Sprache als ein abstraktes, universales System zu betrachten. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die zentralen Elemente von Mauthners Sprachphilosophie, insbesondere die Begriffe Gebrauch, Gedächtnis, Gemeinschaft und Anerkennung, in ihren Zusammenhängen zu beleuchten.
- Kritik am metaphysischen Sprachbegriff
- Sprache als Ergebnis von individuellen Sprechakten
- Die Rolle von Gebrauch und Spielregel in der Sprachkonstitution
- Sprache als Gedächtnis und deren Auswirkungen auf die Kommunikation
- Soziale und anthropologische Konsequenzen von Mauthners Sprachkonzeption
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit Mauthners Kritik am traditionellen Sprachbegriff und stellt die Individualsprache als Ausgangspunkt seiner Analyse dar. Mauthner argumentiert, dass die Sprache nicht als ein abstraktes Wesen existiert, sondern sich in den individuellen Sprechakten realisiert. Er zeigt die Variabilität der Individualsprachen auf, die durch die soziale und lebensweltliche Bedingtheit der Kommunikation geprägt ist. Im zweiten Kapitel widmet sich die Arbeit Mauthners Konzept der Sprache als Gebrauch. Er betont, dass Sprache kein Werkzeug ist, sondern einzig und allein ihr Gebrauch. Sprache realisiert sich durch die soziale Praxis und den konkreten Austausch. Das dritte Kapitel untersucht die Sprache als Spielregel. Mauthner zeigt, wie Sprache als ein System von Regeln und Übereinkünften funktioniert, die das menschliche Zusammenleben regulieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der Sprachphilosophie, darunter die Individualsprache, der Sprachgebrauch, die Spielregel und das Gedächtnis. Mauthners empiristische Sprachkonzeption, die die soziale und kommunikative Praxis betont, steht im Mittelpunkt der Analyse. Die Arbeit beleuchtet die anthropologischen, ästhetischen und epistemologischen Konsequenzen von Mauthners Sprachphilosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Fritz Mauthners Sprachphilosophie?
Mauthner vertritt eine empiristische Sichtweise, bei der die Sprache an konkrete individuelle Sprechakte gebunden ist. Er lehnt die Vorstellung von Sprache als abstraktem, universalem System ab.
Warum spielt der Begriff „Gebrauch“ eine so große Rolle?
Für Mauthner ist Sprache kein Werkzeug, das man besitzt, sondern sie realisiert sich ausschließlich durch ihren Gebrauch in der sozialen Praxis und im kommunikativen Austausch.
Was bedeutet „Sprache als Spielregel“?
Mauthner vergleicht Sprache mit einem System von Regeln und Übereinkünften, ähnlich wie Spielregeln, die das menschliche Zusammenleben und die Kommunikation innerhalb einer Gemeinschaft regulieren.
Wie grenzt sich Mauthner vom Strukturalismus ab?
Im Gegensatz zum Saussureschen Strukturalismus verzichtet Mauthner auf einen metaphysischen Begriff von Sprache als vom Sprechen unabhängiges System und konzentriert sich auf die Individualsprache.
Welche Konsequenzen hat Mauthners Sprachbegriff?
Seine Theorie führt zu tiefgreifenden anthropologischen, ästhetischen und epistemologischen Konsequenzen, da sie die Erkenntnis eng an die soziale und lebensweltliche Bedingtheit der Sprache knüpft.
- Quote paper
- Maximilian Gilleßen (Author), 2009, Sprechen und Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194809