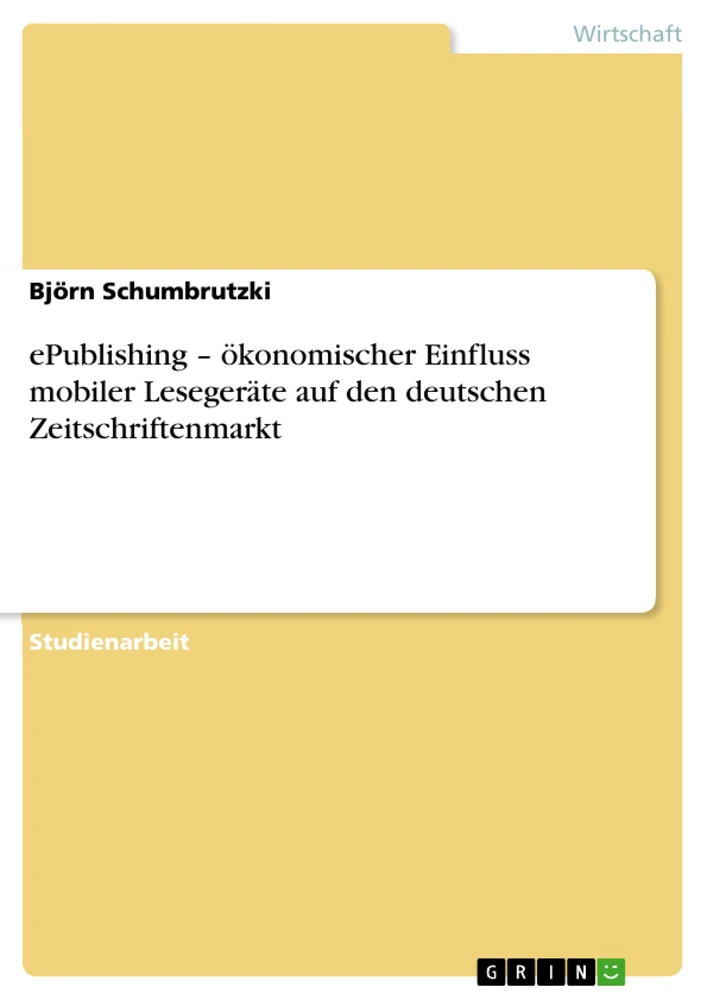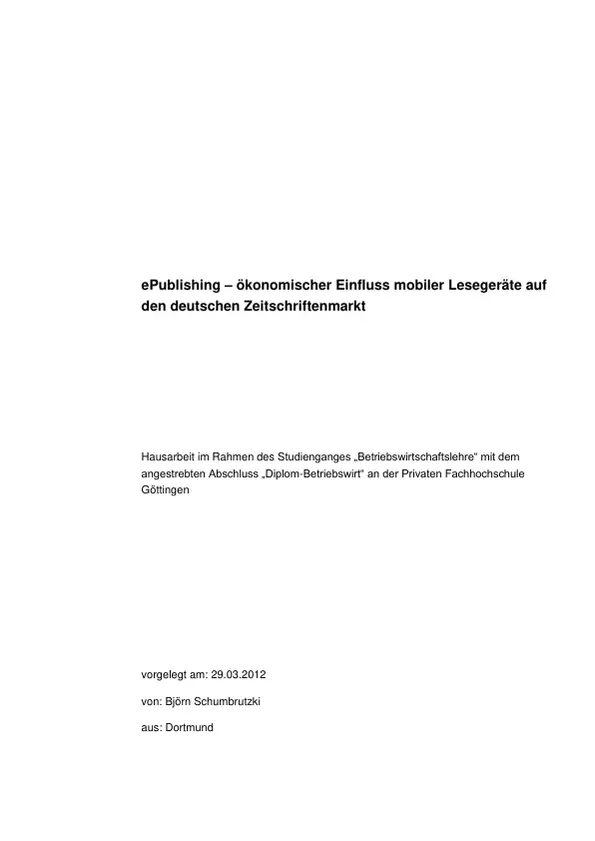Durch sinkende Anzeigenerlöse und rückläufige Auflagenzahlen gerieten die Verlage von Publikumszeitschriften seit 2008, dem Jahr der globalen Wirtschaftskrise, in eine Abwärtsspirale, aus der sie sich bis heute noch nicht befreien konnten. Verlage setzen daher große Erwartungen in die Erschließung neuer Zielgruppen und Umsatzquellen, die sich durch die mobilen Geräte ergeben sollen.
Technische Evolutionen haben die Medienbranche bereits in der Vergangenheit nachhaltig verändert und führten mehr als einmal zu einem Wandel des Nutzungsverhaltens sowie zur Entstehung neuer Erlösmodelle. So ergeben sich durch die zunehmende Verbreitung elektronischer Lesegeräte wie Amazons Kindle oder Apples iPad und die steigende Marktdurchdringung von Smartphones für die Zeitschriftenverlage viele neue Herausforderungen.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, einen Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklungen im ePublishing unter besonderer Berücksichtigung mobiler Lesegeräte zu geben und mögliche Auswirkungen für Zeitschriftenverlage in Deutschland zu erörtern.
Der Fokus der Betrachtung liegt dabei auf Publikumszeitschriften sowie den Chancen und Risiken, die sich Verlagen in den Geschäftsbereichen Produktion, Vertrieb und Vermarktung digitaler Zeitschriften bieten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des ePublishings
- Mobile Lesegeräte als Basis für digitale Zeitschriften
- Herausforderungen und Perspektiven für Zeitschriftenverlage
- Ökonomisch relevante Bereiche des digitalen Publizierens
- Produktion digitaler Zeitschriften
- Distribution digitaler Zeitschriften
- Werbliche Vermarktung digitaler Zeitschriften
- Fazit und Trends
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem ePublishing und den ökonomischen Auswirkungen mobiler Lesegeräte auf den deutschen Zeitschriftenmarkt. Sie analysiert die Chancen und Risiken, die sich für Verlage in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Vermarktung digitaler Zeitschriften ergeben.
- Entwicklung des ePublishing-Marktes
- Einfluss mobiler Lesegeräte auf das Konsumverhalten
- Neue Geschäftsmodelle und Umsatzpotenziale
- Herausforderungen für die Verlage im digitalen Umfeld
- Zukünftige Trends und Entwicklungen im ePublishing
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der deutschen Verlagslandschaft dar und erläutert den wachsenden Einfluss mobiler Lesegeräte auf den Zeitschriftenmarkt. Sie skizziert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Digitalisierung für Verlage ergeben.
- Das zweite Kapitel liefert eine grundlegende Definition des ePublishing und beleuchtet die technologischen Entwicklungen, die die Verbreitung digitaler Inhalte ermöglichen.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit den Eigenschaften mobiler Lesegeräte und deren Bedeutung für die Verbreitung digitaler Zeitschriften. Es werden verschiedene Gerätetypen vorgestellt und deren spezifische Vorteile für die Konsumenten erläutert.
- Das vierte Kapitel analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich für Verlage in den verschiedenen Bereichen des digitalen Publizierens ergeben. Die Themen Produktion, Vertrieb und Vermarktung von digitalen Zeitschriften werden in Bezug auf die neuen digitalen Möglichkeiten näher beleuchtet.
Schlüsselwörter
ePublishing, digitale Zeitschriften, mobile Lesegeräte, iPad, Kindle, Smartphone, Verlage, Produktion, Vertrieb, Vermarktung, Geschäftsmodelle, digitale Inhalte, Konsumverhalten, Herausforderungen, Chancen, Trends.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet ePublishing für Zeitschriftenverlage?
ePublishing umfasst das digitale Publizieren von Inhalten. Für Verlage bietet es die Chance, durch mobile Lesegeräte neue Zielgruppen zu erschließen und sinkende Print-Auflagen abzufedern.
Welchen Einfluss haben Geräte wie das iPad oder der Kindle?
Diese Geräte haben das Konsumverhalten verändert, indem sie das Lesen digitaler Zeitschriften komfortabel machen und neue Erlösmodelle (z.B. Paid Content oder interaktive Werbung) ermöglichen.
Was sind die größten Herausforderungen bei der digitalen Distribution?
Verlage müssen technische Hürden überwinden, passende Bezahlmodelle finden und sich in den Ökosystemen großer Anbieter (wie Apple oder Amazon) behaupten.
Wie verändert sich die werbliche Vermarktung im ePublishing?
Digitale Zeitschriften erlauben interaktive Werbeformate, eine genauere Erfolgsmessung und eine direktere Ansprache der Leser im Vergleich zur klassischen Print-Anzeige.
Warum gerieten Verlage seit 2008 in eine Abwärtsspirale?
Die globale Wirtschaftskrise führte zu massiv sinkenden Anzeigenerlösen und rückläufigen Auflagenzahlen, was den Druck zur digitalen Transformation massiv erhöhte.
- Quote paper
- Björn Schumbrutzki (Author), 2012, ePublishing – ökonomischer Einfluss mobiler Lesegeräte auf den deutschen Zeitschriftenmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194895