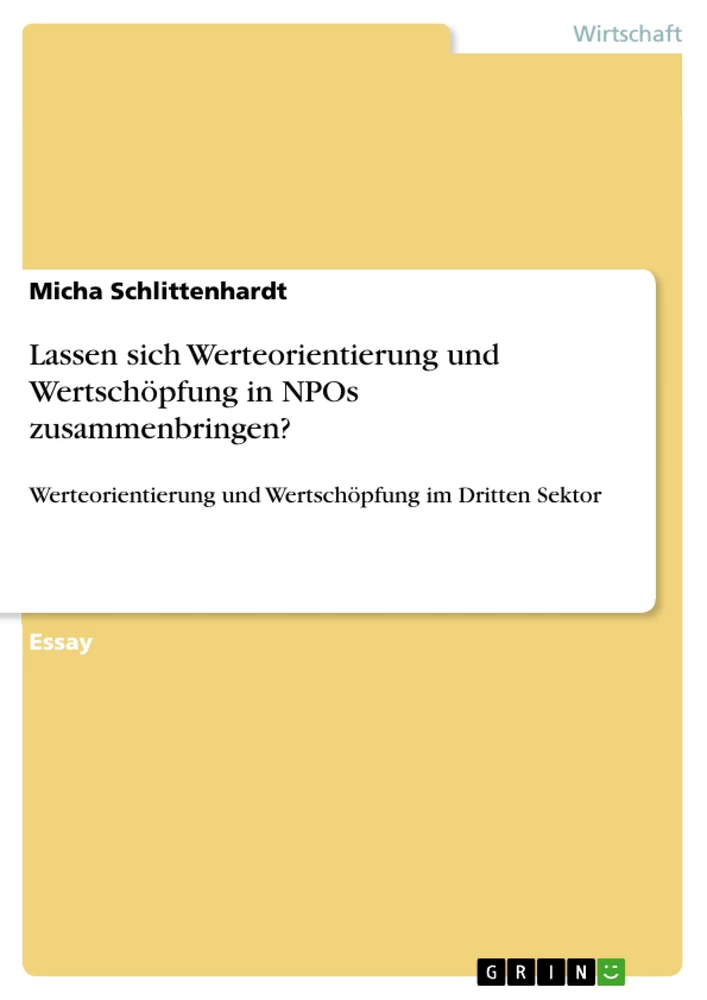Was bedeutet eigentlich Werteorientierung, und wie lässt sich dieser Begriff interkulturell ausleben? Braucht es hier sogar eine genauere Definition? Und wie kann diese Werteorientierung der NPO helfen sich zu entwickeln und zu wachsen? Bedarf es nicht doch einer Wertschöpfung über die eigene Bedarfsdeckung hinaus?
Die Begrifflichkeiten Werteorientierung und Wertschöpfung werden oft in einen Gegensatz gestellt. Dies gilt besonders bei marktorientierten Unternehmen, bei denen der Fokus im Wettbewerb auf einer hohen Effizienz und, deswegen, einer Funktionierenden Wertschöpfung liegt. Dieser ist die Werteorientierung durch Ethik Chartas[1] oder soziales Engagement nachgeordnet.[2] In Deutschland rückt die Soziale Verantwortung in der Öffentlichkeit immer mehr ins Blickfeld und Werte werden zu einem neuen Thema für Unternehmen, die sich mit ihnen auseinander setzen müssen (Anastassiou 2011).
Doch wie wird dieser scheinbare Gegensatz im Dritten Sektor umgesetzt? Ist hier von einem Gegensatz oder einer Rangordnung von Werteorientierung und Wertschöpfung zu reden oder kann sogar ein Zusammenspiel beider Perspektiven möglich sein? Diese Frage wird durch das stetige Wachstum des Dritten Sektors immer dringender. Insbesondere, da NPOs einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft genießen und mittlerweile immer mehr in das Licht der Forschung gerückt werden (Vgl. Priller/Zimmer 2001). Die Definition von NPOs könnte hierzu Aufschluss geben, da sie sich von Marktorientierten Unternehmen und dem Staat unterscheidet.
Non Profits und ihre Definition
Der Dritte Sektor gilt allgemeinals der moralische Sektor unter dem Organisationen als non-profits tätig sind. Hierbei wird die Einordnung in den Dritten Sektor argumentativ zwischen die Sektoren Staat und Markt, später auch „Familie bzw. informeller Sphäre“ (Schaad 1995), gestellt um die Gemeinnützigkeit der NPOs dazustellen (vgl. Reichard 1988). Im Gegensatz dazu ist der Zwang durch Sanktionen die Handlunsgmotivation für den Staat, und die Eigennützigkeit die Handlungsmotivation für den Markt. Manche gehen in der Definition noch weiter und unterteilen den Dritten Sektor in weitere Bereiche und Anforderungen an eine NPO (vgl. Bauer 1990, Anheier/Salamon 1992). Um die Übersicht zu wahren beziehe ich mich im Folgenden auf die Definition einer NPO nach Reichard (1988).
In NPOs wird davon ausgegangen, dass die Wertschöpfung selbst nur auf Bedarfsdeckung aus ist und somit keinen Profit erwirtschaftet. Des Weiteren wird von einer NPO erwartet, dass sie Werteorientiert handelt.
Doch was bedeutet eigentlich Werteorientierung, und wie lässt sich dieser Begriff interkulturell ausleben? Braucht es hier sogar eine genauere Definition? Und wie kann diese Werteorientierung der NPO helfen sich zu entwickeln und zu wachsen? Bedarf es nicht doch einer Wertschöpfung über die eigene Bedarfsdeckung hinaus?
Wie sieht Werteorientierung aus?
Verschafft man sich einen Überblick über alle Arten von NPOs, so findet man nicht in jeder NPO Werteorientierung, obwohl ihnen oft allgemein moralisches Handeln aufgrund der Bedarfsdeckung und dem dadurch herrschenden Bild, dass nicht dem der Markt und profitorientierten Unternehmen entspricht, zugeschrieben wird. Positive Wertschöpfung muss nicht unbedingt wertelos bedeuten. Umgedreht muss die Erwirtschaftung zur Bedarfsdeckung nicht unbedingt einer werteorientierten Organisation entsprechen, sondern kann ganz anderer Motivation sein. Wie Werte in NPOs gelebt werden geht dadurch nicht hervor.
Um an der Definition von Reichard (1988) festzuhalten, der den Dritten Sektor nochmals in vier Bereiche aufteilt, finden sich die allgemein als werteorientiert handelnde Organisationen in der dritten Gruppe, den „konventionell gemeinnützigen Einrichtungen“. Hierunter fallen Genossenschaften, Wohlfahrtsverbände und Hilfsdienste. Diese sind Mittelpunkt für alle weitere Argumentation zwischen der Werteorientierung und Wertschöpfung von NPOs.
Innerhalb dieser NPOs sind Mitarbeiter oft intrinsisch motiviert und handeln ehrenamtlich oder unter geringer Bezahlung. Im Gegensatz zum Markt nehmen „Individuen Nachteile in Kauf“ (Schaad 1995). Dieser Aspekt erfreut sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit, da dieses soziale Engagement als ein Charakteristikum einer moralisch gut handelnden Unternehmung aufgenommen wird.
Im westlichen Abendland wird der Fokus oft auf christlich-jüdische Wurzeln gelegt und die aus ihr resultierenden Regeln und Traditionen als Standard für eine Definition von Werten herangezogen. Doch dies schränkt den Begriff der Werteorientierung auf ein geographisches Gebiet ein. Mehr noch, auf einzelne Kulturen und Kulturräume. Ziehen wir beispielsweise den Nahen Osten und dessen Wertesystem heran, finden wir nicht nur Übereinstimmungen mit dem christlich-jüdischen Weltbild, doch kann es hier noch zu einem Dialog finden (Vgl. Bauschke 2007). Geht man einen Schritt weiter, und vergleicht diese mit dem asiatischen Raum, so findet man andere Handlungsweisen und Werte. Radikalisiert man diese Herangehensweise, so findet man in einigen schwer erreichbaren Stammeskulturen völlig andere Werte zu denen der arabischen oder christlich-jüdisch geprägten Welt, wenn es diese so konstant geben würde (vgl. Rathje 2009). Nach Rathjes Argumentation des radikalen Individuums hat jedes Individuum aus seiner Prägung durch verschiedene Kollektive, deren Teil das Individuum war oder ist, heraus ein eigenes Wertesystem und eine eigene Auffassung von Moral.
Auch der Versuch Werte durch eine globale gemeinsame Ethik zu finden scheitert oft durch jahrelange Diskurse und Debatten über verschiedene Einzelfälle und Thematiken, die nicht immer einen zufriedenstellenden Konsens finden (Vgl. Grubitzsch 2011).
[...]
[1] Beispielsweise bei HiPP (2006), einem Hersteller für Kindernahrung.
[2] Heidebrink (2008) umreist in seinem Essay zu der Frage „Wie moralisch sind Unternehmen?“ diesen scheinbaren kognitiven Gegensatz.
- Citar trabajo
- Micha Schlittenhardt (Autor), 2011, Lassen sich Werteorientierung und Wertschöpfung in NPOs zusammenbringen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194913