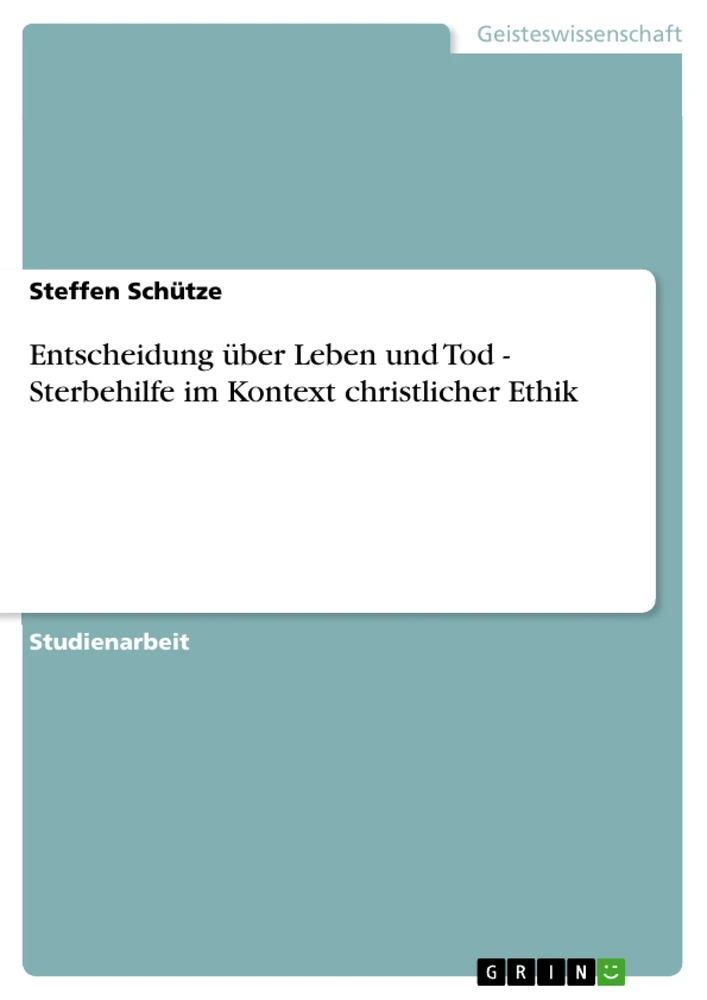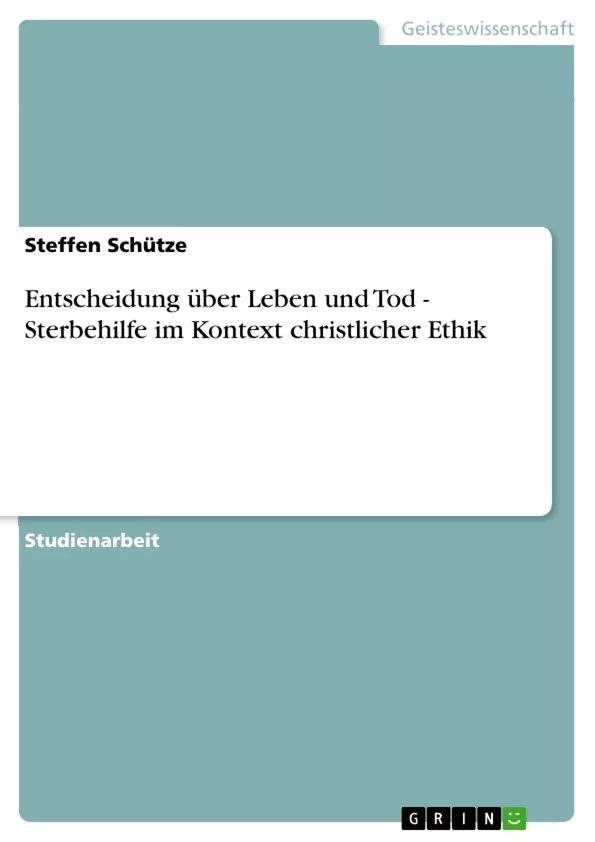„Doch wach ich immer wieder auf
und immer wär' ich lieber tot“
Ramon Sampedro wollte sterben. Jahrzehntelang. Nachdem er 1965 infolge eines Unfalls vom Hals abwärts gelähmt war, hatte er nur noch den Wunsch zu sterben. Und doch konnte er sich selbst nicht das Leben nehmen, sondern war auf die Hilfe anderer angewiesen. Deshalb kämpfte er Jahre lang für das Recht auf Sterbehilfe, das ihm allerdings immer versagt blieb. Nachdem keines seiner Familienmitglieder ihm beim Sterben helfen wollte, überzeugte er 1998, also mehr als 30 Jahre nach seinem Unfall, eine Freundin, ihm ein Glas mit Zyankali bereitzustellen. Dies trank er mit einem Strohhalm leer und starb kurz darauf. Sein Fall erregte in ganz Spanien Aufsehen und entflammte eine hitzige Debatte über das Thema Sterbehilfe.2
Im ersten Teil dieser Arbeit soll nun fachwissenschaftlich analysiert werden, wie sich die christlich-evangelische Kirche mit dem Thema auseinandersetzt und inwieweit eine Legalisierung von Sterbehilfe aus ethischer und rechtlicher Sicht vertretbar sein kann. Dazu wird zunächst eine exegetische Reflexion der Bibelstellen durchgeführt, die in der Diskussion immer wieder von den Kirchen benannt werden. Im Folgenden werden, um einen Überblick zu verschaffen, die unterschiedlichen Formen von Sterbehilfe erläutert, wie sie in der öffentlichen Diskussion geläufig sind, sowie deren rechtliche Lage in Deutschland. Damit ein abschließendes Urteil gefällt werden kann, werden im Anschluss zwei christliche Positionen dargestellt, zunächst die der evangelischen Kirche und danach die ethische Konzeption des Theologen Johannes Fischer.
Im zweiten Teil, der fachdidaktischen Analyse, wird dieses Thema im Blick auf seine Unterrichtsumsetzbarkeit untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fachwissenschaftliche Analyse
- Exegetische Reflexion
- Verschiedene Formen von Sterbehilfe und ihre rechtliche Lage
- Ethische Reflexion
- Die Position der Evangelischen Kirche
- Sterbehilfe im Kontext der Ethik von Johannes Fischer
- Fazit eigene Stellungnahme
- Fachdidaktische Analyse
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Thema der Sterbehilfe im Kontext christlicher Ethik. Ziel ist es, die Positionen der evangelischen Kirche und des Theologen Johannes Fischer zu analysieren und die Frage zu beantworten, inwieweit eine Legalisierung von Sterbehilfe aus ethischer und rechtlicher Sicht vertretbar ist.
- Exegetische Reflexion der Bibelstellen zur Sterbehilfe und deren Bedeutung für die ethische Debatte
- Untersuchung verschiedener Formen der Sterbehilfe und deren rechtliche Lage in Deutschland
- Analyse der Position der evangelischen Kirche zur Sterbehilfe
- Behandlung der ethischen Konzeption von Johannes Fischer und deren Relevanz für das Thema Sterbehilfe
- Betrachtung der Unterrichtsumsetzbarkeit des Themas Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt den Leser mit dem Fall Ramon Sampedro in das Thema Sterbehilfe ein und stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit vor.
- Exegetische Reflexion: Dieses Kapitel beleuchtet die biblischen Aussagen zur Ebenbildlichkeit des Menschen und deren Implikationen für die Frage der Sterbehilfe. Ausgehend vom Genesisbuch und dem Dekalog werden die biblischen Argumente gegen eine selbstbestimmte Entscheidung über Leben und Tod erörtert.
- Verschiedene Formen von Sterbehilfe und ihre rechtliche Lage: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen der Sterbehilfe, wie sie in der öffentlichen Diskussion vorkommen, und erklärt deren rechtliche Lage in Deutschland.
- Die Position der Evangelischen Kirche: Dieses Kapitel stellt die Position der Evangelischen Kirche zur Sterbehilfe dar und analysiert deren ethische Argumente.
- Sterbehilfe im Kontext der Ethik von Johannes Fischer: Dieser Abschnitt untersucht die ethische Konzeption des Theologen Johannes Fischer und deren Relevanz für das Thema Sterbehilfe.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, christliche Ethik, Ebenbildlichkeit, Lebensrecht, evangelische Kirche, Johannes Fischer, Exegese, Dekalog, Rechtliche Lage, Unterrichtsumsetzbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie steht die evangelische Kirche zum Thema Sterbehilfe?
Die evangelische Kirche betont die Gottebenbildlichkeit des Menschen und das Lebensrecht, lehnt aktive Sterbehilfe meist ab, befürwortet jedoch eine menschenwürdige Sterbebegleitung.
Welche ethische Position vertritt Johannes Fischer?
Die Arbeit analysiert Fischers spezifische ethische Konzeption und wie er die Autonomie des Sterbenden im Verhältnis zur christlichen Verantwortung gewichtet.
Welche Formen der Sterbehilfe werden unterschieden?
Es wird zwischen aktiver, passiver, indirekter Sterbehilfe sowie dem assistierten Suizid unterschieden, jeweils unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage in Deutschland.
Welche Rolle spielt der Fall Ramon Sampedro in der Arbeit?
Der Fall des gelähmten Spaniers dient als Einleitung, um die ethische und emotionale Komplexität des Wunsches nach einem selbstbestimmten Tod zu verdeutlichen.
Wie lässt sich das Thema Sterbehilfe im Unterricht umsetzen?
Die fachdidaktische Analyse untersucht Möglichkeiten, wie Schüler die verschiedenen ethischen und rechtlichen Perspektiven reflektieren und eine eigene Urteilskompetenz entwickeln können.
- Citar trabajo
- Steffen Schütze (Autor), 2012, Entscheidung über Leben und Tod - Sterbehilfe im Kontext christlicher Ethik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195045