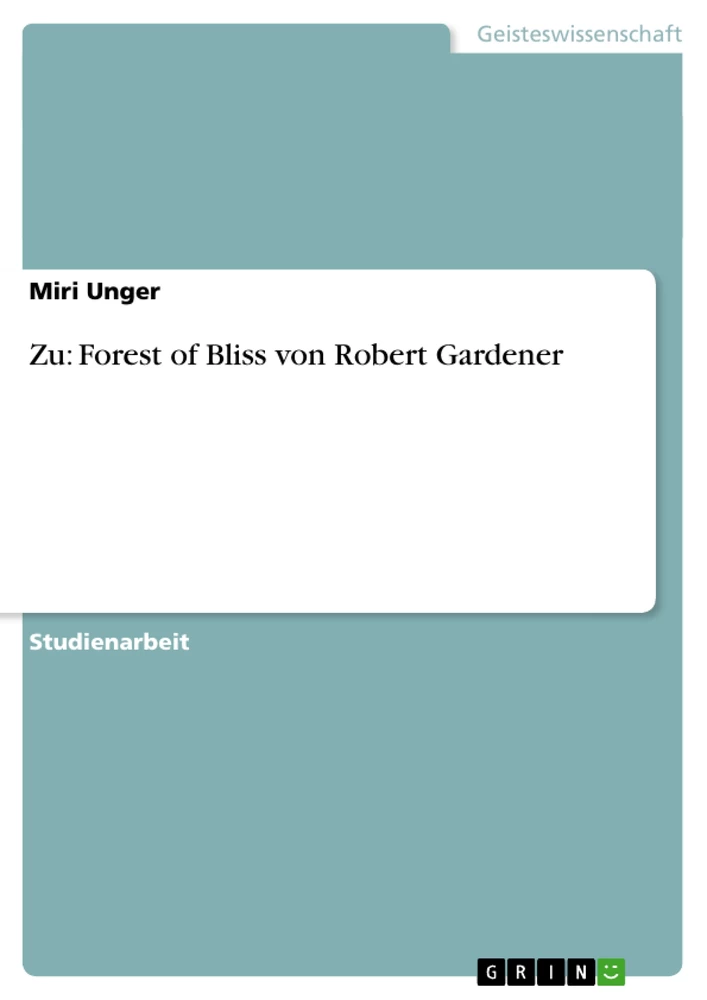Der Film, Forest of Bliss, von Robert Gardener zeigt einen Tag in Benares. Von einem
Sonnenaufgang zum nächsten Sonnenaufgang wird das Leben, in einer der heiligsten
Städte Indiens, gezeigt. Über die kompletten 90 Minuten hinweg kommt der Film ohne
Kommentare, Untertitel oder Dialog aus. Es werden religiöse Rituale präsentiert und
das Thema Tod hat eine zentrale Rolle, auf die ich im Folgenden näher eingehen
werde.
Inhalt
1. Einleitung
2. Benares
3. Tod im Hinduismus
3.1. Darstellung im Film
3.1.1. Fressen und gefressen werden
3.1.2. Fressen und gefressen werden (metaphorisch)
3.2. Vorgang der Transformation
3.3. Totenritus
4. Schluss
5. Literatur
1. Einleitung
Der Film, Forest of Bliss, von Robert Gardener zeigt einen Tag in Benares. Von einem Sonnenaufgang zum nächsten Sonnenaufgang wird das Leben, in einer der heiligsten Städte Indiens, gezeigt. Über die kompletten 90 Minuten hinweg kommt der Film ohne Kommentare, Untertitel oder Dialog aus. Es werden religiöse Rituale präsentiert und das Thema Tod hat eine zentrale Rolle, auf die ich im Folgenden näher eingehen werde.
2. Benares
Benares, unter vielen anderen Namen auch Varansi genannt, liegt am Ganges. Die Stadt ist keine typische Metropole, so wie wir sie kennen. Mit ihren ungefähr 1,4 Millionen Einwohnern nimmt sie einen hohen Stellenwert als ein religiöses Zentrum Indiens ein. Sie ist eine der sieben heiligen Städte der Hindus (Sachs 2008: 5). Die anderen sechs sind: Ayodhya, Mathura, Maya, Kanci, Avantika und Dvarka. Der Schutzherr der Stadt ist Gott Shiva. Verschiedene Puranas, eine spezielle Textgruppe von Mythen und Legenden, heben die enge Verbindung von Shiva mit Benares hervor. Mit circa 2000 Tempeln hat die Stadt eine überregionale Bedeutung und ist sehr beliebt bei Pilgern. Hier lassen sich die vier hinduistischen Lebensziele realisieren. Das wären Dharma (religiöse Pflichten), Kama (Genuss), Artha (wirtschaftliche Entwicklung) und Maska (Befreiung bzw. Erlösung). Gerade die Befreiung und die Erlösung sind im Hinduismus sehr wichtig (Sachs 2008: 5). Dort sterben oder eingeäschert werden, ist erstrebenswert. Von dort kann man direkt in den Kreislauf der Wiedergeburten durchbrechen (Sachs 2008: 6).
3. Tod im Hinduismus
Der Tod ist ein Vorgang der Transformation, welchen ich später noch näher beschreiben werde. Wichtig ist, dass der Sterbende seinen Tod sowohl annimmt als auch auf diesen Tod vorbereitet ist. Es gibt weder Grabsteine noch Gedenkfeiern. Der Totenritus sieht vor, dass der Tote gewaschen, gesalbt und in ein Leichentuch gehüllt wird. Anschließend wird der Tote auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Während dieser Zeremonie darf nicht geweint werden. Der Feuergott Agni wird gebeten, die Seele des Toten zu begleiten (Lexikon Hinduismus: Glaubensinhalte und Spiritualität: Tod und Übergang).
3.1. Darstellung im Film
Der Film fängt mit einem Zitat von W.B. Yeats an: „Everything in this world is eater or eaten. The seed is food and the fire is eater. "
Auf diesen Spruch wird daraufhin immer wieder, manchmal auch metaphorisch, Bezug genommen. Tiere, der Ganges oder andere Dinge treten im Film hierfür in Erscheinung.
3.1.1. Fressen und gefressen werden
Bereits im ersten Drittel des Films wird man mit dem Tod eines alten Menschen konfrontiert (Gardener 1986: 27. Min.), welcher kurze Zeit später abtransportiert wird (Gardener 1986: 35. Min.). Parallel dazu werden das Wiegen und der Transport von Holz gezeigt, welches später für die Verbrennung des Verstorben verwendet wird. Der Tote wird in einem Tuch eingewickelt aus der Wohnung getragen und auf einer Trage festgebunden. Dort wird er mit Blumen geschmückt und ein Ritual beginnt (Gardener 1986: 40./41. Min.). Die Produktion der Trage und die beachtliche Anzahl der gebauten Tragen, als auch ihre Zerstückelung werden im Film dargestellt. Nach dem Ritual wird der Verstorbene durch die ganze Stadt in Richtung Ganges getragen, während das Becken im Innenhof des Hauses des Toten sorgfältig ausgespült wird. Ein anderer Leichnam wird dagegen von einem Boot aus in den Fluss geworfen (Gardener 1986: 45. Min.) und verschwindet somit aus dem Blickfeld, genauso wie die Leiche auf dem Scheiterhaufen (Gardener 1986: 51. und 68. Min.). Das Feuer oder der Fluss „fressen" den toten Körper.
Auch bemerkenswert finde ich wie das Holz mit Tod verknüpft wird. Es ist nicht nur zum wärmen da, sondern eben auch zur Verbrennung der Toten (Gardener 2001: 48). Deutlich wird diese Verbindung, wenn der Transport von Holz gezeigt wird und in der nächsten Szene sieht man einen toten menschlichen Körper im Wasser schwimmen (Gardener 1986: 19. Min.).
3.1.2. Fressen und gefressen werden (metaphorisch)
Zu Beginn des Films wird gleich gezeigt, wie ein Hund von Artgenossen angegriffen wird. Die Hunde tauchen im weiteren Verlauf immer wieder auf. Kurz darauf kaut ein Hund auf einem menschlichen Körper aus dem Fluss (Gardener 1986: 7. Min.), später isst ein anderer Hund einen Kadaver (Gardener 1986: 31. Min.). Erstere, wenn der Hund den Menschen aufisst, soll den stetigen Wechsel der Lebenszyklen darstellen (Gardener 2001: 34). Dies sind nur Beispiele von Hundeszenen, die immer wieder im Film zu finden sind. Für Gardener hat diese erste Szene eine wichtige Bedeutung. Sie zeigt auf der einen Seite das Bild, welches er von Benares hat, und auf der anderen Seite soll es ein Symbol dafür sein, dass die Welt nicht der netteste Ort ist und nicht jeder es schafft zu überleben (Gardener 2001: 22). Allerdings wird auch ein Welpe gezeigt, der mit einer Blume spielt (Gardener 1986: 21. Min.). Diese Szene zeigt, dass es auch schöne Seiten des Hundseins in Benares gibt (Gardener 2001: 53).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Film „Forest of Bliss“?
Der Film von Robert Gardner zeigt einen kompletten Tag in Benares (Indien), von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang, ohne Kommentare oder Dialoge.
Welche Bedeutung hat Benares im Hinduismus?
Benares (Varanasi) ist eine der sieben heiligen Städte der Hindus. Es gilt als erstrebenswert, dort zu sterben, um direkt aus dem Kreislauf der Wiedergeburten befreit zu werden.
Wie wird der Tod im Film dargestellt?
Der Tod wird als allgegenwärtig gezeigt, etwa durch den Transport von Leichen zum Ganges, das Wiegen von Brennholz für Scheiterhaufen und rituelle Waschungen.
Was bedeutet die Metapher „Fressen und gefressen werden“?
Basierend auf einem Zitat von W.B. Yeats zeigt der Film den stetigen Wechsel der Lebenszyklen, symbolisiert durch Hunde, den Fluss Ganges und das Feuer der Verbrennung.
Wie verläuft ein hinduistischer Totenritus?
Der Tote wird gewaschen, gesalbt, in ein Leichentuch gehüllt und auf einem Scheiterhaufen verbrannt, wobei der Feuergott Agni um Begleitung der Seele gebeten wird.
- Citar trabajo
- Miri Unger (Autor), 2012, Zu: Forest of Bliss von Robert Gardener, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195145