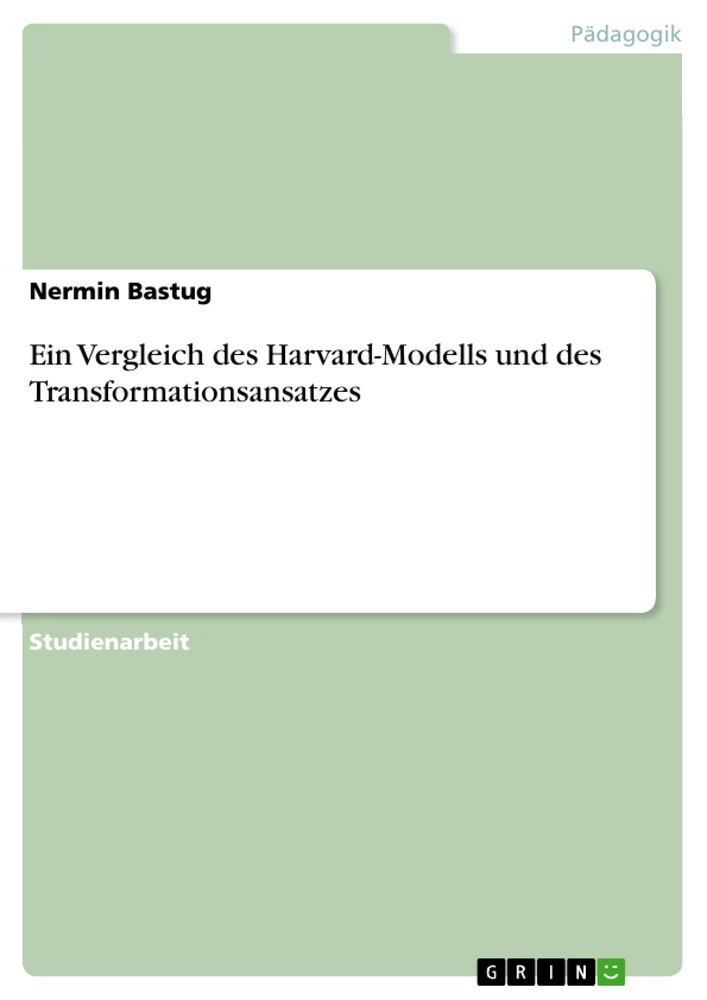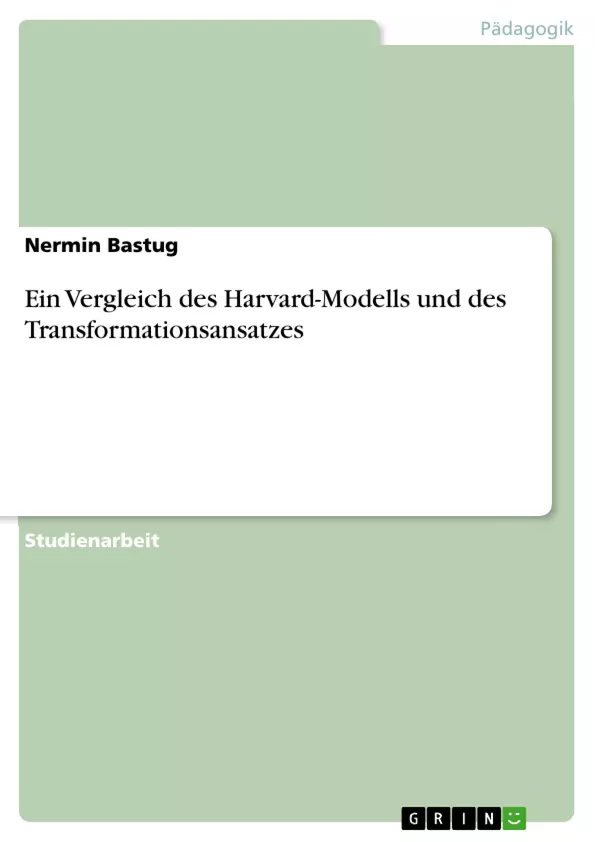Mediation ist ein Verfahren zur Lösung von Konflikten mit Hilfe eines unparteiischen Vermittlers, dem/ der MediatorIn. Die Konfliktparteien sind alle einbezogen und nehmen freiwillig an dem Mediationsverfahren, welches außergerichtlich ist, teil. Entscheidend ist ihre Selbstbestimmung bezüglich der Konfliktlösung. Das Ergebnis wird nicht von dem/der MediatorIn bestimmt und nicht verpflichtend solange die Parteien nicht einstimmig sind.
In der folgenden Hausarbeit werde ich zunächst die wichtigsten Schritte der Mediation darlegen, dann zwei Mediationsverfahren, das Harvard-Konzept und den Transformationsansatz, erklären und miteinander vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mediation
- Wichtige Schritte der Mediation
- Rolle und Aufgaben der MediatorInnen
- Grundlegende Methoden der Mediation
- Anwendbarkeit der Mediation
- Das Harvard-Modell
- Hintergrund
- Harvard-Prinzipien
- Der Transformationsansatz
- Ziele des Transformationsansatzes
- Das Konfliktdreieck
- Methoden des Transformationsansatzes
- Vergleich: Harvard-Modell und Transformationsansatz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das Verfahren der Mediation als Mittel zur Lösung von Konflikten. Die Arbeit untersucht die wichtigsten Schritte des Mediationsprozesses, beleuchtet zwei prominente Mediationsansätze, das Harvard-Konzept und den Transformationsansatz, und vergleicht diese miteinander. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise von Mediation und ihre Anwendbarkeit in verschiedenen Konfliktkontexten zu vermitteln.
- Schritte des Mediationsprozesses
- Die Rolle und Aufgaben der MediatorInnen
- Das Harvard-Konzept als Mediationsansatz
- Der Transformationsansatz als Mediationsansatz
- Vergleich der beiden Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Mediation ein und stellt die wichtigsten Aspekte des Verfahrens dar. Kapitel 2 beleuchtet die verschiedenen Schritte der Mediation, angefangen von der Vorphase bis hin zur Umsetzungsphase. Es werden die jeweiligen Phasen im Detail erläutert und wichtige Aspekte des Mediationsprozesses hervorgehoben. Kapitel 2.2 widmet sich der Rolle und den Aufgaben der MediatorInnen und zeigt, wie sie den Konfliktparteien bei der Lösung des Konflikts unterstützen. Kapitel 2.3 befasst sich mit verschiedenen Methoden der Mediation, wie dem aktiven Zuhören und Brainstorming. In Kapitel 2.4 wird die Anwendbarkeit der Mediation in verschiedenen Kontexten, von persönlichen Konflikten bis hin zu internationalen Krisen, untersucht.
Schlüsselwörter
Mediation, Konfliktlösung, Konfliktmanagement, Harvard-Konzept, Transformationsansatz, MediatorInnen, Mediationsprozess, Vorphase, Mediationsgespräch, Umsetzungsphase, aktive Zuhören, Brainstorming, Anwendbarkeit
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Harvard-Konzept der Mediation?
Das Harvard-Modell ist ein sachbezogener Verhandlungsansatz, der darauf abzielt, Win-Win-Lösungen zu finden, indem Interessen statt Positionen in den Vordergrund gestellt werden.
Wie unterscheidet sich der Transformationsansatz davon?
Der Transformationsansatz konzentriert sich weniger auf die schnelle Lösung eines Sachkonflikts als vielmehr auf die Veränderung der Beziehung zwischen den Parteien und deren gegenseitiges Verständnis.
Welche Rolle hat ein Mediator?
Ein Mediator ist ein unparteiischer Vermittler, der den Prozess strukturiert, aber keine Entscheidungen trifft. Die Lösung des Konflikts liegt in der Selbstbestimmung der Parteien.
Was sind die wichtigsten Phasen einer Mediation?
Der Prozess umfasst üblicherweise eine Vorphase, das Mediationsgespräch (Themensammlung, Interessenklärung) und eine abschließende Umsetzungsphase.
In welchen Bereichen ist Mediation anwendbar?
Mediation kann bei persönlichen Konflikten, in der Wirtschaft, im Arbeitsrecht oder sogar bei internationalen Krisen erfolgreich eingesetzt werden.
- Citar trabajo
- Nermin Bastug (Autor), 2011, Ein Vergleich des Harvard-Modells und des Transformationsansatzes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195173