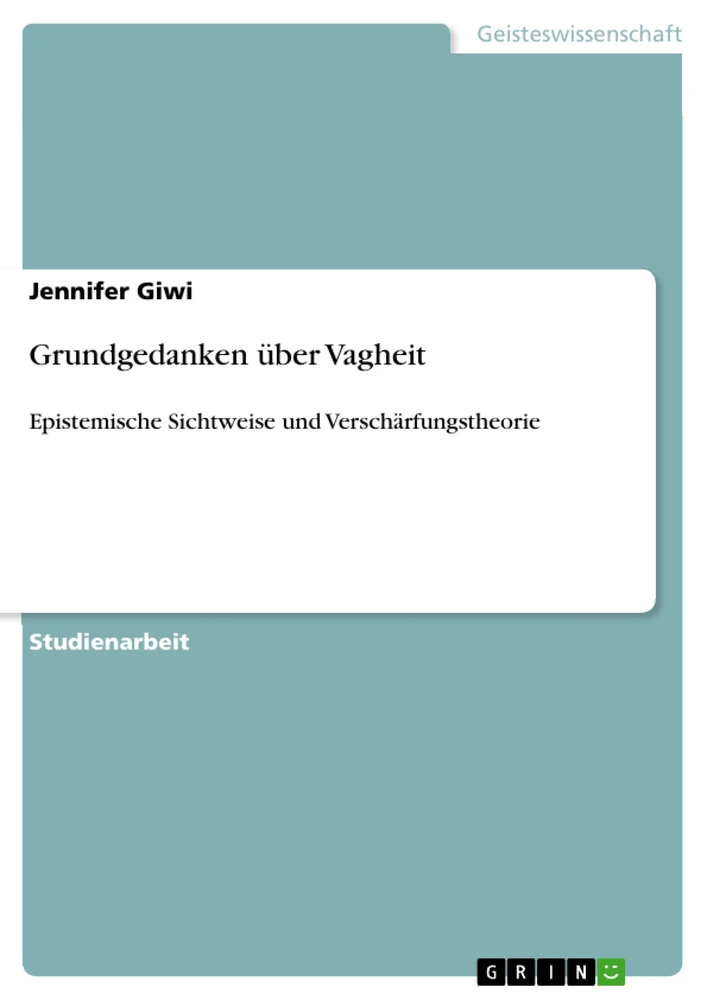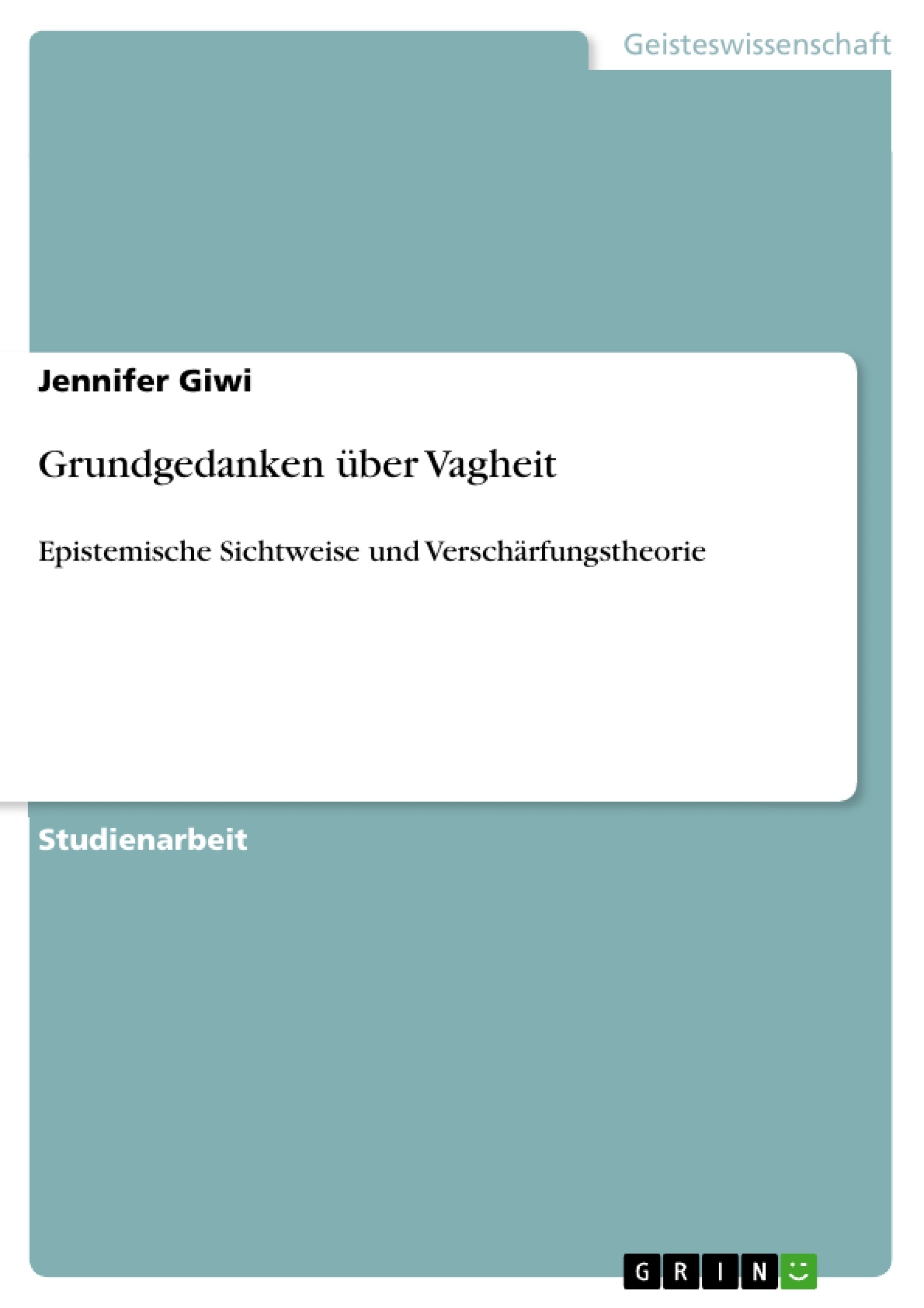„There is wide agreement that a term is vague to the extent that it has borderline cases. This makes the notion of a borderline case crucial in accounts of vagueness.” (Standford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/vagueness/#5). Ein Begriff oder eine Aussage wird demnach als vage bezeichnet, sobald ein Grenzfall vorliegen kann, d.h. es ist nicht möglich, eine scharfe Linie zu ziehen, zwischen dem Fall, auf den die Eigenschaft (des Begriffs, der Aussage) zutrifft, der Extension, und dem Fall, auf den sie nicht zutrifft, der Anti-Extension. Während bei präzisen Begriffen Extension und Anti-Extension scharf aneinander grenzen, scheint es bei vagen Begriffen eine Art Grauzone zu geben: „In Grenzfällen ist es ganz einfach keine Tatsache: Es steht nicht fest, dass der Mann groß ist oder nicht, die Ansammlung ein Haufen ist oder nicht, die Farbe rot ist oder nicht.“ (Sainsbury 2001: 43). Diese Unbestimmtheit von Begrifflichkeiten und Aussagen macht eine Differenzierung hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes im Grunde unmöglich, da sie von der Situation, in der sie zutrifft, eben nicht zu unterscheiden ist von der Situation, in der sie nicht zutrifft. Vagheit darf jedoch nicht mit Mehrdeutigkeit verwechselt werden, mehr dazu jedoch an passender Stelle (s. S. 3).
Nach der „Haufenparadoxie“, die ein klassisches Beispiel der Sorites-Paradoxien ist, – „die griechische Bezeichnung für ,Haufen’ – sorós – hat dazu geführt,
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Begriffs- und Theoriebestimmungen
- I. Theorien von Vagheit
- 1. Die epistemische Theorie von Vagheit
- a. Was ist Vagheit?
- b. Ablehnen der Prämissen
- c. Vagheit ist Unwissenheit
- 2. Verschärfungstheorie
- a. Superwahrheit
- b. Satz vom ausgeschlossenen Dritten
- B. Epistemische Theorie versus Verschärfungstheorie
- I. Superwahrheit und Verschärfungstheorie
- 1. Wahrheitswerte und -bedingungen
- a. Unbekannter Dritter
- b. Grenzlinie und Schärfungen
- c. Vagheit höherer Ordnung
- II. Übereinstimmungen und Unstimmigkeiten
- C. Ergebnisse und Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Problem der Vagheit in der Sprache und stellt zwei gegensätzliche Theorien zur Lösung dieses Problems gegenüber: die epistemische Theorie und die Verschärfungstheorie. Die Zielsetzung ist es, die zentralen Argumente beider Theorien zu präsentieren und ihre Stärken und Schwächen zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Konzepte der Vagheit, des Grenzfalls und der Präzision in Bezug auf die beiden Theorien.
- Begriffsbestimmung von Vagheit und deren Paradoxien
- Gegenüberstellung der epistemischen Theorie und der Verschärfungstheorie
- Analyse der Konzepte von Grenzfällen und Präzision
- Untersuchung des Wahrheitswertes vager Aussagen
- Bewertung der beiden Theorien im Hinblick auf ihre Erklärungskraft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Vagheit ein und präsentiert das Problem anhand der Haufenparadoxie. Sie erläutert den Unterschied zwischen Vagheit und Mehrdeutigkeit und kündigt die beiden im Folgenden zu behandelnden Theorien – die epistemische Theorie und die Verschärfungstheorie – an. Die Einleitung betont die Bedeutung der sprachlichen Verwendung und die Schwierigkeit, die Semantik vager Begriffe präzise zu bestimmen, in Anlehnung an Wittgenstein. Der Bezug auf die Haufenparadoxie dient als anschauliches Beispiel für die Herausforderungen, die mit der Vagheit verbunden sind.
A. Begriffs- und Theoriebestimmungen: Dieser Abschnitt dient der Klärung grundlegender Begriffe und der Einführung der beiden Theorien. Er legt den Fokus auf die Definition von Vagheit und beschreibt die epistemische Logik als Grundlage der epistemischen Theorie. Der Abschnitt bereitet den Leser auf die detailliertere Betrachtung der Theorien in den folgenden Kapiteln vor. Er liefert ein notwendiges Fundament für das Verständnis der Argumentationen in den nachfolgenden Kapiteln.
I. Theorien von Vagheit: Dieses Kapitel stellt die beiden Haupttheorien zur Erklärung von Vagheit vor: die epistemische Theorie und die Verschärfungstheorie. Es werden jeweils die zentralen Annahmen und Argumentationslinien skizziert, um den Vergleich und die spätere Gegenüberstellung zu ermöglichen. Der Abschnitt dient als systematische Einführung in die beiden konkurrierenden Ansätze zur Behandlung des Problems der Vagheit.
B. Epistemische Theorie versus Verschärfungstheorie: In diesem Kapitel werden die epistemische Theorie und die Verschärfungstheorie systematisch miteinander verglichen und kontrastiert. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze werden analysiert, um die jeweiligen Stärken und Schwächen hervorzuheben. Der Fokus liegt auf einer detaillierten Gegenüberstellung der beiden theoretischen Positionen zur Vagheit.
Schlüsselwörter
Vagheit, Epistemische Theorie, Verschärfungstheorie, Grenzfälle, Präzision, Wahrheitswert, Haufenparadoxie, Semantik, Aussagenlogik, Wissen, Glauben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Theorien von Vagheit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Problem der Vagheit in der Sprache und vergleicht zwei gegensätzliche Theorien, die versuchen, dieses Problem zu lösen: die epistemische Theorie und die Verschärfungstheorie. Sie untersucht die zentralen Argumente beider Theorien, ihre Stärken und Schwächen und analysiert Konzepte wie Vagheit, Grenzfälle und Präzision im Kontext dieser Theorien.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die epistemische Theorie und die Verschärfungstheorie der Vagheit. Die epistemische Theorie betrachtet Vagheit als ein Problem des Wissens oder der Unwissenheit, während die Verschärfungstheorie argumentiert, dass vage Aussagen durch "Verschärfung" präzisiert werden können.
Welche zentralen Konzepte werden behandelt?
Zentrale Konzepte sind Vagheit, Grenzfälle (z.B. im Zusammenhang mit der Haufenparadoxie), Präzision, Wahrheitswerte vager Aussagen, Superwahrheit (im Kontext der Verschärfungstheorie) und der Satz vom ausgeschlossenen Dritten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Problem der Vagheit einführt. Es folgt ein Abschnitt zur Begriffsbestimmung und der Vorstellung der beiden Theorien. Ein weiterer Abschnitt vergleicht und kontrastiert die Theorien detailliert. Schließlich gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die zentralen Argumente der epistemischen und der Verschärfungstheorie zu präsentieren und ihre Stärken und Schwächen zu beleuchten. Die Arbeit soll ein umfassendes Verständnis des Problems der Vagheit und der verschiedenen Ansätze zu seiner Lösung bieten.
Welche Rolle spielt die Haufenparadoxie?
Die Haufenparadoxie dient als ein anschauliches Beispiel für das Problem der Vagheit und wird in der Einleitung verwendet, um die Herausforderungen zu veranschaulichen, die mit der Definition und der Behandlung von Vagheit verbunden sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vagheit, Epistemische Theorie, Verschärfungstheorie, Grenzfälle, Präzision, Wahrheitswert, Haufenparadoxie, Semantik, Aussagenlogik, Wissen, Glauben.
Wie werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Theorien herausgearbeitet?
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der epistemischen und der Verschärfungstheorie werden in einem eigenen Kapitel systematisch verglichen und kontrastiert. Der Fokus liegt auf einer detaillierten Gegenüberstellung, um die jeweiligen Stärken und Schwächen hervorzuheben.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht keine expliziten Schlussfolgerungen, sondern präsentiert eine detaillierte Analyse und einen Vergleich der beiden Theorien, um dem Leser ein umfassendes Verständnis des Themas zu ermöglichen und ihm die selbstständige Bewertung der jeweiligen Stärken und Schwächen zu ermöglichen.
- Citation du texte
- Jennifer Giwi (Auteur), 2007, Grundgedanken über Vagheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195211