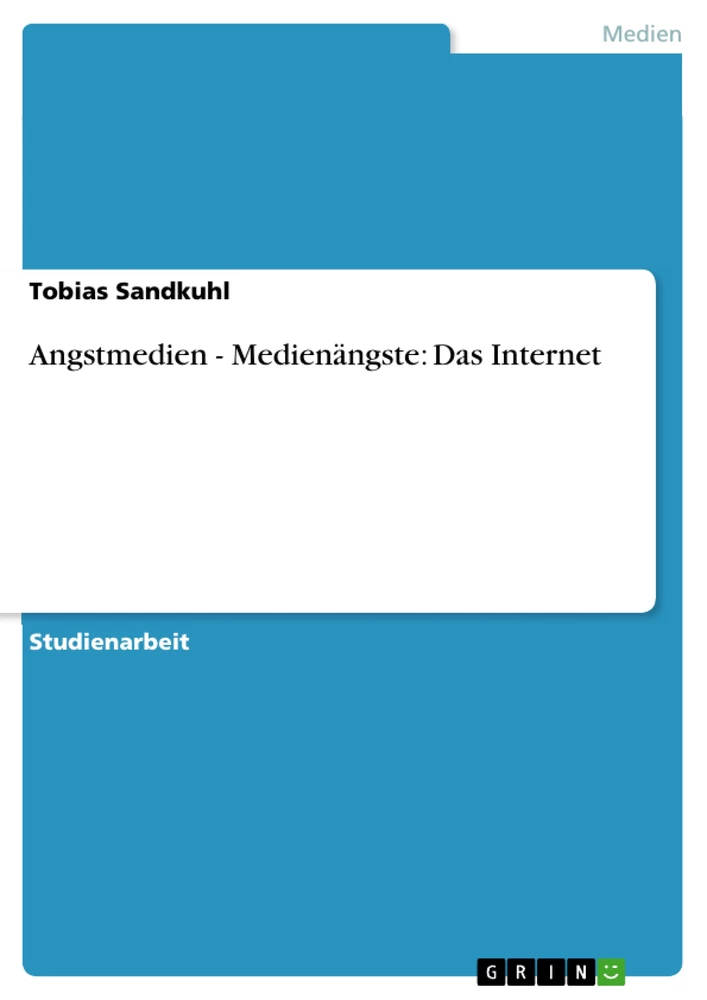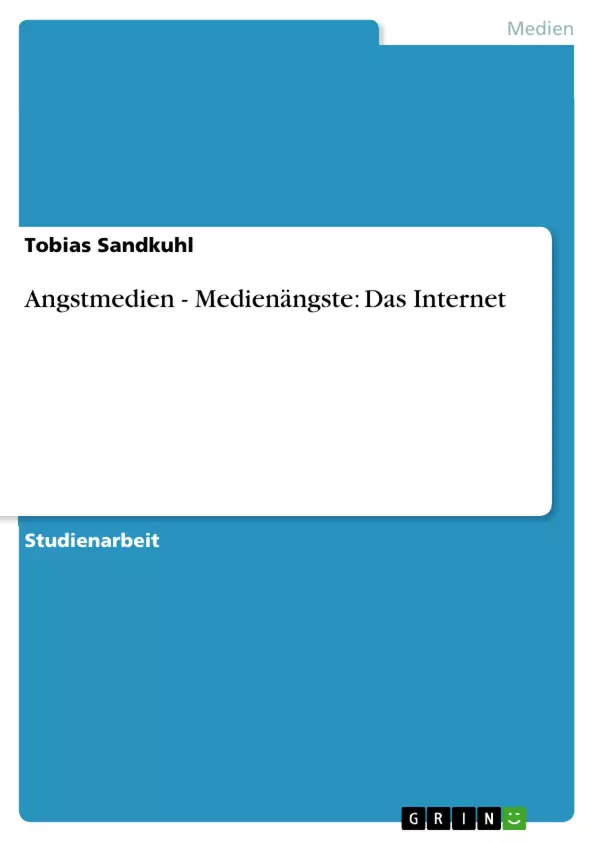Das Internet gehört zu den jüngeren Medien. Es hat sich in den letzten zehn Jahren etabliert und zu einem Massenmedium entwickelt. Im Jahr 2003 nutzten allein in Deutschland ca. 45,3 Millionen Menschen das Internet. Innerhalb Europas ist das die größte Online-Community (vgl. Graumann 2004: 172f.).
Neben der technischen Entwicklung der Hardware hat vor allem die Vereinfachung der Zugangssoftware zu dieser Entwicklung beigetragen. Um das Internet nutzen zu können werden ein Computer, ein Zugang (Telefonanschluß) und die Zugangssoftware (Browser) benötigt. Diese stellt die Verbindung zum Internet her. Sind die Hardwarevoraussetzungen erfüllt, genügt ein Klick auf das Browsericon und schon ist man als User online (sofern keine technischen Schwierigkeiten auftreten). Der Zugang ist somit relativ leicht und immer mehr Menschen gehören zur Community der Internetnutzer. Je mehr sich diese Gemeinschaft verbreitet, desto häufiger rückt das Internet in den Fokus der Öffentlichkeit. Je mehr das Thema Internet von öffentlichem Interesse ist, umso mehr finden sich kritische Meinungen, die sich auf die vermeintlich negativen Seiten des Massenmediums konzentrieren. Die erhobenen Vorwürfe sind vielfältig und richten sich sowohl gegen die Anbieter von Internetdiensten, als auch gegen das Medium selbst und seine Nutzer.
Den Verantwortlichen von Providerdiensten wurde vorgehalten, sie würden rücksichtslos ihre persönlichen Interessen verfolgen, ohne dabei auf das Wohl ihrer Kunden zu achten (s. Kap. 4). Dem Medium Internet haben Kritiker vorgeworfen, dass es süchtig mache und gefährlicher als das Fernsehen sei. Es kreiert angeblich eine verführerische virtuelle Umgebung, die den Internetbenutzer von der realen Welt entfernt und so seine sozialen Beziehungen zerstört (s. Kap. 5 & 6). Ebenfalls soll es durch Internetnutzung zu Gedächtnisstörungen und einer nicht mehr zu kontrollierenden Informationsüberlastung kommen. Dieser sind die User hilflos ausgesetzt und können sich nicht dagegen wehren. Letztendlich wird das Internet auch gegenüber älteren Medien abgewertet (s. Kap. 7). Diese Kritiken muss man sicherlich differenziert sehen, denn hier werden Extremfälle genannt oder Gefahren heraufbeschworen, die wissenschaftlich nicht oder nur in relativ geringer Anzahl nachweisbar sind.
Im Folgenden werde ich mich daher mit der Kritik am Internet auseinandersetzen. Die unterschiedlichen Positionen werden vorgestellt und in einen wissenschaftlichen Kontext gebracht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Historischer Hintergrund – Ein Medium entwickelt sich
3. Zur Begrifflichkeit – real oder nicht real?
4. Der Fall Felix Somm oder der Internet – Urknall in Deutschland
4. 1 Hintergrund
4.2 Das Urteil
5. Soziale Beziehungen im Internet
5.1 Künstliche Sozialräume
5.2 Gute soziale Beziehungen vs. schlechte soziale Beziehungen
5.2.1 Kommunikation im Internet
5.2.2 Soziale Beziehungen im Medienkontext
5.2.3 Soziale Netzwerke und das Internet
6. Internetsucht
6.1 Die große Sucht
6.2 Suchtverhalten und Auswirkungen
6.2.1 Internationale Auswirkungen
6.3 Offene Fragen
7. Internet und Kulturpessimismus
7.1 Macht das Internet dumm?
7.2 Macht das Internet krank?
7.3 Alt vs. Neu
8. Fazit
9. Literatur
1. Einleitung
Das Internet gehört zu den jüngeren Medien. Es hat sich in den letzten zehn Jahren etabliert und zu einem Massenmedium entwickelt. Im Jahr 2003 nutzten allein in Deutschland ca. 45,3 Millionen Menschen das Internet. Innerhalb Europas ist das die größte Online-Community (vgl. Graumann 2004: 172f.).
Neben der technischen Entwicklung der Hardware hat vor allem die Vereinfachung der Zugangssoftware zu dieser Entwicklung beigetragen. Um das Internet nutzen zu können werden ein Computer, ein Zugang (Telefonanschluß) und die Zugangssoftware (Browser) benötigt. Diese stellt die Verbindung zum Internet her. Sind die Hardwarevoraussetzungen erfüllt, genügt ein Klick auf das Browsericon und schon ist man als User online (sofern keine technischen Schwierigkeiten auftreten). Der Zugang ist somit relativ leicht und immer mehr Menschen gehören zur Community der Internetnutzer. Je mehr sich diese Gemeinschaft verbreitet, desto häufiger rückt das Internet in den Fokus der Öffentlichkeit. Je mehr das Thema Internet von öffentlichem Interesse ist, umso mehr finden sich kritische Meinungen, die sich auf die vermeintlich negativen Seiten des Massenmediums konzentrieren. Die erhobenen Vorwürfe sind vielfältig und richten sich sowohl gegen die Anbieter von Internetdiensten, als auch gegen das Medium selbst und seine Nutzer.
Den Verantwortlichen von Providerdiensten wurde vorgehalten, sie würden rücksichtslos ihre persönlichen Interessen verfolgen, ohne dabei auf das Wohl ihrer Kunden zu achten (s. Kap. 4). Dem Medium Internet haben Kritiker vorgeworfen, dass es süchtig mache und gefährlicher als das Fernsehen sei. Es kreiert angeblich eine verführerische virtuelle Umgebung, die den Internetbenutzer von der realen Welt entfernt und so seine sozialen Beziehungen zerstört (s. Kap. 5 & 6). Ebenfalls soll es durch Internetnutzung zu Gedächtnisstörungen und einer nicht mehr zu kontrollierenden Informationsüberlastung kommen. Dieser sind die User hilflos ausgesetzt und können sich nicht dagegen wehren. Letztendlich wird das Internet auch gegenüber älteren Medien abgewertet (s. Kap. 7). Diese Kritiken muss man sicherlich differenziert sehen, denn hier werden Extremfälle genannt oder Gefahren heraufbeschworen, die wissenschaftlich nicht oder nur in relativ geringer Anzahl nachweisbar sind.
Im Folgenden werde ich mich daher mit der Kritik am Internet auseinandersetzen. Die unterschiedlichen Positionen werden vorgestellt und in einen wissenschaftlichen Kontext gebracht.
2. Historischer Hintergrund – Ein Medium entwickelt sich
Als Vorläufer des heutigen Internet gilt das Ende der 60’er Jahre in den USA entwickelte ARPANET. Es wurde von der Forschungsbehörde ‚Advanced Research Projects Agency’ (ARPA) entwickelt. Datentransfer war damals nur zwischen Computern gleichen Typs und Herstellers möglich, dazu war ein aufwändiger Austausch von physikalischen Datenträgern, wie z.B. Lochkarten und Magnetbändern, notwendig (vgl. Niesing 2000: 8).
Dieser Aufwand beschränkte allerdings die Nutzbarkeit des Netzwerkes. Erst als Baran 1964 einige ‚Packetorientierte Netzwerkprotokolle’ entwickelte, die für mehr Stabilität der Netzwerke und weniger Aufwand beim Austausch von Daten sorgten, wurde das ARPANET salonfähig (vgl. Niesing 2000: 9).
Zunächst wurden ARPA – Forschungszentren miteinander verbunden, 1969 folgten universitäre Computerzentren und im Jahr 1975 waren in den USA immerhin schon 30 Computerzentren miteinander vernetzt. Erste Anwendungsprogramme des ARPANETS waren ein Programm zur Fernsteuerung fremder Rechner (telecommunications network: ‚Telnet’), ein Programm für den Austausch von Daten zwischen Computern (file transfer protocol: ‚FTP’) und ab 1971 die Möglichkeit, elektronische Post (E-Mail) zu schicken (vgl. Niesing 2000: 10).
Eine weitere Vereinfachung der Vernetzung von Rechnern erreichten 1980 Cerf und Kahn, die das bis heute existierende TCP/IP Protokoll entwickelten. Noch entscheidender für die Verbreitung des Internets war der 1991 aufkommende Dienst WWW (World Wide Web). Er wurde von Tim Berness – Lee entwickelt, der ein Hypertextsystem mit einfacher Benutzeroberfläche wollte, mit dem Dokumente im Internet einfach zugänglich gemacht werden können. Zur Verbreitung des Internets trägt natürlich auch die technische Entwicklung der Datenübertragung bei, so waren im ARPANET lediglich Übertragungen von 56.000 Bit pro Sekunde praktikabel (vgl. Niesing 2000: 11f.). Heute sind digitale Internetleitungen deutlich schneller. In Deutschland hatten 2003 ca. 53,5 % der Gesamtbevölkerung (das sind etwa 34,4 Millionen Menschen) einen Zugang zum Internet, die Tendenz ist steigend (vgl. Eimeren 2003: 338f.).
3. Zur Begrifflichkeit – real oder nicht real?
Beim Lesen von Texten über das Internet fällt auf, dass i.d.R. eine ganz bestimmte Begrifflichkeit verwendet wird. Das ‚wirkliche’ Leben, die Realität, wird dem Internet und dessen Inhalten entgegen gestellt. Es entsteht oft der Eindruck, die Inhalte des Internets wären nicht real, sondern würden sich außerhalb unserer Realität befinden. So findet man in der Literatur sehr häufig die Polarisierung von Begriffen wie z.B. ’Real life’ vs. ‘Virtual life’ oder ‘Face to Face’ vs. ‘Cyberspace’. Wobei ’Real life’ und ’Face to Face’ für Situationen des richtigen Lebens stehen, während ’Virtual life’ und ’Cyberspace’ für Situationen und Begegnungen im Internet stehen. Die Internetnutzung wirkt durch solche Begriffe weniger real, als die Nutzung anderer Medien oder sonstiger Kontaktformen. Der Begriff ‘Cyberspace’ z.B. stammt aus der Science Fiction Literatur (vgl. Gräf 1997: 100f.).
Der Autor William Gibson nutzt ihn in seinem Roman „Neuromancer“ (1984), um eine von Computern generierte parallele Welt zu bezeichnen (vgl. Döring 2003: 48). Derartige Begriffe ‚entwirklichen’ das Internet und implizieren sehr utopische Vorstellungen von dieser Technologie.
Um derartige Assoziationen zu vermeiden, soll in dieser Arbeit von ‚offline Situationen’ die Rede sein, wenn von Begebenheiten des ‚Real life’ geschrieben wird, und von ‚online Situationen’, wenn die Nutzung des Internets gemeint ist. Diese Begriffe bilden zwar ebenfalls ein Gegensatzpaar, das nicht ganz geeignet ist, um eine Begriffssynergie zwischen Internet und ‚normaler’ Welt herzustellen, sollen hier aber von dieser Problematik befreit genutzt werden.
4. Der Fall Felix Somm oder der Internet – Urknall in Deutschland
Zwischen 1995 und 1998 sorgte der Schauprozess um Felix Somm, damaliger Geschäftsführer der Compuserve GmbH Deutschland, für großes internationales Aufsehen. Als Ergebnis dieses Prozesses wurde Herr Somm zu zwei Jahren Bewährungsstrafe und zur Zahlung von 100.000 DM verurteilt. Die Begründung dieses überraschenden Urteils lautete, er sei der Mittäterschaft bei der Verbreitung von Kinder- und Tierpornographie für schuldig befunden worden.
Dieses Urteil löste Befürchtungen aus, dass die Entwicklung des Internets nachhaltig geschädigt werden würde. Ein derartiger Präzedenzfall könnte Firmen abschrecken, in diese junge Branche einzusteigen bzw. zu investieren (vgl. Krempl 1998: 1f.).
4. 1 Hintergrund
In den Datenbanken der amerikanischen Mutterfirma von Compuserve Deutschland, Compuserve Inc., sind 1995 etwa 280 Newsgroups mit teilweise strafrechtlich relevanten Inhalten aufgetaucht (vgl. Moritz 1998: 1). Diese Inhalte waren auch den deutschen Nutzern der Dienste der Firma Compuserve zugänglich. Als das bekannt wurde, ist Herr Somm von der bayrischen Polizei festgenommen worden. In der folgenden Anklage warf man ihm vor, er habe von diesen Inhalten gewusst und trotzdem nicht für die Sperrung der entsprechenden Inhalte gesorgt (vgl. Krempl 1998: 2).
Während des Prozesses sagten mehrere Rechtsexperten, die vom Gericht als Sachverständige geladen worden waren, aus, dass nach dem deutschen Teledienstgesetz (TDG) eine Verurteilung von Felix Somm rechtlich nicht haltbar sei (vgl. Ihlenfeld 1999: 1). Das TDG besagt, dass „Dienstanbieter für fremde Inhalte, zu denen sie lediglich den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich“ (Moritz 1998: 1) sind. Compuserve Deutschland hat als Dienstanbieter nichts anderes getan, als die Zugänge zum Netz der amerikanischen Compuserve Inc. bereitzustellen. Dies wurde allerdings vom Gericht nicht anerkannt. Ebenfalls weigerte sich das Gericht, 19 Beweisanträge der Verteidigung anzuerkennen, die zum Ziel hatten darzustellen, dass die Vorwürfe gegen Herrn Somm haltlos sind (vgl. Moritz 1998: 5).
Erst der Sachverständige Kai Fuhrberg wurde vom Gericht angehört und legte dar, dass es Compuserve 1995 in Deutschland unmöglich war, die etwa 280 Newsgroups mit strafbaren Inhalten vollständig aus dem mehrere tausend Newsgroups umfassenden Dienst zu entfernen. Dieser Erklärung schloss sich sogar der Staatsanwalt Franz v. Hunoltstein an und plädierte daraufhin auf Freispruch für Herrn Somm (vgl. Krempl 1998: 2).
4.2 Das Urteil
Dem Prozessverlauf nach erwarteten Rechtsexperten einen Freispruch für Felix Somm. Stattdessen wurde er vom Richter für schuldig befunden:
„Amtsrichter Wilhelm Hubbert [...] fand Somm [...] schuldig, [...] harte Kinder-, Tier- und Gewaltpornografie `bis ins letzte Kinderzimmer` zugänglich gemacht zu haben. Dahinter vermutet der Richter reines Profit- und Profilierungsstreben im `Kampf um Kunden und Marktanteile`, während gleichzeitig der Jugendschutz vernachlässigt worden sei“ (Krempl 1998: 2).
Dies ist ein typisches Beispiel für die Defizitthese. Amtsrichter Hubbert war offensichtlich nicht mit dem neuen Medium vertraut. Er war für die Argumente der Verteidigung nicht offen und hat auch die Aussagen der Experten nicht berücksichtigt. Für ihn war klar, dass Herr Somm bewusst und nur aus persönlicher Gewinnsucht gehandelt hat. Er unterstellte ihm charakterliche Mängel und schwere moralische Defizite.
Der Richter hat somit seine persönlichen Vorurteile gegenüber dem Internet und den Verantwortlichen der Branche über die objektiven Ergebnisse des Prozesses gestellt. Selbstverständlich war das nicht rechtmäßig und die Verteidigung legte gegen dieses Urteil Einspruch ein. Es kam knapp ein Jahr später zu einem Revisionsverfahren und 1999 wurde Felix Somm vom Münchener Landgericht endgültig freigesprochen (vgl. Ihlenfeld 1999: 1).
5. Soziale Beziehungen im Internet
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die ein Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schwerpunktthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es setzt sich kritisch mit dem Thema Internet auseinander und stellt verschiedene Positionen vor, die in einen wissenschaftlichen Kontext gebracht werden.
Was sind die Hauptthemen, die in diesem Dokument behandelt werden?
Die Hauptthemen sind: Einführung ins Internet, historischer Hintergrund, Begrifflichkeiten (real vs. nicht real), der Fall Felix Somm (Internet-Urknall in Deutschland), soziale Beziehungen im Internet, Internetsucht und Kulturpessimismus im Bezug auf das Internet.
Was war der Fall Felix Somm und warum war er bedeutsam?
Felix Somm war der Geschäftsführer von Compuserve Deutschland. Er wurde wegen Mittäterschaft bei der Verbreitung von Kinder- und Tierpornographie verurteilt, da diese Inhalte über die Newsgroups der amerikanischen Mutterfirma zugänglich waren. Der Fall erregte großes Aufsehen, weil er die Frage aufwarf, inwieweit Internetprovider für die Inhalte verantwortlich sind, die über ihre Dienste verbreitet werden. Das Urteil wurde später revidiert.
Welche Kritik wird am Internet geäußert?
Die Kritik am Internet umfasst Vorwürfe der Suchtgefahr, der Zerstörung sozialer Beziehungen, der Gedächtnisstörungen, der Informationsüberlastung und der Abwertung älterer Medien.
Wie wird das Internet im Vergleich zur "Realität" dargestellt?
Oft wird das Internet als etwas "Nicht-Reales" dargestellt, im Gegensatz zum "wirklichen" Leben. Begriffe wie "Real life" vs. "Virtual life" oder "Face to Face" vs. "Cyberspace" werden verwendet, um die Unterschiede hervorzuheben.
Was sind die historischen Wurzeln des Internets?
Das Internet hat seine Wurzeln im ARPANET, einem Netzwerk, das Ende der 60er Jahre in den USA entwickelt wurde. Es ermöglichte den Datentransfer zwischen Computern verschiedener Hersteller. Die Entwicklung des TCP/IP-Protokolls und des World Wide Web (WWW) trugen wesentlich zur Verbreitung des Internets bei.
Welche Auswirkungen hat die Internetnutzung auf soziale Beziehungen?
Viele Wissenschaftler und Forscher beschäftigten sich mit den Auswirkungen der vermehrten Internetnutzung auf Menschen und deren soziales Umfeld. Dabei wurde kritisch betrachtet, ob das Internet positive oder negative Folgen für die sozialen Beziehungen hat.
Was wird unter "Internetsucht" verstanden und welche Auswirkungen hat sie?
Unter "Internetsucht" wird ein zwanghaftes und exzessives Nutzungsverhalten des Internets verstanden, das negative Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben kann. Die Auswirkungen können international unterschiedlich sein.
Was bedeutet "Kulturpessimismus" im Bezug auf das Internet?
Der Begriff "Kulturpessimismus" bezieht sich auf die kritische Sichtweise, dass das Internet negative Auswirkungen auf die Kultur und die Gesellschaft hat. Kritiker befürchten, dass das Internet die Menschen dumm und krank macht und ältere Medien abwertet.
- Citation du texte
- Tobias Sandkuhl (Auteur), 2004, Angstmedien - Medienängste: Das Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195215