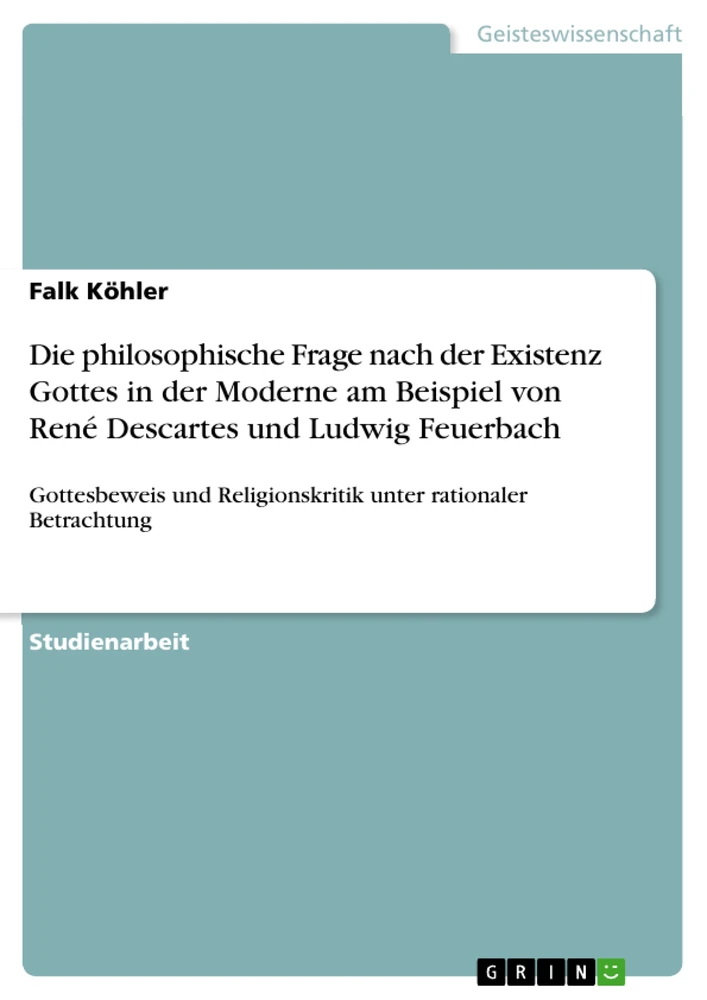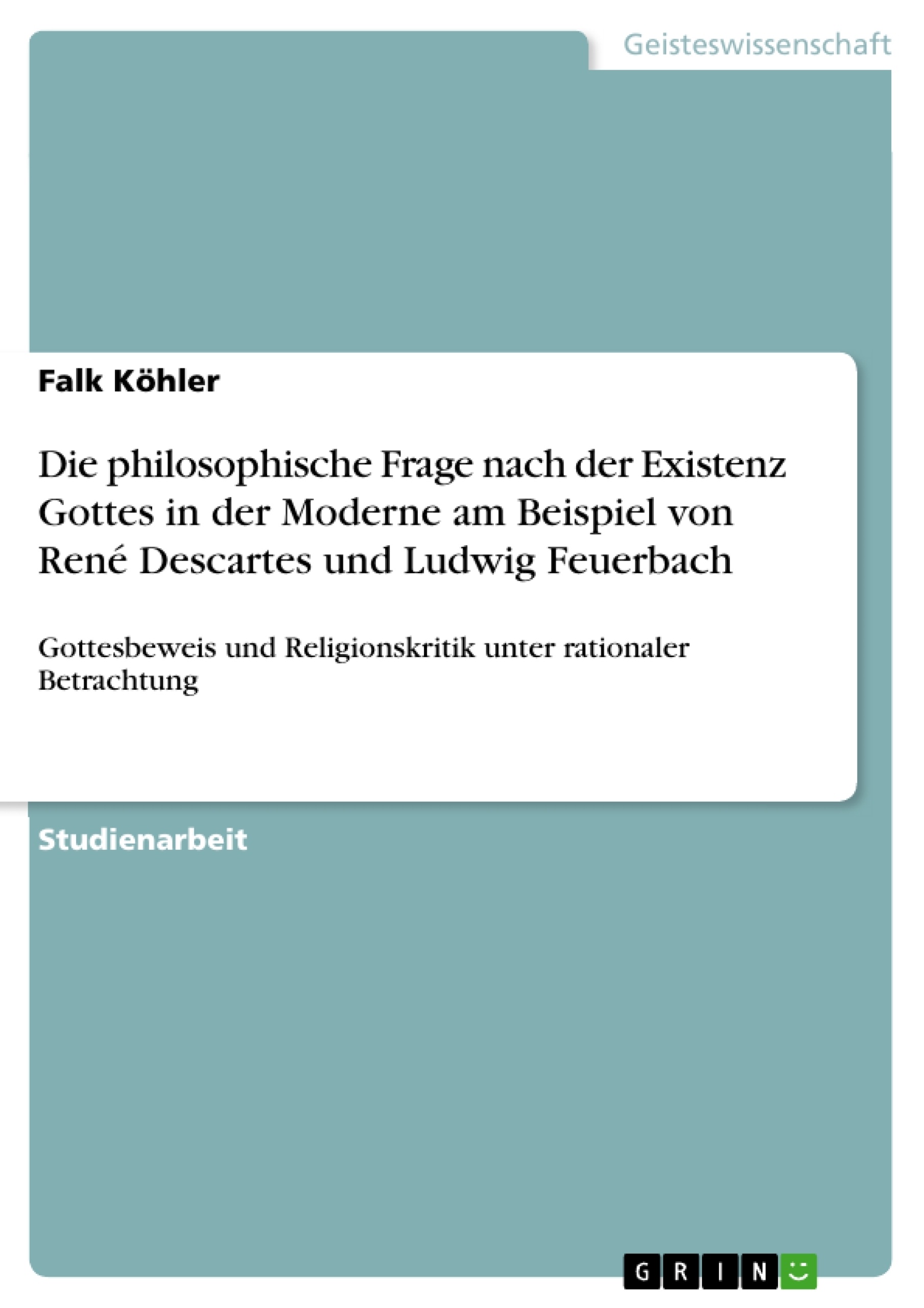In unserer modernen Gesellschaft spielt die Frage nach Gott und der Religion eine wichtige Rolle und ist Teil einer breiten Debatte. Diese daraus entstehende Spaltung der Meinungen, teils durch Desinteresse an der Religion, teils durch eventuelle Angst vor einer solch mächtigen Institution wie der Kirche, wird im direkten Vergleich der Angaben der Religionszugehörigkeiten in Deutschland deutlich. Zu dieser Thematik ist das statistische Bundesamt zu folgenden Ergebnissen gelangt: Im Jahr 1970 war die Zahl der katholisch bzw. evangelisch gläubigen Menschen zwölf- bis dreizehnmal so hoch, wie die der Konfessionsfreien. Vierzig Jahre später, im Jahr 2010 wird prognostiziert, dass die Zahl der Menschen ohne eine Glaubenszugehörigkeit über der, der Katholiken und Evangelisten liegt. [...] Ich werde in dieser Hausarbeit auf zwei, meiner Meinung nach, wichtige Philosophen eingehen. Zum einen werde ich auf den Franzosen René Descartes und den aus seiner Sicht gültigen Gottesbeweis zu sprechen kommen und zum anderen auf Ludwig Feuerbach und seine Auffassung der Religionskritik. Da sowohl Descartes als auch Feuerbach auf rationale Art und Weise versuchen die Existenz Gottes zu belegen bzw. zu wiederlegen, halte ich eine Gegenüberstellung beider Theorien diese Philosophen für äußerst sinnvoll. Diese soll im Schwerpunkt auf die Kriterien des Vernunftverständnisses reduziert werden. Als Grundlage für meine Untersuchungen im Bezug auf die Existenz Gottes dient mir das Werk „Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs“ von René Descartes. Um über die Religionskritik urteilen zu können, ziehe ich für diesen Themenbereich ein Werk von Ludwig Feuerbach mit dem Titel „Das Wesen des Christentums“ heran, in dem seine Ausführungen der Nichtexistenz Gottes gewidmet sind. Da ich, wie bereits beschrieben, 12 Jahre Ethikunterricht genossen habe, besitze ich ebenfalls Aufzeichnungen, welche ich für diese Hausarbeit einbeziehen werde.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen direkten Vergleich unter dem Gesichtspunkt des Vernunftverständnisses zweier Philosophen vorzunehmen, welche auf rationaler Basis einem Gott zusprechen, zum anderen ihm widersprechen. Auf welcher Grundlage sieht Descartes die Existenz, oder wie er es formuliert das „Dasein“ Gottes? Auf welche Basis stützt Ludwig Feuerbach seine Religionskritik und somit die fehlende Existenz Gottes?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Vernunft
- Gottesbeweis
- Religionskritik
- Der Gottesbeweis nach René Descartes
- Leben und Denken von René Descartes
- Sechs Meditationen als Grundlage für den Gottesbeweis
- Die Religionskritik am Beispiel von Ludwig Feuerbach
- Leben und philosophischer Hintergrund
- Gott als Projektion
- Zusammenfassung
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die philosophische Frage nach der Existenz Gottes in der Moderne am Beispiel von René Descartes und Ludwig Feuerbach. Sie untersucht den Gottesbeweis von Descartes und die Religionskritik Feuerbachs unter dem Gesichtspunkt der Vernunft und untersucht die Grundlagen ihrer Argumentation.
- Der Gottesbeweis nach René Descartes
- Die Religionskritik von Ludwig Feuerbach
- Die Rolle der Vernunft in der Gottesfrage
- Die moderne Debatte um Religion und Atheismus
- Die historische Entwicklung des Gottesbegriffs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt den Kontext der Debatte um Religion und Atheismus in der modernen Gesellschaft. Sie erläutert den Hintergrund der Arbeit und stellt die beiden zentralen Figuren, Descartes und Feuerbach, vor.
Das Kapitel „Begriffsklärung“ behandelt die wichtigen Begriffe Vernunft, Gottesbeweis und Religionskritik. Es definiert diese Begriffe und setzt sie in Beziehung zueinander.
Das Kapitel „Der Gottesbeweis nach René Descartes“ beleuchtet das Leben und Werk von Descartes und analysiert die „Sechs Meditationen“ als Grundlage für seinen Gottesbeweis.
Das Kapitel „Die Religionskritik am Beispiel von Ludwig Feuerbach“ behandelt Leben und Werk von Feuerbach und analysiert seine Kritik am christlichen Gottesbild. Es fokussiert insbesondere auf Feuerbachs Theorie von Gott als Projektion des Menschen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Gottesbeweis, Religionskritik, Vernunft, Descartes, Feuerbach, Projektion, Existenz Gottes, moderne Gesellschaft, Atheismus und Religion.
Häufig gestellte Fragen
Welche Philosophen werden in dieser Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht den französischen Philosophen René Descartes, der die Existenz Gottes rational zu belegen versucht, mit Ludwig Feuerbach, der eine rationale Religionskritik und die Nichtexistenz Gottes vertritt.
Was ist die zentrale Fragestellung der Untersuchung?
Das Ziel ist ein direkter Vergleich des Vernunftverständnisses beider Philosophen: Auf welcher Grundlage sieht Descartes die Existenz Gottes, und auf welcher Basis stützt Feuerbach seine Religionskritik?
Welches Werk von Descartes dient als Grundlage für den Gottesbeweis?
Als Grundlage dient das Werk „Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs“, insbesondere im Kontext seiner „Sechs Meditationen“.
Was ist Feuerbachs Hauptargument gegen die Existenz Gottes?
Feuerbach betrachtet Gott als eine Projektion des Menschen. Seine Ausführungen dazu finden sich primär in seinem Werk „Das Wesen des Christentums“.
Wie hat sich die Religionszugehörigkeit in Deutschland laut der Arbeit verändert?
Die Arbeit stellt fest, dass 1970 die Zahl der Gläubigen noch deutlich über der der Konfessionsfreien lag, während für 2010 prognostiziert wurde, dass die Zahl der Menschen ohne Glaubenszugehörigkeit die der Katholiken und Protestanten übersteigt.
Welche Begriffe werden im Kapitel „Begriffsklärung“ behandelt?
Es werden die Begriffe Vernunft, Gottesbeweis und Religionskritik definiert und in einen philosophischen Zusammenhang gebracht.
- Quote paper
- Falk Köhler (Author), 2012, Die philosophische Frage nach der Existenz Gottes in der Moderne am Beispiel von René Descartes und Ludwig Feuerbach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195237