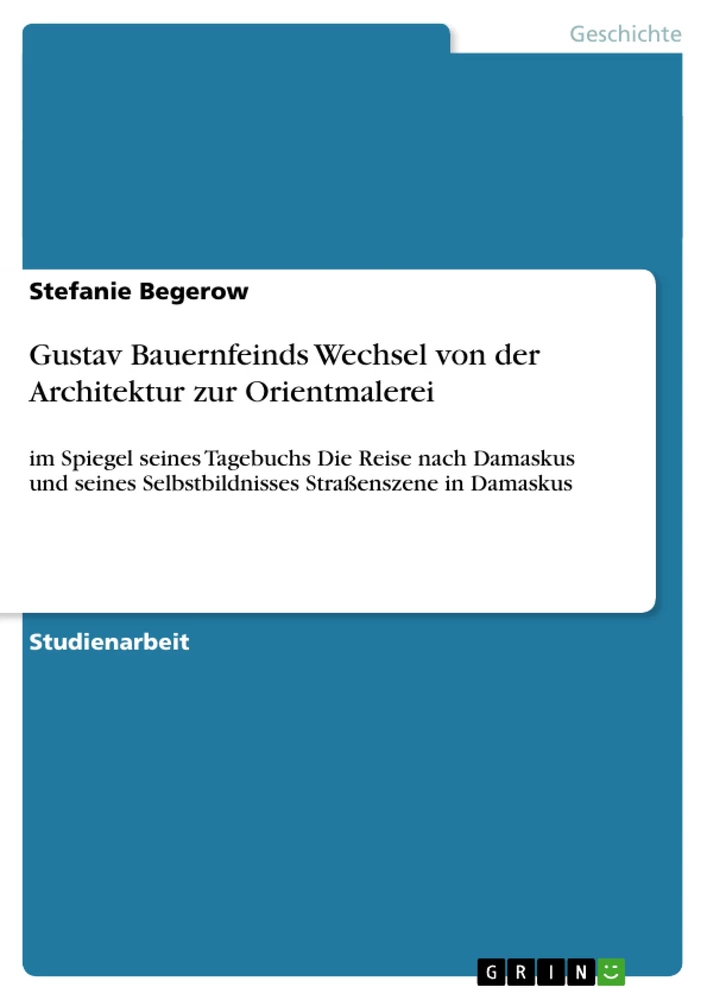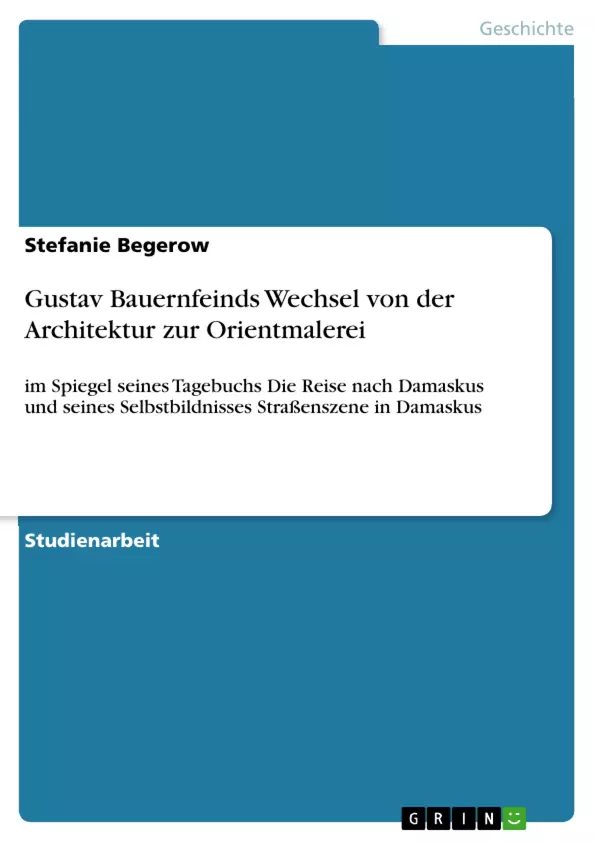In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestand in Europa ein breites Interesse an der Erkundung der orientalischen Welt. Durch die zunehmende Vernetzung des Reiseverkehrs und durch festgelegte Routen wurde das Reisen mehr und mehr erleichtert, Reiseführer wie der Baedeker gaben zudem Auskunft über die verschiedenen Reiseziele. Eine besondere Gruppe unter den Orientreisenden stellten die Künstler dar, denn sie schlossen sich selten den Reisegruppen an, sondern erforschten den Orient meist als Individualreisende. Zudem hielten sie sich häufig längere Zeit in der Ferne auf und hatten durch die Suche nach Modellen und Motiven engeren Kontakt zu Einheimischen. Derartige Reisen waren allerdings sehr kostspielig und auch nicht ungefährlich, sodass nur wenige Künstler die Möglichkeit dazu hatten. Zu diesen wenigen Künstlern zählt der deutsche Orientmaler Gustav Bauernfeind, der sich auf mehreren Reisen abseits der touristischen Pfade im Orient bewegte und später sogar ganz dorthin übersiedelte. Als studierter Architekt hatte er im Laufe seines Lebens die Liebe zur Malerei wie die Liebe zum Orient entdeckt und schließlich beschlossen, in das Fach der Orientmalerei zu wechseln.
Auf seiner dritten Reise in den Orient dokumentierte er seinen Alltag als Reisender und Künstler in Damaskus in Form von einem Tagebuch. Seine Aufzeichnungen bilden eine interessante Quelle für die geschichtswissenschaftliche Forschung anhand von Selbstzeugnissen, denn Bauernfeind zeichnet ein Bild von sich und seiner Wahrnehmung einer Welt, die zu dieser Zeit noch wenig durch den Kontakt mit der europäischen Zivilisation geprägt war. Somit gibt Die Reise nach Damaskus Aufschluss über eine – wie die Historikerin Anke Stephan es nennt – „Wechselwirkung zwischen Individuen und Strukturen, zwischen Mikro- und Makroebene“, und dient somit der Beleuchtung von historischen Prozessen aus der Sicht des Individuums.
Ziel dieser Arbeit soll es nun sein, das Tagebuch und das Selbstbildnis Gustav Bauernfeinds zu untersuchen und einander gegenüberzustellen. Der Schwerpunkt der Untersuchung soll dabei seine Hinwendung zur Orientmalerei sein, zugunsten derer er seinen eigentlichen Beruf als Architekt aufgab. Inwiefern beide Quellen Auskunft über diese wesentliche Entscheidung seines Lebens geben, gilt es herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gustav Bauernfeind: Architekt und Orientmaler
- Der Weg zum Architekten
- Die Entscheidung für die Orientmalerei
- Die Reise nach Damaskus 1888/89
- Gustav Bauernfeind zeigt sich und seine Welt
- Das Tagebuch „Die Reise nach Damaskus“
- Das Selbstbildnis „Straßenszene in Damaskus“
- Welche Rolle spielten Tagebuch und Selbstbildnis?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Tagebuch und das Selbstbildnis Gustav Bauernfeinds, um seine Hinwendung zur Orientmalerei und den Verzicht auf seinen Beruf als Architekt zu beleuchten. Es wird analysiert, inwiefern beide Quellen Aufschluss über diese wichtige Lebensentscheidung geben.
- Gustav Bauernfeinds Werdegang vom Architekten zum Orientmaler
- Analyse des Tagebuchs „Die Reise nach Damaskus“ als historische Quelle
- Interpretation des Selbstbildnisses „Straßenszene in Damaskus“ im Kontext der Selbstzeugnisforschung
- Der Einfluss des orientalischen Reisens auf Bauernfeinds künstlerische Entwicklung
- Die Bedeutung von Selbstzeugnissen für die Geschichtswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das breite europäische Interesse an der orientalischen Welt im 19. Jahrhundert und die Rolle von Künstlern als Individualreisende. Sie hebt Gustav Bauernfeind als Beispiel hervor und benennt sein Tagebuch „Die Reise nach Damaskus“ und sein Selbstbildnis „Straßenszene in Damaskus“ als zentrale Quellen für die Untersuchung seiner Hinwendung zur Orientmalerei. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse beider Quellen im Hinblick auf Bauernfeinds wichtige Lebensentscheidung, seinen Beruf als Architekt aufzugeben.
Gustav Bauernfeind: Architekt und Orientmaler: Dieses Kapitel beleuchtet Bauernfeinds Leben und Werk. Es skizziert seinen Weg zum Architekten, die Gründe für seine Entscheidung, sich der Orientmalerei zu widmen, und beschreibt seine Reise nach Damaskus 1888/89 als einen wichtigen Meilenstein in seiner künstlerischen Entwicklung. Der Abschnitt behandelt seine anfängliche relative Unbekanntheit und die spätere Wiederentdeckung seines Werks. Es wird auch der Kontext seiner Familiengeschichte und seines sozialen Umfelds beleuchtet, um seinen Werdegang besser zu verstehen. Die Herausforderungen und Umstände seiner frühen Karriere als Maler, einschließlich des Verkaufs seiner Bilder und des Verstreuens seiner Werke nach seinem Tod, werden detailliert beschrieben, um den späteren Erfolg der Wiederentdeckung seines Werkes zu kontextualisieren.
Gustav Bauernfeind zeigt sich und seine Welt: Dieses Kapitel analysiert Bauernfeinds Tagebuch „Die Reise nach Damaskus“ und sein Selbstbildnis „Straßenszene in Damaskus“ als Selbstzeugnisse. Es untersucht, wie diese Quellen Einblicke in Bauernfeinds Wahrnehmung der orientalischen Welt und seine persönliche Entwicklung geben. Die Analyse berücksichtigt die Definition von Selbstzeugnissen nach Benigna von Krusenstjern und bewertet den Wert dieser Quellen für die geschichtswissenschaftliche Forschung. Es wird detailliert dargelegt, wie sowohl das Tagebuch als auch das Gemälde Bauernfeinds persönliche Erfahrungen und seine Sichtweise auf die damalige Zeit widerspiegeln. Der Vergleich beider Quellen betont ihre unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Perspektiven auf seine künstlerische und persönliche Reise. Die Rolle dieser Selbstzeugnisse als Reflexion seiner Lebensentscheidung steht im Vordergrund.
Schlüsselwörter
Gustav Bauernfeind, Orientmalerei, Architektur, Selbstzeugnisse, Tagebuch, Selbstbildnis, Reise nach Damaskus, Geschichtswissenschaft, 19. Jahrhundert, Orient, Selbstthematisierung.
Häufig gestellte Fragen zu "Gustav Bauernfeind: Architekt und Orientmaler"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Tagebuch und das Selbstbildnis von Gustav Bauernfeind, um seine Hinwendung zur Orientmalerei und den Verzicht auf seine Karriere als Architekt zu verstehen. Sie untersucht, wie diese Quellen Aufschluss über diese wichtige Lebensentscheidung geben und beleuchtet Bauernfeinds Werdegang, seine Reise nach Damaskus und den Einfluss des orientalischen Reisens auf seine künstlerische Entwicklung. Die Bedeutung von Selbstzeugnissen in der Geschichtswissenschaft spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.
Welche Quellen werden untersucht?
Die Hauptquellen sind das Tagebuch "Die Reise nach Damaskus" und das Selbstbildnis "Straßenszene in Damaskus" von Gustav Bauernfeind. Beide werden als Selbstzeugnisse analysiert und hinsichtlich ihres Wertes für die historische Forschung bewertet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Gustav Bauernfeinds Werdegang vom Architekten zum Orientmaler, die Analyse seines Tagebuchs als historische Quelle, die Interpretation seines Selbstbildnisses im Kontext der Selbstzeugnisforschung, der Einfluss des orientalischen Reisens auf seine künstlerische Entwicklung und die Bedeutung von Selbstzeugnissen für die Geschichtswissenschaft. Zusätzlich wird der Kontext des europäischen Interesses am Orient im 19. Jahrhundert beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel ("Gustav Bauernfeind: Architekt und Orientmaler", "Gustav Bauernfeind zeigt sich und seine Welt", "Schluss") und einen Abschnitt mit Schlüsselwörtern. Die Einleitung beschreibt das Thema und die Forschungsfrage. Die Hauptkapitel untersuchen Bauernfeinds Leben und Werk, analysieren seine Selbstzeugnisse und diskutieren ihre Bedeutung. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen Überblick über den Inhalt jedes Teils.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Motivation hinter Bauernfeinds Umstieg vom Architekten zum Orientmaler zu verstehen. Dies geschieht durch die Analyse seines Tagebuchs und Selbstbildnisses, um Einblicke in seine persönliche Entwicklung und seine künstlerische Sichtweise zu gewinnen. Die Arbeit trägt somit zum Verständnis der Bedeutung von Selbstzeugnissen in der historischen Forschung bei.
Welche Rolle spielt das 19. Jahrhundert im Kontext der Arbeit?
Das 19. Jahrhundert bietet den historischen Kontext für Bauernfeinds Leben und Werk. Die Arbeit beleuchtet das breite europäische Interesse am Orient in dieser Zeit und die Rolle von Künstlern als Individualreisende. Dieser Kontext ist wichtig, um Bauernfeinds Entscheidung für die Orientmalerei zu verstehen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse?
Die Arbeit zeigt, wie das Tagebuch und das Selbstbildnis sich ergänzen und Aufschluss über Bauernfeinds persönliche und künstlerische Entwicklung geben. Sie unterstreicht den Wert von Selbstzeugnissen für die historische Forschung, insbesondere im Hinblick auf das Verständnis individueller Lebensentscheidungen und künstlerischer Entwicklungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gustav Bauernfeind, Orientmalerei, Architektur, Selbstzeugnisse, Tagebuch, Selbstbildnis, Reise nach Damaskus, Geschichtswissenschaft, 19. Jahrhundert, Orient, Selbstthematisierung.
- Citar trabajo
- Stefanie Begerow (Autor), 2012, Gustav Bauernfeinds Wechsel von der Architektur zur Orientmalerei , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195248