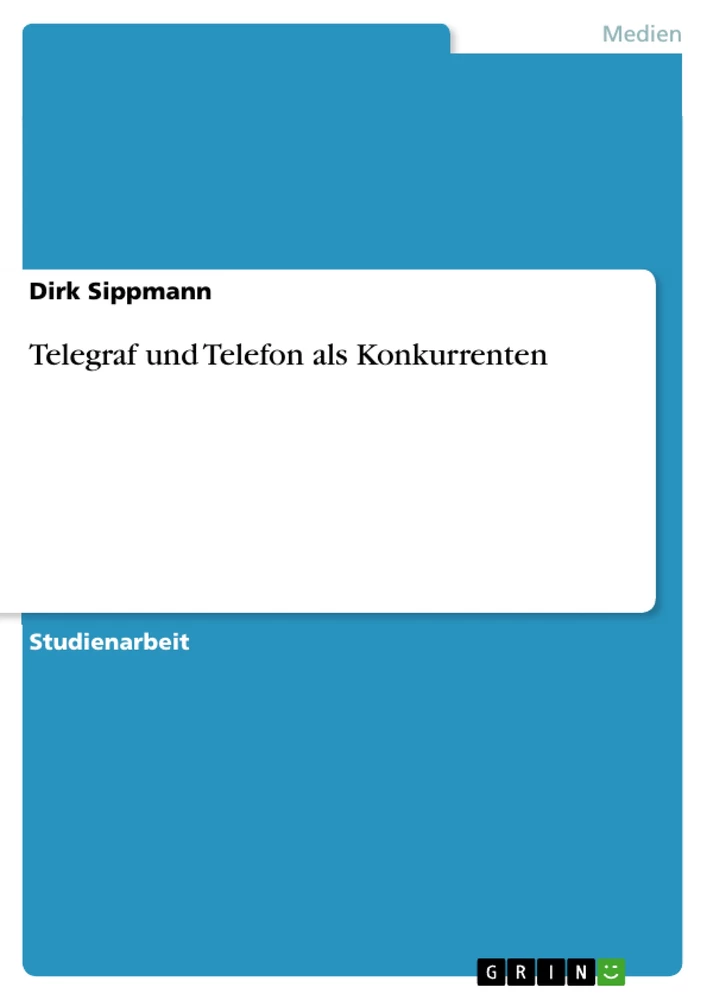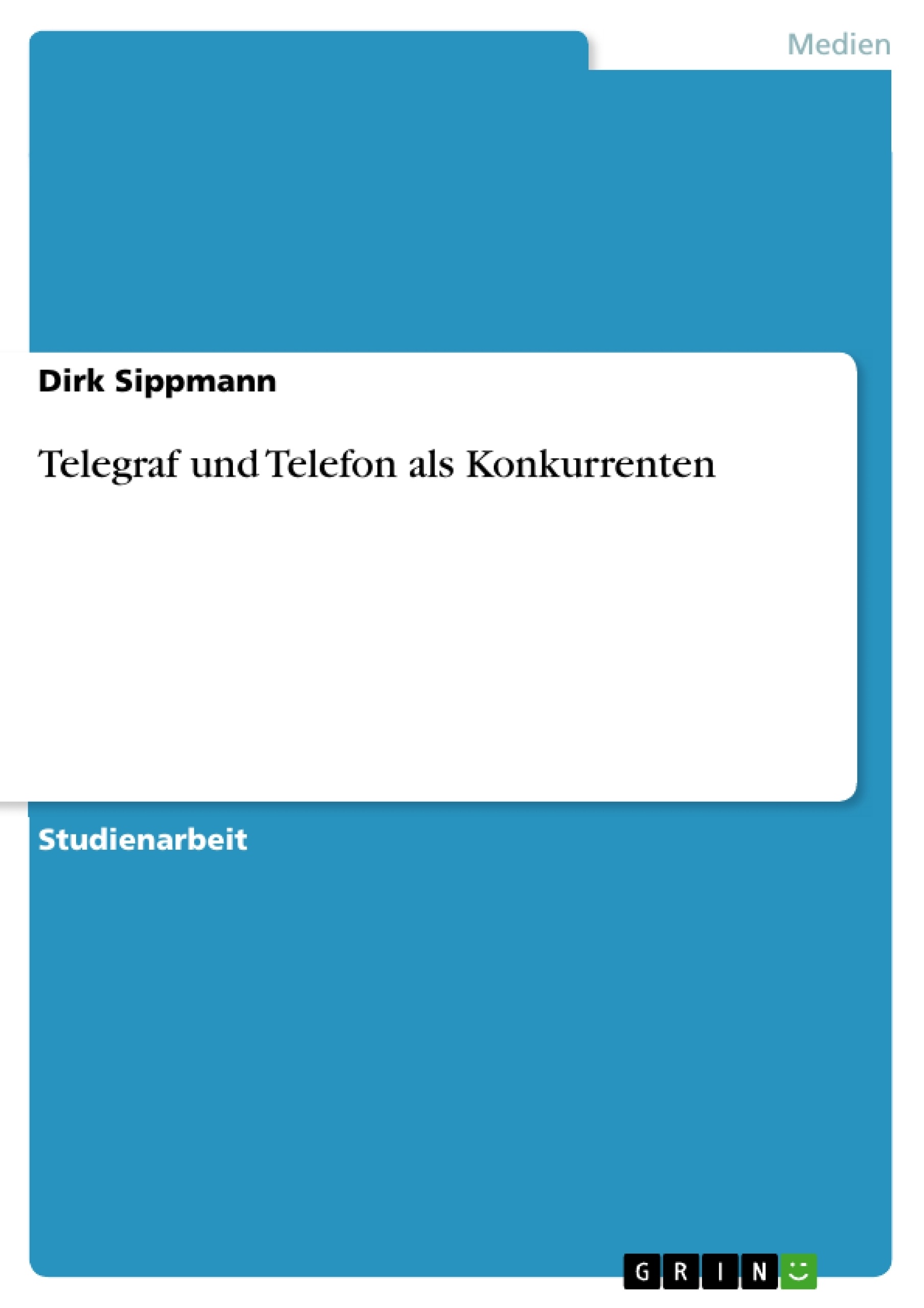Die Entwicklung des elektrischen Telegrafen um 1850 und das Aufkommen des Telefons ab etwa 1875 markieren den Beginn der Nutzung von elektronischen Medien („Tertiärmedien“). Neben der Erfindung an sich, ist vor allem die enorm schnelle Verbreitung dieser neuen Medien beachtlich. Der kurze zeitliche Abstand zwischen den Anfängen des Telegrafen und dem Aufkommen des Telefons von nur knapp 25 Jahre bedingt überdies auch ein Phänomen, welches in der Medienkulturgeschichte bis heute selten zu beobachten ist. Die Technik und der Gebrauch des elektrischen Telegrafen wurde schon wenige Jahrzehnte nach dessen weltweiter Verbreitung unrentabel und galt schnell als überholt. Das beginnende Zeitalter des Telefons hatte die Verdrängung des Telegrafen zur Folge. Nichtsdestotrotz ist der Telegraf als Instrument der Nachrichtenübermittlung vor allem für das Entstehen moderner Korrespondenzbüros und Nachrichtenagenturen und somit auch noch für die heutige Medienlandschaft von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Im Folgenden soll daher näher auf die Entwicklung und Verbreitung des Telegrafen und des Telefons eingegangen werden. In diesem Zusammenhang wird auch die unterschiedliche Wahrnehmung und Nutzung dieser neuen Medien in Deutschland bzw. den Vereinigten Staaten erörtert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Überblick
2. Entstehung und Entwicklung des Telegrafenwesens
3. Das Telefon erobert die Welt
3.1 Das Telefon - Eine US-amerikanische „Erfindung“
3.2 Die Anfänge des Telefons in Deutschland
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung und Überblick
Würde man vor die Aufgabe gestellt, jedem Jahrhundert seit dem Beginn der europäischen Neuzeit einen Titel geben zu müssen, wäre die Bezeichnung „Jahrhundert der Revolutionen“ für das 19. Jahrhundert sicher eine passende Formulierung. Neben politischen und industriellen Revolutionen und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen, vollzieht sich in diesem 19. Jahrhundert auch eine Kommunikation- und Medienrevolution, wie sie dem Umfang und den Auswirkungen nach nur vergleichbar ist mit den Entwicklungen des 16. Jahrhunderts (Buchdruck) und eventuell den neueren Prozessen der letzten 20 Jahre (digitale Medien, „Quartärmedien“).[1] Die Epoche zwischen dem Wiener Kongress 1815 und dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 war ein Zeitraum, in dem eine Vielzahl an Erfindungen und technischen Innovationen getätigt wurden, die in ihrer Gesamtheit das Leben und die Umwelt späterer Generationen maßgeblich beeinflussten. Elektrizität wurde erstmals in großem Umfang für den Menschen nutzbar gemacht und einer Reihe von klugen und risikobereiten Köpfen ist es zu verdanken, dass der Prozess der Industrialisierung sich deutlich beschleunigte.
In den Kontext dieses wirtschaftlichen und sozialen Wandlungsprozesses sind die Erfindung und Verbreitung zweier Medien zu stellen, deren bedeutendes Merkmal die Nutzung von elektrischer Energie zur Übertragung von Information ist. Die Entwicklung des elektrischen Telegrafen um 1850 und das Aufkommen des Telefons ab etwa 1875 markieren den Beginn der Nutzung von elektronischen Medien („Tertiärmedien“). Neben der Erfindung an sich, ist vor allem die enorm schnelle Verbreitung dieser neuen Medien beachtlich.[2] Der kurze zeitliche Abstand zwischen den Anfängen des Telegrafen und dem Aufkommen des Telefons von nur knapp 25 Jahre bedingt überdies auch ein Phänomen, welches in der Medienkulturgeschichte bis heute selten zu beobachten ist. Die Technik und der Gebrauch des elektrischen Telegrafen wurde schon wenige Jahrzehnte nach dessen weltweiter Verbreitung unrentabel und galt schnell als überholt. Das beginnende Zeitalter des Telefons hatte die Verdrängung des Telegrafen zur Folge.[3] Nichtsdestotrotz ist der Telegraf als Instrument der Nachrichtenübermittlung vor allem für das Entstehen moderner Korrespondenzbüros und Nachrichtenagenturen und somit auch noch für die heutige Medienlandschaft von nicht zu unterschätzender Bedeutung.[4] Im Folgenden soll daher näher auf die Entwicklung und Verbreitung des Telegrafen und des Telefons eingegangen werden. In diesem Zusammenhang wird auch die unterschiedliche Wahrnehmung und Nutzung dieser neuen Medien in Deutschland bzw. den Vereinigten Staaten erörtert. Eine detaillierte Beschreibung der technischen Abläufe und Prozesse kann diese Arbeit nicht leisten. Vielmehr sollen die Bedeutung und der Einfluss dieser beiden Medien auf Gesellschaft, Politik und Wirtschaft des 19. Jahrhunderts erörtert werden.
2. Entstehung und Entwicklung des Telegrafenwesens
Wie bereits oben erwähnt, kommt dem Telegrafen „eine große Bedeutung zu, vor allem in seiner Brückenfunktion“[5] und als Wegbereiter für den alltäglichen Gebrauch elektronischer Medien. Dabei steht der Telegraf einerseits noch ganz in der Tradition der Schreibmedien (in Form von Telegrammen), andererseits werden durch die elektronische Übertragungsweise bei der Individualkommunikation über ein Medium Geschwindigkeiten erreicht, die bis dato mit keinem anderen Medium möglich waren.[6] Als Vorläufer der technischen Innovation des elektrischen Telegrafen gilt die Informationsübermittlung mittels optischer Telegrafie. Diese Form der Weitergabe von Information durch optische Signale (Signalfeuer, Flaggensignale etc.) war bereits seit Jahrhunderten bekannt und wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor allem in europäischen Staaten intensiv genutzt.[7] Allerdings bestand bei der optischen Telegrafie der Nachteil, dass Witterungseinflüsse und Dunkelheit die Nutzbarkeit dieser Technik einschränkten und die Technik somit zunehmend unrentabel wurde und nicht mehr Zeitgemäß erschien. Der Beginn der industriellen Revolution verlangte zudem nach schnelleren und verlässlicheren Wegen der Nachrichtentechnik. Erste Versuche der elektronischen Datenübermittlung (elektromagnetische Telegrafie) wurden bereits Ende des 18. Jahrhunderts durchgeführt. Trotz zahlreicher Vorgängermodelle stellte sich jedoch erst der Schreibtelegraf von Samuel F.B. Morse aus dem Jahr 1837 als praktikabler und nutzbarer Apparat dar. Dieses neue Gerät verwendete ein Codierungssystem aus Punkten und Strichen.[8] Der Morse’sche Schreibtelegraf, nach dessen Erfinder später auch das verwendete System zur Codierung „Morsealphabet“ genannt wurde, sollte sich weltweit durchsetzen. Die Vorteile des neuen Mediums lagen vor allem in der deutlich schnelleren Übertragungszeit von Nachrichten und Information.
Besonders schnell ging der Aufbau des Telegrafennetzes in den Vereinigten Staaten voran. Bereits zu Beginn der 1850er Jahre existierten über 50 Telegrafengesellschaften. Binnen zwei Jahrzehnten wuchs das Telegrafennetz auf über 100.000 Meilen Leitung an.[9] In Europa vollzog sich diese Entwicklung etwas später; 1851 wurde auch hier „der Morseapparat als Standard der europäischen Telegrafie eingeführt“.[10] Die Entwicklung des Telegrafenwesens verlief auf beiden Seiten des Atlantiks jedoch nicht parallel. Während sich die Telegrafie in den Vereinigten Staaten schon früh, geschuldet dem mangelnden Interesse seitens des Staates, zu einem rein privatrechtlichen Geschäft ordnete und zum größten Teil in der Hand eines Monopolisten stand,[11] wurde in Deutschland mit dem Aufbau eines elektrischen Staatstelegrafennetzes begonnen.[12] Besonders in den Anfangsjahren war die Telegrafie, trotz hoher Betriebskosten, ein recht lukratives Geschäft. Durch Marktmonopole einerseits (USA) und staatlich kontrolliertem Telegrafennetz andererseits (Deutschland und andere europäische Staaten), wurden die Preise für das versenden eines Telegramms hochgehalten. Dem Erfolg des neuen Mediums schadete diese Preispolitik jedoch nicht. Vor allem die privatwirtschaftliche Nutzung des Telegrafenwesens gewann, neben der ursprünglich dominierenden militärischen und verwaltungstechnischen Verwendung, immer mehr an Bedeutung. Binnen kürzester Zeit vervielfachte sich die Zahl der gesendeten Telegramme.[13]
Das Merkmal der schnellen Übertragung von Information über weite Strecken verlangte nach neuen Organisationsformen, um den grenzüberschreitenden Nachrichtenverkehr zu verbessern oder überhaupt erst zu ermöglichen. Bereits 1865 schlossen alle bedeutenden europäischen Staaten untereinander Verträge und gründeten einen gesamteuropäischen Telegrafenverein. Die Entwicklung der elektronischen Telegrafie ließ die Welt „zusammenrücken“. Nachrichten und Mitteilungen, deren Versendung bislang per See- und Landweg einige Wochen in Anspruch nahmen, wurden nun in einem Bruchteil der Zeit übermittelt.[14] Es verwundert daher nicht, dass gerade große Kolonialmächte wie Großbritannien die neue Technik intensiv zur Kommunikation zwischen dem Mutterland und den Kolonien nutzten und das Telegrafennetz zügig ausbauten.[15]
[...]
[1] Vgl.: North, Michael, Einleitung, 2001, S. XII-XIII
[2] Vgl.: Faulstich, Werner, Medienwandel, 2004, S. 51, 53 Wessel, Horst A., Kommunikationsrevolution, 2001, S. 101
[3] Vgl.: Faulstich, Werner, Medienwandel, 2004, S. 54
[4] Vgl.: Faulstich, Werner, Medienwandel, 2004, S. 57
[5] Faulstich, Werner, Medienwandel, 2004, S. 48
[6] Vgl.: Faulstich, Werner, Medienwandel, 2004, S. 48
[7] Vgl.: Schneider, Volker, Kommunikation, 1999, S. 163-164
[8] Zur detaillierten Entwicklung elektrischer Telegrafenkonstruktionen siehe auch: Oberliesen, Rolf, Information, Daten und Signale, 1982, S. 84-98, 104 ff.
[9] Vgl.: Schneider, Volker, Kommunikation, 1999, S. 81
[10] Faulstich, Werner, Medienwandel, 2004, S. 51
[11] Vgl.: Schneider, Volker, Kommunikation, 1999, S. 81
[12] Vgl.: Faulstich, Werner, Medienwandel, 2004, S. 53
[13] Vgl.: Oberliesen, Rolf, Information, Daten und Signale, 1982, S. 111-114
[14] Vgl.: Faulstich, Werner, Medienwandel, 2004, S. 53-54
[15] Vgl.: Oberliesen, Rolf, Information, Daten und Signale, 1982, S. 122 Schneider, Volker, Kommunikation, 1999, S. 70-71
- Citar trabajo
- Dirk Sippmann (Autor), 2010, Telegraf und Telefon als Konkurrenten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195307