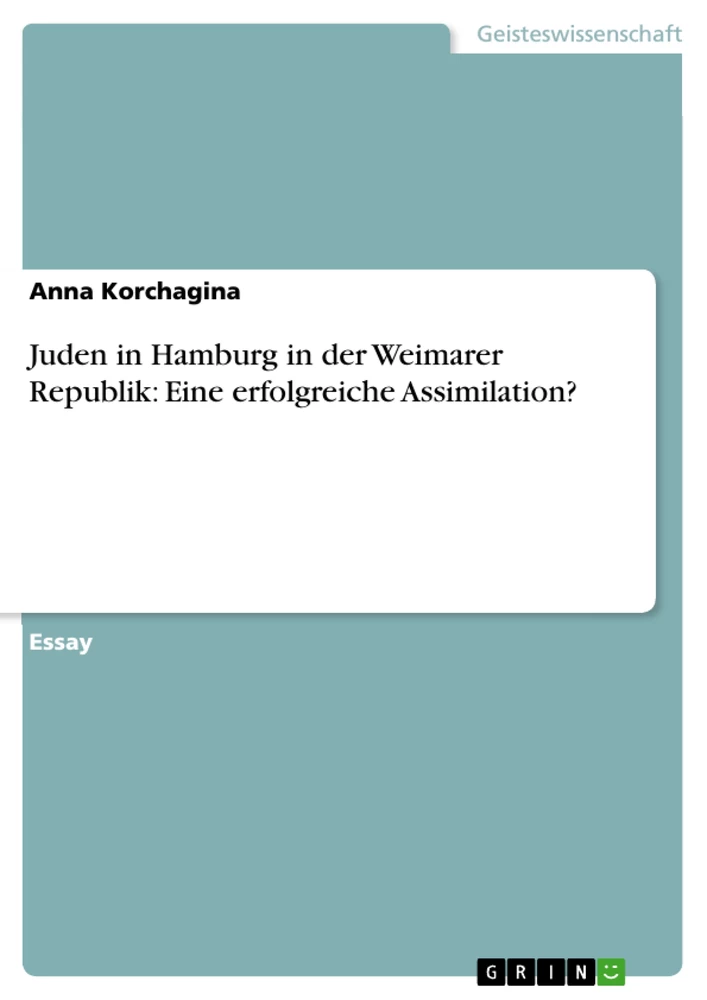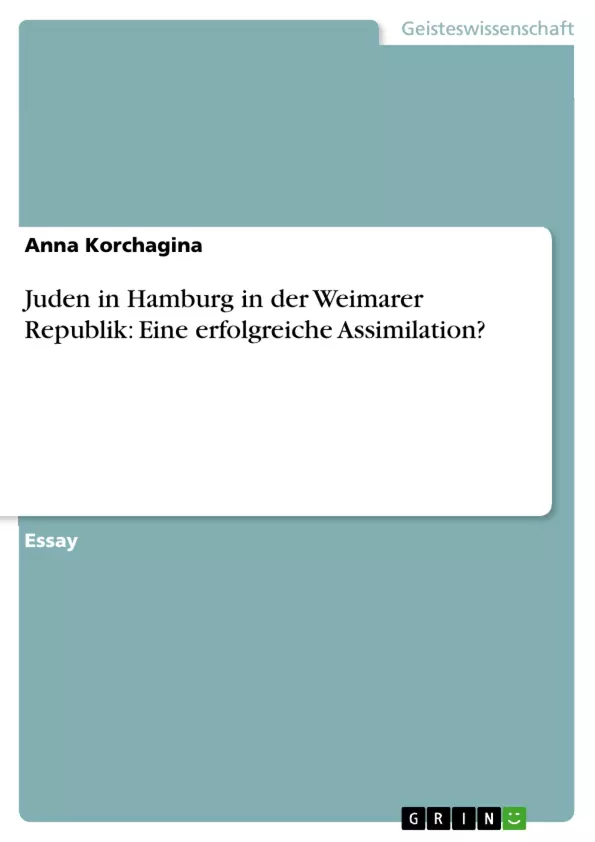Fragestellung und Themenabgrenzung Zu Beginn meiner Ausführungen stellt sich die Frage, ob die Hamburger Juden in der Zeit der Weimarer Republik besonders waren. In welchen Stadtteilen Hamburgs haben sie gelebt?
Gab es eine räumliche Abgeschlossenheit der jüdischen Bevölkerungsgruppe von der
übrigen Öffentlichkeit, ein „freiwilliges Ghetto Rotherbaum“ (Lorenz 1989: LXIX) hat der Prozess der Assimilation, d.h. der Verschmelzung der jüdischen Minderheit mit der deutschen Mehrheit stattgefunden? Welche Rolle haben die Juden in der Zeit der Weimarer Republik gespielt? Gab es in Hamburg bekannte Juden? Um diese Fragen zu beantworten, wäre ein historischer Exkurs sinnvoll: Um besser zu verstehen, warum die jüdische Bevölkerung Hamburgs in der Weimarer Republik bestimmte Eigenschaften aufwies, sollte man zuerst untersuchen, wann und wie Juden nach Hamburg umgesiedelt sind und was die Juden in anderen Großstädten Deutschlands auszeichnet. Eine solche Untersuchung würde aber den Umfang eines Essays deutlich sprengen, so dass hier „nur“ eine Bestandsaufnahme bestimmter Aspekte des jüdischen Lebens in Hamburg der Weimarer Republik vorgenommen wird.
Fragestellung und Themenabgrenzung
Zu Beginn meiner Ausführungen stellt sich die Frage, ob die Hamburger Juden in der Zeit der Weimarer Republik besonders waren. In welchen Stadtteilen Hamburgs haben sie ge- lebt? Gab es eine räumliche Abgeschlossenheit der jüdischen Bevölkerungsgruppe von der übrigen Öffentlichkeit, ein „freiwilliges Ghetto Rotherbaum“ (Lorenz 1989: LXIX) hat der Prozess der Assimilation, d.h. der Verschmelzung der jüdischen Minderheit mit der deut- schen Mehrheit stattgefunden? Welche Rolle haben die Juden in der Zeit der Weimarer Republik gespielt? Gab es in Hamburg bekannte Juden? Um diese Fragen zu beantworten, wäre ein historischer Exkurs sinnvoll: Um besser zu verstehen, warum die jüdische Bevöl- kerung Hamburgs in der Weimarer Republik bestimmte Eigenschaften aufwies, sollte man zuerst untersuchen, wann und wie Juden nach Hamburg umgesiedelt sind und was die Ju- den in anderen Großstädten Deutschlands auszeichnet. Eine solche Untersuchung würde aber den Umfang eines Essays deutlich sprengen, so dass hier „nur“ eine Bestandsaufnah- me bestimmter Aspekte des jüdischen Lebens in Hamburg der Weimarer Republik vorge- nommen wird.
Juden in Hamburg in der Weimarer Republik: Eine erfolgreiche Assimilation?
In der Zeit der Weimarer Republik (1918/19 bis 1933) war Deutschland eine demokratisch verfasste, parlamentarische Republik. Die Besonderheiten der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburg stellt nicht nur eine Kommune dar, sondern ist auch Stadtstaat) be- einflussten das Leben der jüdischen Bevölkerung in Hamburg in dieser Zeit. Da Hamburg sich durch seine Regierungsform von anderen Großstädten Deutschlands unterscheidet, ist zu vermuten, dass das Leben der Juden in Hamburg die Geschichte der Juden eines repub- likanischen Stadtstaates ist. Die demokratisch-republikanische Entwicklung der Hambur- ger Staat und seine weltoffene Tradition diente als Vorbild ihren Juden und prägte sie. So wurde die Deutsch-Israelitische Gemeinde Hamburg (DIGH) in ihrer Organisationsform nach dem Vorbild Hamburgs strukturiert. Anders als in anderen deutschen Städten gab es in Hamburg keine Kultusgemeinde, d.h. dass der Staat und die Kirche getrennt waren. Eine solche Trennung in der jüdischen Gemeindegeschichte wurde zum ersten Mal in Hamburg durchgeführt (und als „Hamburger System“ bezeichnet). Im Rahmen dieses Systems wur- den die Aufgaben zwischen der Gesamtgemeinde und den einzelnen Kultus- oder Synago- genverbänden verteilt. Der Gesamtgemeinde oblagen soziale, ökonomische und kulturelle Aufgaben, wie zum Beispiel Steuerwesen, Krankenhäuser und Schulen. Die Kultus- oder Synagogenverbände regelten alle rituellen Angelegenheiten (mit Ausnahme des Begräb- niswesens). Diese Trennung hat es ermöglicht, den Juden verschiedener Konfessionen, orthodoxen und religionsindifferenten Juden innerhalb einer Gesamtgemeinde zusammen zu leben (Vgl. Ophir 1983: 81 ff.). Es stellt sich nun mehr die Frage, ob die jüdische Bevölkerung Hamburgs und deren unterschiedliche Gruppen, wie orthodoxe und liberale Juden, sich diffus oder doch konzentriert ansiedelten.
Lorenz untersucht die innerstädtischen Siedlungsstrukturen der Juden Hamburgs. Während im Jahre 1871 etwa 75% der Hamburger Juden in der Altstadt oder Neustadt wohnte, wä- ren es 1925 nur 7%. Dieser Unterschied resultierte aus der Verlagerung der Gesamtbevöl- kerung Hamburgs Ende des 19. Jahrhunderts in die neuen Stadtviertel Rotherbaum, Har- vestehude und Eimsbüttel. Bei den Juden ist diese Tendenz aber überproportional stark. Um die Jahrhundertwende betrug der Anteil der jüdischen Bevölkerung an der Gesamtbe- völkerung im Stadtteil Rotherbaum etwa 20%. In der Zeit bis 1925 erhöhte sich der Anteil der Juden in den neuen Stadtvierteln erneut, wenngleich nicht mehr mit einer so starken Tendenz. Insgesamt wurde das folgende Bild zu beobachten: 63% aller Juden Hamburgs besiedelten die Stadtteile Rotherbaum und Harvestehude (mit jeweils 24%) sowie Eppen- dorf (mit 15%). Im Bezug auf die Stadt ohne die ländlichen Gebiete des Stadtstaates Ham- burgs lebten in den oben genannten drei neuen Stadtteilen etwa 70% aller in der Stadt le- benden Juden und nur rund 14% der städtischen Wohnbevölkerung. Die Zahlen bringen deutlich zum Ausdruck, dass die Hamburger Juden das Gebiet von Rotherbaum und Har- vestehude den anderen Stadtteilen bevorzugten und sich dort konzentriert siedelten (Vgl. Lorenz 1989: LXV f.).
Aus dem Anteil der Kinder unter 14 Jahren in den umgesiedelten jüdischen Familien lässt sich ableiten, dass der Stadtteil Eppendorf eher von jüngeren Familien bevorzugt wurde. Die Ursache dieser Entwicklung könnte in dem damals vergleichsweise billigeren Mieten- niveau in dem Stadtteil Eppendorf liegen. Dies führte zu einer stärkeren Bevölkerungsdich- te. Diese Bevölkerungsdichte - gemessen als die Anzahl der Bewohner je gebautes Grund- stück - betrug jeweils etwa 50% in Eppendorf, 30% in Rotherbaum und 18% in Harveste- hude. Die absolute Anzahl aller Haushalte der Gesamtbevölkerung im Stadtteil Eppendorf vervierfachte sich zwischen den Jahren 1900 und 1925 (Vgl. Lorenz 1989: LXVI).
Die Betrachtung der durchschnittlichen Steuerquote je Einwohner der Gesamtbevölkerung zeigt, dass in den Stadtteilen Harvestehude und Rotherbaum die wohlhabenden Bürger wohnten. Daraus lässt sich schließen, dass während der Weimarer Republik die Juden sich überdurchschnittlich zahlreich in den reicheren Vierteln und unterdurchschnittlich wenig in den ärmeren Vierteln siedelten. Das Zentrum des religiösen, sozialen und kulturellen Le- bens konzentrierte sich auf die Stadtteile Rotherbaum und Harvestehude und insbesondere auf das Straßengebiet Grindelallee, Grindelhof, Rappstraße, Dillstraße, Durchschnitt, Rentzelstraße, Rutschbahn, Bundesstraße, Bornstraße, Heinrich-Barth-Straße, Rother- baumchaussee, Hallerstraße, Hartungstraße, Hochallee und Brahmsallee (Vgl. Lorenz 1989: LXVII).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was war das "Hamburger System" in der jüdischen Gemeinde?
Es bezeichnete die Trennung von Gesamtgemeinde (zuständig für Soziales, Steuern, Schulen) und den einzelnen religiösen Verbänden (orthodox, liberal), was ein Zusammenleben verschiedener Strömungen ermöglichte.
In welchen Hamburger Stadtteilen lebten die meisten Juden in der Weimarer Republik?
Etwa 70 % der jüdischen Bevölkerung konzentrierten sich auf die Stadtteile Rotherbaum, Harvestehude und Eppendorf.
War die Assimilation der Juden in Hamburg erfolgreich?
In der Weimarer Republik gab es eine starke kulturelle und soziale Verschmelzung mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft, was sich auch in der Übernahme demokratischer Strukturen widerspiegelte.
Was war das "freiwillige Ghetto Rotherbaum"?
Dieser Begriff beschreibt die starke räumliche Konzentration jüdischen Lebens in Rotherbaum, die jedoch auf freiwilliger Ansiedlung in einem attraktiven Wohnviertel basierte, nicht auf Zwang.
Warum zogen viele jüdische Familien nach Eppendorf?
Eppendorf wurde besonders von jüngeren Familien bevorzugt, was vermutlich an dem damals vergleichsweise günstigeren Mietniveau im Vergleich zu Harvestehude lag.
Welche Rolle spielten Juden im öffentlichen Leben Hamburgs?
Juden waren in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Hamburgs stark vertreten und prägten die weltoffene Tradition der Hansestadt maßgeblich mit.
- Citation du texte
- Anna Korchagina (Auteur), 2012, Juden in Hamburg in der Weimarer Republik: Eine erfolgreiche Assimilation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195371