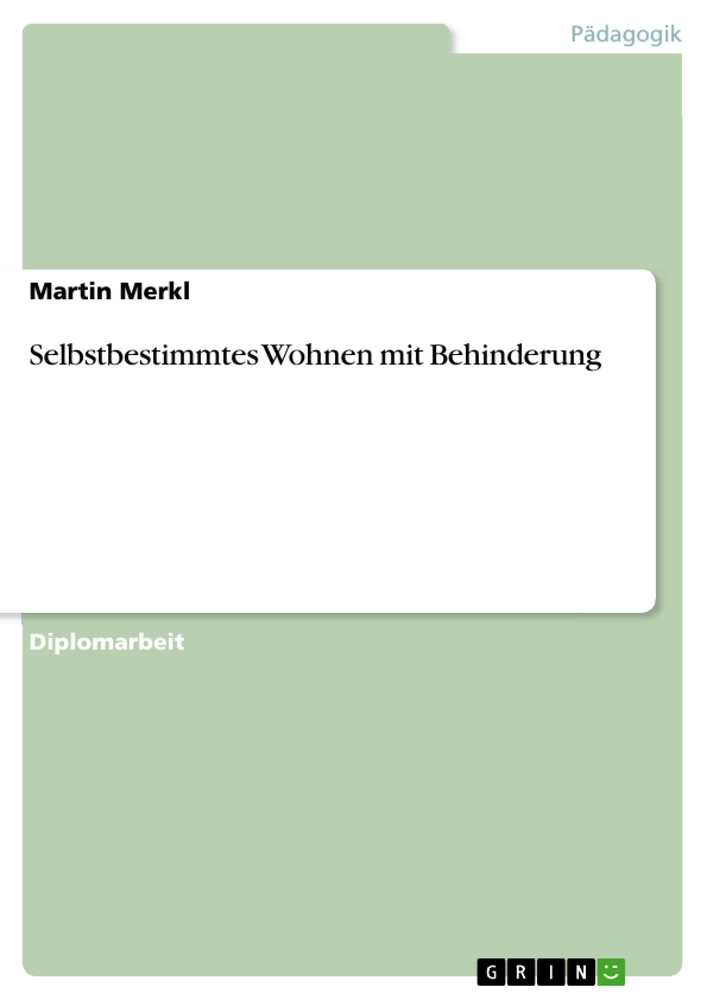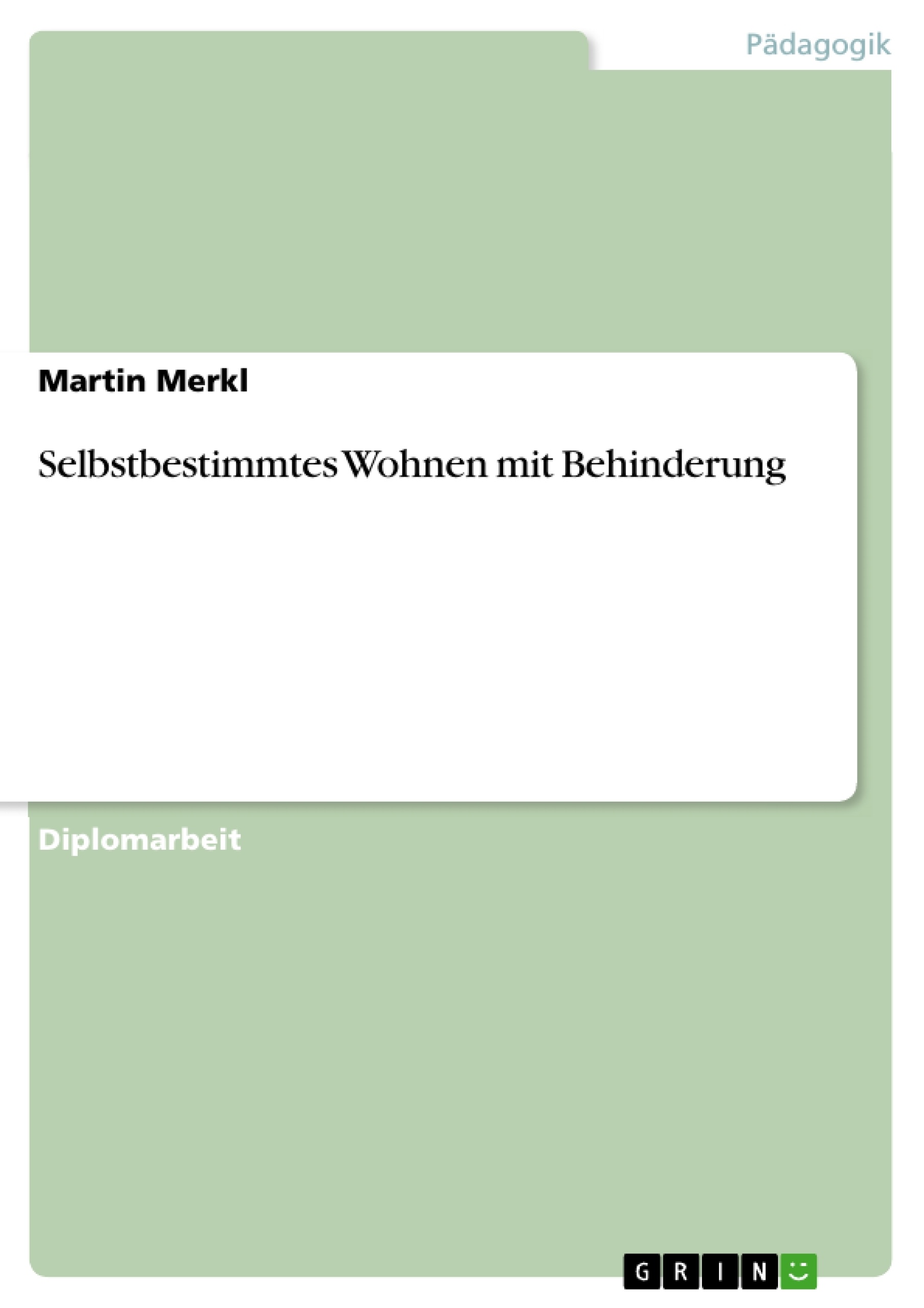Das Hauptforschungsziel dieser Arbeit liegt darin, mit dem paradigmatischen Hintergrund von Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe eine faktische Verortung des Entwicklungsstandes der Mainzer Behindertenhilfe bzgl. gegebener Wohnangebote für Menschen mit Behinderung zu formulieren. Folgende Fragestellungen bilden den leitenden Rahmen: 1. Wie ist die Wohnressourcenlandschaft für Menschen m. B. im Stadtgebiet Mainz quantitativ und qualitativ beschaffen? 2. Welche sozialpolitischen Maßnahmen lassen sich zu Gunsten eines ideellen bzw. strukturellen Wandels im städtischen Hilfesystem für Menschen m. B. aufzeigen? 3. Welche Merkmale des paradigmatischen Wandels lassen sich in der Mainzer Wohnstruktur geltend machen? 4. Wie erleben Menschen m. B. aus der Stadt Mainz Selbstbestimmung und soziale Teilhabe? Wie wird die jeweilige Wohnsituation bewertet?
Im ersten Kapitel wird auf die allgemeine anthropologisch-funktionale Bedeutung des Wohnens eingegangen. Im Fokus steht dabei der Geltungsbereich für Menschen m. B.
Im zweiten Kapitel werden die bisher etablierten Wohnformen für Menschen m. B. thematisiert. Die historische Skizzierung von Wohn- und Lebensverhältnissen wird durch die jeweiligen paradigmatischen Merkmale ergänzt.
Im dritten Kapitel folgt ein theoretischer Exkurs zum Thema Selbstbestimmung. Hier werden die begriffliche und anthropologisch-funktionale Bedeutung sowie der Bezug zu Menschen m. B. in drei Unterkapiteln angeführt.
Das vierte Kapitel thematisiert Selbstbestimmung als professionelles Paradigma der allgemeinen Behindertenhilfe auf ideeller und struktureller Ebene.
Im fünften Kapitel werden innovative Ansätze selbstbestimmter und sozial-partizipierender Wohnformen gesondert und nachfolgend auch kritisch betrachtet.
Im sechsten Kapitel werden Strukturen bestehender Wohnangebote des allg. Behindertenhilfesystems anhand drei wesentlicher Grundformen in einem allgemeinen „Wohnformkatalog“ zusammengefasst.
Das siebte Kapitel beinhaltet eine nähergehende Erfassung der strukturellen Bedingungen des Mainzer Behindertenhilfesystems, v.a. im Hinblick auf konkrete Wohnangebote.
Das achte Kapitel widmet sich ergänzend zum vorrangehenden Kapitel der Perspektive der Betroffenen selbst, anhand einer konkreten empirischen Erhebung.
Abschließend werden im neunten Kapitel die Ergebnisse der empirischen Untersuchung in einem generellen Rückbezug auf die in dieser Arbeit getätigten Aussagen thematisiert.
Gliederung
Einleitung
1. Der (behinderte) Mensch und das Wohnen
1.1. Was heißt „ wohnen “? Zur anthropologischen Bedeutung
1.2. Dürfen Menschen mit Behinderung wohnen? Zum aktuellen Rechtsstand
1.3. Können Menschen mit Behinderung wohnen? Zum aktuellen Wohnressourcenpotential
2. Das „traditionelle“ Wohnen behinderter Menschen
2.1. Die Bedeutung des „Traditionellen“
2.2. Das Normalisierungsprinzip
2.3. Wohnverhältnisse und Lebensbedingungen
3. Exkurs: Selbstbestimmung
3.1. Was heißt Selbstbestimmung? Eine theoretische Analyse
3.2. Behindert-Sein und Selbstbestimmung – ein paradoxes Verhältnis?
3.3. Das Paradigma Selbstbestimmung
4. Selbstbestimmung als Leitprinzip in Theorie und Praxis der Behindertenhilfe
4.1. Das (neue) Professionsverständnis
4.2. Die Dimensionen Arbeit, Freizeit, Wohnen
4.3. Selbstbestimmt Wohnen – strukturelle Rahmenbedingungen
5. Impulse innovativer Wohn- und Lebensformen für Menschen mit Behinderung
5.1. „Supported Living“ – Wohnen mit Assistenz
5.2. „Community Care“ – Gemeindeintegriertes Wohnen
5.3. Unterstützungsmanagement
5.4. Soziale Netzwerkarbeit
5.5. Möglichkeiten und Grenzen inklusiver und selbstbestimmter Wohnkonzepte
6. Wohnformen des Behindertenhilfesystems im Überblick
6.1. Einrichtungsgebundenes Wohnen (Wohnstätte)
6.2. Betreutes Wohnen in der Gruppe
6.3. Wohnen in der eigenen Wohnung mit Assistenz
7. Die aktuelle Wohnressourcenlandschaft der Mainzer Behindertenhilfe
7.1. Die Stadt Mainz und ihre Bürger (mit Behinderung)
7.2. Strukturprofile ausgewählter Wohnangebote der Mainzer Behindertenhilfe
8. Soziale Teilhabe und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung in Mainz aus Sicht der Betroffenen
8.1. Intention und Ziel der Forschung
8.2. Durchführung der Forschung
8.3. Darstellung des Datenmaterials
8.4. Interpretative Auswertung des Datenmaterials
8.5. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
9. Resümee
10. Literatur- und Quellenverzeichnis
Einführung
Die vorliegende Arbeit behandelt im Allgemeinen den Themenkomplex des Wohnens von Menschen mit Behinderung in Bezug auf Selbstbestimmung und soziale Teilhabe. Der Bezugsaspekt des Wohnens orientiert sich dabei an die wesentlichen Wohnangebotsformen der allgemeinen Behindertenhilfe: dem stationären Wohnen, dem Betreuten Wohnen in der Gruppe, sowie dem Einzelwohnen mit Assistenz. Im Fokus stehen dabei die Aspekte von Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe als professionelle Leitlinien im gängigen System der Behindertenhilfe. Neben den genannten Wohnformen wird auch hinsichtlich des Faktors „Menschen mit Behinderung“ eine übergreifende Bedeutung verwendet. Somit stehen im Interesse dieser Arbeit Menschen mit Behinderung als Nutzer der genannten Wohnformen im bestehenden Behindertenhilfesystem unter den Aspekten von Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe. Aufgrund des implizit weitreichenden Bedeutungszusammenhangs dieser Formulierung ist der leitenden Thematik ein einschränkender Faktor hinzuzufügen. Diesen Aspekt bezeichnet die räumliche Begrenzung im Titel der Arbeit, namentlich mit dem Stadtgebiet Mainz. Des Weiteren ist eine zeitliche Einschränkung zu verzeichnen, welche analog mit dem Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit einhergeht. Unter der Berücksichtigung dieser Aspekte ist dem Titel – Selbstbestimmt Wohnen in Mainz – folgende Formulierung gedanklich unter zu ordnen: eine strukturelle Analyse aktuell bestehender Wohnangebotsressourcen für Menschen mit Behinderung nach den Leitprinzipien von Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe im Einzugsgebiet der Stadt Mainz.
Gerade die benannten Prinzipien Selbstbestimmung und soziale Teilhabe gelten zurzeit hinsichtlich des professionellen Entwicklungstrends der Behindertenhilfe als dominierende und maßgebende Leitlinien im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Der Orientierung an den genannten Prinzipien wohnt dabei eine ganzheitliche und mehrdimensionale Wirkung inne, wodurch ein behinderungsübergreifender Bedeutungszusammenhang konstatiert werden kann. Im Kontext eines dementsprechend gearteten strukturellen und paradigmatischen Wandels innerhalb der professionellen Behindertenhilfe erfahren diesbezüglich auch die (bisher) bestehenden Wohnformstrukturen für Menschen mit Behinderung eine umfassende Entwicklungstendenz. Neben Trägerschaften, Menschen mit Behinderung selbst, sowie betroffene Angehörige, zeichnen sich weitere Akteure des benannten Wandlungsprozesses v.a. im Kontext der Regionalisierung und Kommunalisierung ab. So lassen sich primär Städte und Gemeinden als potentielle Wegbereiter sozialpolitischer Innovationen anführen.
In der vorliegenden Arbeit werden all diese Faktoren für das Stadtgebiet Mainz anhand des leitenden Analysebegriffs thematisiert. Das Hauptforschungsziel ist dabei, mit dem paradigmatischen Hintergrund von Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe eine faktische Verortung des Entwicklungsstandes der Mainzer Behindertenhilfe in Bezug auf die konkret gegebenen Wohnangebotsstrukturen für Menschen mit Behinderung zu formulieren. Dabei bilden folgende Fragestellungen den Rahmen des leitenden Forschungsinteresses:
- Wie ist die Wohnressourcenlandschaft für Menschen mit Behinderung im Stadtgebiet Mainz quantitativ und qualitativ beschaffen? Welche Wohnformen dominieren?
- Welche sozialpolitischen Maßnahmen lassen sich zu Gunsten eines ideellen bzw. strukturellen Wandels im städtischen Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung aufzeigen?
- Welche Merkmale des paradigmatischen Wandels lassen sich im Mainzer Wohnformsystem der Behindertenhilfe geltend machen? Inwieweit lässt sich der Professionalisierungstrend hinsichtlich der Leitprinzipien Selbstbestimmung und soziale Teilhabe anhand der regionalen Träger- und Angebotsstruktur vorweisen?
- Inwieweit unterscheidet sich die subjektive Perspektive betroffener Personen von den Ergebnissen der strukturellen Analyse? Wie erleben Menschen mit Behinderung aus der Stadt Mainz Selbstbestimmung und soziale Teilhabe? Wie bewerten Menschen mit Behinderung aus der Stadt Mainz ihre jeweilige Wohnsituation?
Zur Beantwortung dieser forschungsleitenden Fragen bedarf es, neben der Verknüpfung von unterschiedlichen Betrachtungsebenen hinsichtlich der gegebenen Wirklichkeitsverhältnisse, v.a. einer elementar-theoretischen Fundierung der relevanten Hauptaspekte in den genannten Fragestellungen. Somit gilt es, das essentielle Bedeutungsspektrum der leitenden Forschungsfragen anhand folgender Punkte zunächst zu erörtern:
- Die anthropologisch-funktionale Bedeutung des Wohnens
- Die anthropologisch-funktionale Bedeutung von Selbstbestimmung
- Paradigmen und Strukturen des allgemeinen Behindertenhilfesystems
- Gängige Wohnformen des allgemeinen Behindertenhilfesystems
- Der paradigmatische Wandel in Bezug auf die allgemeine Behindertenhilfe
- Der paradigmatische Wandel in Bezug auf Wohnformen der Behindertenhilfe
Angesichts dieser relevanten Aspekte lässt sich bei einer diesbezüglichen Thematisierung ein adäquater theoretischer Rahmen erarbeiten, anhand dessen Erkenntnisstruktur die oben aufgeführten Forschungsfragen an Gehalt gewinnen. Gleichzeitig stellen die angeführten Erörterungen einen prüfenden Anspruch an das Forschungsvorhaben selbst, woraus sich die sekundäre Funktion dieser Arbeit ableitet. Somit besitzt die vorliegende Forschungsarbeit neben der primären Analyse der Mainzer Wohnangebotsstruktur auch die Absicht, die elementar-theoretischen Erkenntnisse in allgemein hypothesenüberprüfender Weise zu thematisieren.
Somit ergibt sich für den Aufbau dieser Arbeit die folgende Vorgehensweise:
Mit grundlegender Relevanz für das gewählte Thema manifestiert sich im Aspekt des Wohnens ein gleichsam alltäglicher wie selbstverständlicher Charakter. Im ersten Kapitel wird daher auf die anthropologisch-funktionale Bedeutung des Wohnens eingegangen. Im Fokus der Ausführungen steht dabei insbesondere der Geltungsbereich der dargelegten Ausführungen für Menschen mit Behinderung.
Daran anknüpfend werden im zweiten Kapitel die bisher etablierten Wohnformen für Menschen mit Behinderung thematisiert. Neben der Skizzierung (historischer) Wohn- und Lebensverhältnisse stehen dabei auch die betreffenden paradigmatischen Merkmale der Behindertenhilfe im Fokus der Betrachtungen.
Die weitere Skizzierung des Entwicklungsprozesses der allgemeinen Behindertenhilfe wird im dritten Kapitel zunächst unterbrochen. Aufgrund des vorherigen Umrisses der allgemeinen Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, der zentralen Relevanz des Selbstbestimmungsparadigmas für die weitere Entwicklung der professionellen Behindertenhilfe, sowie aufgrund der komplexen Begriffsstruktur selbst folgt an dieser Stelle ein theoretischer Exkurs zum Thema Selbstbestimmung. Die begriffliche und anthropologisch-funktionale Bedeutung von Selbstbestimmung, sowie der Bezug zu Menschen mit Behinderung werden dabei in drei Unterkapiteln angeführt.
Das vierte Kapitel greift die Skizzierung der Entwicklungslinie im professionellen Umgang mit Menschen mit Behinderung wieder auf. Dabei wird eine umfassende Beschreibung von Selbstbestimmung als professionelles Paradigma auf ideeller und struktureller Ebene, sowie in Bezug auf relevante Arbeitsfelder der allgemeinen Behindertenhilfe vollzogen.
Aufgrund des leitenden Forschungsthemas werden im fünften Kapitel bestehende Ansätze innovativer Wohnformen gesondert betrachtet. Bei der konzeptuellen Beschreibung liegt der Fokus der Ausführungen v.a. auf das gegebene Potential der strukturellen Möglichkeiten zu selbstbestimmter Lebensführung und sozialer Teilhabe. Ebenso wird auf eine kritische Betrachtung der Ansätze nicht verzichtet.
Im sechsten Kapitel werden stark subsumierend die Strukturen bestehender Wohnangebote des Behindertenhilfesystems in drei wesentliche Grundformen zusammengefasst. Aufgrund der so möglichen Konstatierung jeweils spezifischer Charakteristika lässt sich ein allgemeiner „Wohnformkatalog“ erarbeiten, in welchem die wesentlichen Merkmale der jeweiligen Wohnangebote in übersichtlicher Form aufbereitet dargestellt werden kann.
Das siebte Kapitel beinhaltet zunächst eine nähergehende Erfassung der strukturellen Bedingungen des Mainzer Unterstützungssystems. Neben dem allgemeinen Ressourcenpotential der Stadt Mainz wird dabei v.a. auf die wohnbezogenen Strukturen eingegangen. Die im vorherigen Kapitel erarbeitete Übersicht zu den Merkmalen bestehender Wohnformen aufgreifend, liefert dieses Kapitel eine strukturelle Analyse der städtischen Wohnangebotsstruktur für Menschen mit Behinderung.
Ergänzend zu den im vorherigen Kapitel dargelegten Ausführungen zum gegebenen „Ist-Stand“ der Mainzer Unterstützungsstruktur im Bereich des Wohnens, widmet sich das achte Kapitel ausschließlich der Perspektive der Betroffenen selbst, mittels einer konkreten empirischen Erhebung. Um den Aussagen des vorherigen Kapitels überprüfend nachzugehen bezieht sich das betreffende Forschungsinteresse dabei v.a. auf die Faktoren von Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe.
Im abschließenden, neunten Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung in einem generellen Rückbezug auf die in dieser Arbeit getätigten Aussagen thematisiert. Neben den so gewonnenen Aussagen bezüglich der strukturellen Analyse der Mainzer Wohnangebotsformen besteht somit auch ein gewisses Potential der empirischen Bestätigung des theoretischen Hintergrunds dieser Arbeit.
1. Der (behinderte) Mensch und das Wohnen
Das vorliegende Kapitel beinhaltet die theoretische Auseinandersetzung mit der elementaren Grundbedeutung des allgemeinen menschlichen Wohnverhaltens. Der Schwerpunkt der Betrachtungen liegt dabei zunächst auf der anthropologisch-funktionalen Relevanz des Wohnens, wobei der direkte Zusammenhang mit der Wesensbestimmung des Menschen verdeutlicht wird. Anhand der diesbezüglich dargelegten Ausführungen gilt es anschließend der Frage nachzugehen, inwieweit die anthropologisch-funktionale Bedeutung des Wohnens bei Menschen mit Behinderung spezifischen Bedingungen unterworfen ist.
1.1. Was heißt „ wohnen “? Zur anthropologischen Bedeutung
Ein jeder Mensch wohnt. So trivial und nichtssagend diese Aussage erscheint, so beinhaltet sie einen Aspekt von höchst anthropologischem Gehalt; die existentiell fundamentale Basis menschlichen Daseins, dem Wohnen.
Der philosophische Bedeutungsgehalt des „ homo habitans “ (Haese/Prawitt-Haese 1999, S. 5) – dem „bewohnenden Menschen“ – legt sich u.a. in Otto Friedrich Bollnows Schriften dar (vgl. Bollnow 2010). Nach Bollnow erlangt das Bewohnen eines konkreten Raumes als „ eine Grundverfassung des menschlichen Lebens “ (Bollnow 1984, S. 123) das elementare Merkmal eines notwendigen Kriteriums für die Existenz menschlichen Daseins selbst (ebd.). Demnach beinhaltet das Wohnen eben jene räumliche Bezug- oder Anlaufstelle im Leben des Menschen (individuell wie auch kollektiv), ohne die Letzterer nur unter konsequenter Gefährdung seines Selbst Bestand hätte (ebd.). Im Wohnen liegt in diesem Sinne also die Funktion, als konkreter räumlich-materieller Mittelpunkt im Leben des Menschen, ganzheitlich konstituierend und stabilisierend auf eben diesen zu wirken.
Worin nun genau diese hohe anthropologische Bedeutung im Wohnen liegt, lässt sich in Anlehnung an Peter Weichhart (vgl. Weichhart 2004) in plastischerer Weise wie folgt verdeutlichen: nach Weichhart ist primär die unmittelbare Gewährleistung von Sicherheit als Grundfunktion des menschlichen Wohnverhaltens hervorzuheben (ebd.). In einem konkret physisch-materiellem Sinne bietet die Wohnung eben Schutz vor „feindlichen“ Natur- und Umweltfaktoren, wie etwa Unwettern, aber auch vor Tieren und anderen (fremden) Menschen (ebd.). Als Resultat dieses ganzheitlichen Sicherheitsaspekts bezeichnet der Wohnort einen konkreten Raum des Privaten (ebd.). Menschliche Intimität ergibt sich somit unmittelbar aus dem gegebenen Rahmen des Wohnens. Die sichere Verwahrung von persönlichen, alltäglichen und lebensnotwendigen Gegenständen bezeichnet ein weiteres Merkmal privater Existenzweise, ermöglicht durch das Bewohnen eines beständigen Zufluchtsorts (ebd.). Anhand dessen zieht Weichhart den Schluss, dass das Wohnen eine unmittelbar existenzielle Grundfunktion für das menschliche Dasein erfüllt (ebd.). Den zentralen, anthropologischen Bedeutungswert des Wohnens verdeutlicht Weichhart anhand des sozialen Problems der gesellschaftlichen Abseitsstellung von Menschen ohne (festen) Wohnsitz wie folgt:
„Ohne der Inanspruchnahme […] ist ein „normales“ Leben, das den Gegebenheiten, Konventionen und Normen unseres Gesellschaftssystems entspricht, gar nicht möglich. Keine Wohnung zu haben, nicht sesshaft zu sein, bedeutet in unserem Gesellschaftssystem, zur Gruppe der sozial Deklassierten zu gehören, Obdachlosigkeit ist ein Kennzeichen der niedrigsten Position in der sozialen Rangordnung, also der Parias.“
(Weichhart 2004)
Im Zusammenhang mit der beschriebenen Primärfunktion des Wohnens – also die Erfüllung des menschlichen Sicherheitsbedürfnisses – lassen sich nun weitere Funktionsaspekte herleiten. So bietet etwa das langfristige Be-wohnen, aufbauend auf der konkreten, physischen Schutzfunktion, auch Elemente psychischer Erholung und Stabilität. Der positiv gewertete Bezug zum Zuhause wird dabei klar über die bloße Befriedigung lediglich physischer Bedürfnisse hinaus erweitert. Aus der akuten Zufluchtsstätte wird eine beständige Zone der Sicherheit; aus Schutz wird Stabilität, aus Stabilität wächst Vertrautheit, Vertrautheit führt zu Geborgenheit. Monika Seifert verknüpft in diesem Sinne den Begriff des Wohnens mit den im ganzheitlichen Sinne angewandten Begriff des Wohlbefindens (vgl. Seifert 2006, S. 376). In ähnlicher Weise formuliert auch Theodor Thesing die anthropologische Wertigkeit des Wohnens gemäß den grundlegenden Überlegungen Bollnows:
„Wohnen ist somit nicht nur einfach ein Sein, sondern ist verbunden mit einem Ort, an den der Mensch sich gehörig fühlt. Wohnen ist nicht eine beliebige Tätigkeit, sondern ist eine Wesensbestimmung des Menschen [...].“
(Thesing 1993, S. 27)
Daran anknüpfend ergibt sich deutlich die enge Verbindung von Wohnen und Mensch-Sein. Dem Wohnen ist demnach eine regelrecht persönlichkeitsbildende und identitätsstiftende Wirkung zuzuordnen – auch in einem selbstbestimmenden und autonomen Sinne. Dabei ist das Bild der Wohnung als „ Standort personaler Existenz “ (Weichhart 2004) gleichbedeutend zur Wohnung als „Spiegel“, oder „Visitenkarte“ des Bewohnenden. Aus den angeführten Erläuterungen heraus ergibt sich aus dem hohen Wert der Wohnung als privater Rückzugsort somit auch die individuell-persönliche Gestaltung des konkreten Be-Wohnens. Ob nun das Freizeitverhalten, die Befriedigung instinktiver Grundbedürfnisse, oder das soziale Miteinander: die Aktivitäten in der Wohnung sind vielfältig, der dort verbrachte Zeitraum im Leben eines Menschen hoch (ebd.). Weichhart folgert aus dieser zeitintensiven und multiplen Nutzung der Wohnung, dass diese als „ so etwas wie ein Schaufenster der Seele “ (ebd.) zu deuten ist. Das Wohnen erfüllt eine soziale Darstellungsfunktion. Die persönliche Ausprägung der Inneneinrichtung etwa liefert einem Außenstehenden wesentliche Informationen über den Bewohner, wie bspw. den jeweiligen sozialen Status.
Daran anknüpfend lässt sich eine weitere, gleichsam fundamentale Funktionsebene des Wohnens hervorheben: die Wohnung als identitätszeugender Aspekt für den außenstehenden Anderen. Die informelle Übertragung bspw. bzgl. des Status impliziert basale Strukturen der sozialen Interaktion selbst. Somit ist der Funktionalität des Wohnens der Aspekt des wohnraumgebundenen und interpersonellen also sozialen Miteinanders hinzuzufügen:
„Wohnen beinhaltet die Gewöhnung an den Raum und die Wohnung. Der Mensch findet Gefallen daran und hält sich gern in diesen Räumen auf. Das Wohnen in den Räumen vermittelt dem Menschen Sicherheit und macht Beziehung möglich. Raum bietet Gelegenheit zum Gernhaben von Menschen.“
(Thesing 1993, S. 27)
Thesing setzt dem potentiellen gemeinschaftlichen Geschehen die jeweils persönlich bestehende Verbindung der einzelnen Akteure zur Wohnung voraus. So implementiert die personale Stabilität durch den Akt des Wohnens gleichzeitig das Potential eines kommunikativen Zusammenlebens. In diesem Sinne ist der Mensch als soziales Wesen ohne die Möglichkeit des sicherheitsstiftenden Wohnens gar nicht denkbar.
Aus den angeführten Überlegungen heraus lassen sich nun folgende relevante Funktionsaspekte für die Bedeutung des Wohnens zusammenfassend anführen:
- Sicherheit und Schutz: Wohnen fungiert primär als Schutzzone, sowohl vor physischen, als auch vor psychischen Fremdfaktoren. Die innere „Haltlosigkeit“ und das „Sich-Verlieren“ sind dabei dem wohnraumgebundenen Zustand des „Zu-Ruhe-Kommens“ gegenübergestellt.
- Stabilität der Persönlichkeit: Die Befriedigung primärer Sicherheitsbedürfnisse durch einen konkreten Wohnraum wirkt stabilisierend und identitätsstiftend. Als kontinuierliches Zentrum des persönlichen Lebens impliziert das Wohnen wesentliche Möglichkeiten zur autonomen Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung.
- Sozialität: Wohnen ermöglicht als Schauplatz selbstgewählter sozialer Interaktionen wesentliche Elemente des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Die Befriedigung physischer und psychischer Sicherheitsbedürfnisse besitzt dabei eine prädestinierend-konstitutive Rolle. Die Wohnung fungiert auf der sozialen Ebene weiterhin als Projektionsfläche für die Darstellung des Selbst sowie des eigenen Status im sozialen Kontext.
In Anbetracht der aufgeführten Punkte lässt sich der wesentliche Fokus des umfangreichen Bedeutungsspektrums des Wohnens konkret auf die Einheit von physischer, psychischer und sozialer Funktionsebene legen (vgl. Weinwurm-Krause 1995, S. 11). Durch die ganzheitliche Wirkungsweise dieser tri-dimensionalen Konstellation auf den Menschen besitzt das Wohnen also einen grundlegend bedeutungsvollen Stellenwert für die menschliche Existenz.
1.2. Dürfen Menschen mit Behinderung wohnen? Zum aktuellen Rechtsstand
Gemäß den oben dargelegten Erläuterungen stellt das Be-Wohnen ein allgemeines und elementares Grundbedürfnis der menschlichen Existenzweise dar. Dass dabei Menschen mit Behinderung keine Ausnahme bilden, scheint allein die Fachliteratur zu bestätigen. In dieser dominiert aktuell ein Menschenbild der Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Emanzipation, auch in Bezug auf die Wohnverhältnisse von Menschen mit Behinderung. Nach Georg Theunissen etwa „ muss grundsätzlich anerkannt werden, dass Menschen mit Behinderung ein Recht auf ein eigenes Zuhause […] und eine selbstbestimmte Lebensgestaltung haben. “ (Theunissen 2009b, S. 391). Bei Monika Seifert heißt es schlicht: „ Menschen mit geistiger Behinderung haben die gleichen Wohnbedürfnisse wie Menschen ohne Behinderung “ (Seifert 2006, S. 376). Rudi Sack setzt diesen Aspekt in seinen Darlegungen sogar schon voraus und verzichtet dabei auf die explizite Erwähnung einer postulierenden Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung (vgl. Sack 2009, S. 193f).
Allerdings ist an dieser Stelle zu beachten, dass eine solche anthropologische Betrachtungsweise in ihrer Formulierung und selbst in Anbetracht ihres fundierten Grundcharakters in gewissem Maße vom gesellschaftlichen und historischen Kontext abhängig zu machen ist (vgl. Schlummer/Schütte 2006, S. 16).
„ So haben die in unserer Kultur dominierenden Menschenbilder oftmals Menschen mit schweren geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behinderungen quasi als menschgewordene Verkörperungen der Unvernunft aufgefasst und sie a priori als Mängel-, Minder oder Minusvarianten des Menschen klassifiziert. “
(Dederich 2006, S. 548)
Gleichzeitig gilt als funktionaler Aspekt solcher Menschenbilder, dass sie als End- und Ausgangspunkt für den grundlegenden gesellschaftlichen Umgang – insbesondere auch für die Arbeit – mit Menschen mit Behinderung bestehen (ebd., S. 549). In der professionellen Behindertenhilfe werden im wesentlichen Maße Bezüge zum anthropologischen Hintergrund geführt – nicht zuletzt aus legitimierenden Gründen – und sprechen somit der ethisch-normativen Fachdiskussion sowie -reflexion einen notwendigen Charakter zu (ebd., S. 542f).
Dass dennoch eine Diskrepanz zwischen grundlegenden anthropologischen Prinzipien und faktischen Gegebenheiten vorherrschen kann (vgl. Hähner 2009b, S. 43f), deckt sich dabei mit dem politisch-inhaltlichen Anspruch diverser Selbstvertretungsgruppen von Menschen mit Behinderung (vgl. Göthling/Schirbort/Theunissen 2006, S. 560 ff). Nach Art der „Empowerment-Prinzipien“ amerikanischer Bürgerrechtsbewegungen (vgl. Kulig/Theunissen 2006, S. 243) treten Menschen mit Behinderung eigenverantwortlich gegen gesellschaftliche Formen von Behindertenfeindlichkeit und für die rechtliche Gleichbehandlung ein; etwa für die Abwendung der sog. „ Defizitorientierung “ (ebd., S. 244) in Hinsicht auf Menschen mit Behinderung, auch in der professionellen Behindertenarbeit selbst. Der emanzipierende Charakter solcher Gruppen zeugt dabei u.a. von einer potentiell vorherrschenden Ungleichheit im gesamtgesellschaftlichen Umgang gegenüber Menschen mit Behinderung.
Im direkten Vergleich zwischen vielen Vertretern der professionellen Fachrichtung und politischen Selbstvertretungsgruppen scheint derzeit ein breiter Konsens bezüglich der anthropologischen Werte-Fundierung vorzuherrschen. So stimmen Autoren wie Georg Theunissen nahezu gänzlich mit den zentralen Standpunkten behinderungspolitischer Selbstvertretungsgruppen überein (vgl. Kulig/Theunissen 2006, S. 237ff, und Göthling/Schirbort/Theunissen 2006, S. 558ff). Nach Ulrich Hähner bezeichnet dies nicht zuletzt einen zu begrüßenden Entwicklungsfortschritt innerhalb des professionellen und – im langfristigen Kontext – auch gesellschaftlichen Umgangs mit Menschen mit Behinderung (Hähner 2009b, S. 44f). In Bezug auf das Thema Wohnen ist somit ganz konkret die Einheitlichkeit des emanzipierenden Rufes und der fachlichen Forderung nach einer Anpassung bestehender Wohnformen für Menschen mit Behinderung an die grundlegend menschlichen Wohnbedürfnisse hervorzuheben. (Seifert 2006, S. 391).
Dass im Dezember 2006 diese Forderungen letztlich als konkrete Punkte in die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aufgenommen worden und seit Mai 2008 in Kraft getreten sind (vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 2012), zeugt von einer globalen gesellschaftspolitischen Aufmerksamkeit für die Belange von Menschen mit Behinderung, und darüber hinaus von der Bereitschaft, das emanzipierende, gleichberechtigte Menschenbild anzuerkennen und gesamtgesellschaftlich zu etablieren. Dabei bekleidet die UN-Behindertenrechtskonvention einerseits eine „ rechtsverbindliche Vorgabe und bietet zum anderen Leitlinien zur Umsetzung der Konvention “ (Spörke 2011, S. 8) und lässt sich zugleich als „ Chance und Auftrag für die Soziale Arbeit “ (ebd., S. 6) interpretieren. So wird bspw. Menschen mit Behinderung im Artikel 19 des internationalen Abkommens die grundsätzliche Gleichberechtigung für den Lebensbereich Wohnen anerkannt (vgl. Referat für Reden und Öffentlichkeitsarbeit 2010, S. 24).
Basierend auf das Recht der Selbstbestimmung und der gesellschaftlichen Teilhabe haben sich die beteiligten Staaten in diesem Kontext v.a. auf folgende Maßnahmen verpflichtet (vgl. ebd.):
- Gewährleistung der Wahl- und Entscheidungsfreiheit für Menschen mit Behinderung bezüglich des Aufenthaltsorts, sowie der Mitwohnenden
- Entpflichtung von Menschen mit Behinderung zum Leben in gesonderten Wohnformen
- Gewährleistung von behinderungsspezifischen Unterstützungsleistungen, sowie die Ermöglichung sozialer Teilhabe und Maßnahmen zur Verhinderung von Isolation
- Gewährleistung des Zugangs allgemeiner Dienstleistungen und Einrichtungen (u.a. durch die Einführung flächendeckender Barrierefreiheit, der Einfachen Sprache, etc.)
Betrachtet man die aufgeführten Punkte der UN-Behindertenrechtskonvention als Teilaspekte eines umfangreichen Anpassungs- bzw. Gleichstellungsprozesses, so wird deutlich, dass als Ausgangspunkt die Annahme eines allgemein gegebenen Standards in Bezug auf die funktionale Erfüllung vorhandener Wohnbedingungen – zumindest bei Menschen ohne Behinderung – dient. Die tridimensionale Funktionsweise des Wohnens gilt somit als konkreter, anthropologisch fundierter Richtwert. Gleichzeitig zeugt die explizite Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention von einer tatsächlich vorherrschenden Ungleichheit bezüglich der gegebenen Wohnverhältnisse. Somit stellt sich die Frage, inwieweit die Erfüllung der funktionalen Ebenen des Wohnens auch für Menschen mit Behinderung als selbstverständlich gelten kann.
1.3. Können Menschen mit Behinderung wohnen? Zum Wohnressourcenpotential
In Anbetracht des allgemeinen, grund-menschlichen Bedürfnisses des Wohnens und dem ebenfalls grundsätzlichen Postulat einer allgemeinen Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung aus fachlicher, rechtlicher, und politischer Sicht, erscheint die tatsächliche Gegebenheit geeigneter Wohnformen für Menschen mit Behinderung in der BRD nur vereinzelt etabliert zu sein. Einen erheblichen Teil konkreter Wohnplätze für Menschen mit Behinderung stellen im bundesdeutschen Raum (Groß-) Einrichtungen, wie Wohnstätten oder den sog. Komplexeinrichtungen mit bis zu 500 Plätzen (vgl. Seifert 2006, S. 379).
Nach Jörg Dennhöfer implizieren solche institutionellen Großeinrichtungen ein breites Spektrum spezifischer Problemaspekte für die Bewohner: (1) Probleme mit dem Betreuungspersonal, (2) Probleme mit der institutionellen Struktur, (3) Probleme mit Bewohnern, (4) Probleme mit der sozial-kommunikativen, gesellschaftlichen Position (bspw. Stigmatisierung), sowie (5) Probleme bezüglich der Lage der Einrichtung und der Infrastruktur der Umgebung (vgl. Dennhöfer 2004, S. 351ff). Auffallend sind in der näheren Betrachtung dieser Problemaspekte folgende Punkte: soziale Abhängigkeit, mangelndes Verständnis, Verletzung der Intimsphäre, intersoziale Unbeständigkeit durch Personalwechsel, sowie ein allgemein fremdbestimmender Umgang (ausgehend vom betreuenden Personal); außerdem Elemente der Fremdbestimmung durch strukturellen Zwang, bspw. in Form mangelnder Möglichkeiten zur Mitbestimmung (etwa bei der Auswahl neuer Mitbewohner), aber auch durch eine isolierende Lage der Einrichtung („am Stadtrand“) und mangelnder Verkehrsanbindung (vgl. ebd.). In Bezug auf die primären Funktionen des Wohnens scheint gerade den erstgenannten Punkten eine diametral ausgerichtete, dysfunktionale Auswirkung inne zu wohnen. Das Gelingen von basalen Wohnfunktionen – bspw. die Stabilisierung der Persönlichkeit, oder die individuelle Selbstverwirklichung – ist bei einer parallelen Gefährdung etwa der Intim- oder Privatsphäre nach den genannten Bedingungen stark in Frage zu stellen.
In der Auseinandersetzung mit den Grundfunktionen des Wohnens nach Thesing zieht Rudi Sack hierbei den Schluss, dass sich v.a. einrichtungsgebundene Wohnformen für Menschen mit Behinderung als ungeeignet zeigen, „ die für den Menschen elementaren Funktionen des Wohnens zu erfüllen “ (Sack 2009, S. 195). In Abgrenzung zu diesen Wohnformen postuliert er im Kontext einer allgemeinen Deinstitutionalisierung einen emanzipierenden Ansatz, der u.a. einen überschaubaren, kleinen Lebensraum als notwendiges Kriterium aufweist (vgl. ebd., S. 200f). Allein die Wohnformgröße, gemessen an der Zahl der Bewohner, beinhaltet demnach schon eine gewisse Aussagekraft über die jeweiligen Wohnbedingungen und gleichbedeutend über die Gegebenheit funktionaler Aspekte des Wohnens.
In Bezug auf die aufgeführten Problembereiche großstationärer Wohnformen für Menschen mit Behinderung, verdeutlicht dies der Begriff der Lebensqualität als forschungsrelevantes und handlungsweisendes Konzept (vgl. Schäfers 2008, S. 27ff). Dieser Ansatz geht zum einen von gewissen Standards bzw. humanitäer Niveaus allgemeiner Lebensbedingungen aus, greift jedoch zum anderen die Heterogenität individueller Wertzuschreibungen auf. Nach Monika Seifert verbindet der konzeptuelle Lebensqualitätsansatz somit objektive Wohn- und Lebensverhältnisse mit der Befriedigung subjektiver Bedürfnisse konkret anhand folgender Punkte (Seifert 2006, S. 383):
- physisches und materielles Wohlbefinden
- emotionales Wohlbefinden
- persönliche Entwicklung
- Selbstbestimmung
- zwischenmenschliche Beziehungen
- soziale Inklusion
Setzt man diese Punkte nun in einen Vergleich mit den vorherigen Ausführungen, so ergibt sich eine hohe Affinität zwischen den Primärfunktionen des Wohnens, dem konzeptuellen Lebensqualitätsansatz und den konkreten Richtlinien aus der UN-Behindertenrechtskonvention (siehe oben). Gleichzeitig beschreiben die von Dennhöfer formulierten Problemaspekte in vielerlei Hinsicht einen gegenteiligen Ist-Zustand im institutionellen Wohnen. Dass diese zudem als die vorherrschende Wohnform für Menschen mit Behinderung gilt (vgl. Theunissen 2010a, S. 63), ist nach Georg Theunissen vor allem auf drei wesentliche Punkte zurückzuführen (vgl. Theunissen 2009b, S. 377). Demnach zieht (1) die strukturelle Etablierung von Wohnheimen seitens der Einrichtungsträger ein nur geringes Interesses an der Entwicklung alternativer Wohnformen nach sich; dies ist (2) u.a. auf eine defizitäre Perspektive auf Menschen mit Behinderung zurückzuführen: „ Menschen mit schweren (kognitiven) Beeinträchtigungen gehören demnach ins Heim “ (ebd.). (3) Demnach mangelt es schlichtweg flächendeckend an alternativen Wohnangeboten, sodass Menschen mit Behinderung kaum eine andere Möglichkeit als der Weg in die Institution bleibt.
An dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass erstens ein gleichgestelltes Wohnen von Menschen mit Behinderung auf die anthropologische Funktionswirkung des Wohnens selbst zurückzuführen ist. Nach den Maßstäben der implizit-grundmenschlichen Wohnfunktionalität unterscheiden sich die Wohnbedürfnisse von Menschen mit und ohne Behinderung in ihrer allgemeinen Bedeutung nicht. Zweitens scheinen die Möglichkeiten zur Befriedigung dieser Bedürfnisse im Sinne gesellschaftlicher Gleichberechtigung und Teilhabe, als auch nach objektiven Maßstäben des Konzepts der Lebensqualität in stationären und institutionellen Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung nicht, oder nur beschränkt gegeben zu sein. Letztlich herrschen nach wie vor einrichtungsgebundene Wohnformen in dominierend hoher Anzahl vor, sodass von einer tatsächlich gegebenen, gesellschaftlich etablierten Gleichstellung bezüglich der Wohnverhältnisse von Menschen mit und ohne Behinderung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention kaum die Rede sein kann.
2. Das „traditionelle“ Wohnen behinderter Menschen
Bevor ich mich nun der offen gebliebenen Fragestellung des letzten Abschnitts widme, nämlich inwiefern Menschen mit Behinderung wohnen können, wenn nicht in stationären Einrichtungen, werde ich im folgenden Kapitel den allgemeinen Entwicklungsprozess des bundesdeutschen Behindertenhilfesystems mit einem besonderen Augenmerk auf die spezifischen Wohnformen skizzieren. Anhand dessen lassen sich zum einen wesentliche Vorbedingungen für die aktuellen, deinstitutionalisierenden Wohnkonzepte darstellen und zum anderen die innovativ-charakteristischen Kernelemente handlungsweisender Maßstäbe, professioneller Qualität, sowie leitender Vorstellungen gerade in Abgrenzung zu den vorangegangen, einrichtungsgebundenen Wohnverhältnissen verdeutlichen.
2.1. Die Bedeutung des „Traditionellen“
Eine in der aktuellen Fachliteratur häufig zu findende, weitestgehend unbestimmte Formulierung ist der Begriff des „Traditionellen“ als ein gewisses Spezifikum bestehender Formen innerhalb der Behindertenhilfe (vgl. bspw. Theunissen 2010a, S. 60). In der im Folgenden angewandten Bedeutung ist er als eine allgemeine Bezeichnung für das bereits langjährig etablierte Behindertenhilfesystem und für maßgebliche Strömungen seit der Gründung der BRD zu verstehen. Durch diese Eingrenzung lassen sich darin nun in umfassender Weise ideell-, institutionell-, sowie konzeptionell-charakteristische Strukturen im systematisch-professionellen Umgang mit Menschen mit Behinderung der letzten Jahrzehnte subsumieren.
In der erwähnten Fachliteratur scheint das Attribut „traditionell“ sowohl als Vereinheitlichung des ausdifferenzierten Bezugsfeldes, als auch als verdeutlichende Abgrenzung von diesem seitens aktuell dominierender Professionstendenzen zu fungieren. Letztere scheinen dabei gerade in der kritischen Auseinandersetzung mit der „traditionellen“ Behindertenhilfe ein definierendes Entwicklungs- und Verwirklichungspotential der eigenen innovativen Ansätze vorzuweisen. So stehen inhaltlich konkretisierende Erläuterungen konzeptueller Innovationen meist im Kontext einer umfassenden Kritik an den Strukturen, Prinzipien, und Konzepten der „traditionellen“ Behindertenhilfe (vgl. bspw. Mattke 2004, S. 300). Letztlich zeugt dies von einer, auf paradigmatische Hintergründe zurückzuführenden Negativ-Zuschreibung diverser Teilaspekte des etablierten Behindertenhilfesystems (Theunissen 2010a, S. 60). In der weiteren terminologischen Verwendung des Begriffs „traditionelle“ Behindertenhilfe wird versucht, die benannte Negativ-Perspektive durch einen neutralen Fokus möglichst gering zu halten.
Nach Ulrich Hähner lassen sich für den qualitativen Gehalt des Begriffs der „traditionellen“ Behindertenhilfe allgemeine Charakteristika anhand der konkreten Ausprägung wesentlicher Spezifika darstellen. Für den spezifischen professionellen Umgang mit Menschen mit Behinderung lassen sich daran anknüpfend folgende Merkmale geltend machen (vgl. Hähner 2009b, S. 45):
- Verwahrung und/oder Förderung als handlungsweisende Leitbilder
- Ein defizitär-orientiertes Menschenbild; Menschen mit Behinderung als Patienten und/oder therapiebedürftige „Sonder-Menschen“
- Medizinisch-biologistische und/oder medizinisch-therapeutische Ausrichtung im beruflich-professionellen Selbstverständnis
- Pflege-, Schutz-, sowie Be- bzw. Verwahrungspraktiken und/oder Förderung bzw. Therapie als professionelle Handlungsweisen
- Großanstalten, psychiatrische Kliniken und/oder Sondereinrichtungen als Institutionen
Zu beachten ist hierbei, dass Hähner die aufgeführten Punkte als Teilaspekte von ganzheitlichen Entwicklungsstufen im Werdegang des Systems der Behindertenhilfe betrachtet. Er konstatiert im historischen Verlauf des professionellen Umgangs mit Menschen mit Behinderung ab der Gründung der BRD generell drei wesentliche, aufeinander aufbauende Entwicklungsschritte „ von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung “ (ebd., S. 25). Nach diesem Aspekt markiert die „traditionelle“ Behindertenhilfe in ihrer qualitativen Ausprägung eine Art Übergangsfunktion im voranschreitenden Wandlungsprozess des Behindertenhilfesystems und bezeichnet demnach eine entwicklungslogische Notwendigkeit (ebd.).
Eine ähnliche Einschätzung bezüglich der historischen Entwicklung der Behindertenhilfe legt auch Jörg Dennhöfer dar (vgl. Dennhöfer 2004, S. 345ff). Nach diesem folgt den anfänglichen Einrichtungsgründungen ein institutioneller Verwahrungsschub in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (ebd., S. 346). Die flächendeckende Verwahrung von Menschen mit Behinderung in psychiatrisch-klinischen Großanstalten gipfelte schließlich im katastrophalen Höhepunkt (oder besser: Tiefpunkt), nämlich der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ im Zuge der nationalsozialistischen Euthanasieaktionen (vgl. Brückner 2010, S. 126). Der nach Beendigung des zweiten Weltkrieges vollzogene Restaurationsprozess des Behindertenhilfesystems knüpfte vorrangig an die bereits gegebenen strukturellen Verhältnisse vor dem NS-Regime an, womit der verwahrende Charakter zunächst bestehen blieb (Hähner 2009b, S. 26). Die auf Ver- und Bewahrung zielenden Institutionen, Konzepte, sowie Leit- und Menschenbilder der Behindertenhilfe in den ersten Jahren der BRD lassen sich demgemäß auf die simple Aussage „ Behinderung und Anstaltsunterbringung waren Synonyme “ (ebd.) reduzieren.
Dass die Nachkriegszeit dennoch als „ eine Art ‚zweiter Geburt‘ “ (Lindmeier 2006, S. 41) der Behindertenhilfe gelten kann, liegt wohl nicht zuletzt an den (damals) höchst innovativen Gründungen diverser Elterninitiativen und Vereinen (Dennhöfer 2004, S. 346). Nach Bettina und Christian Lindmeier sind die zentralen Erfolge für die weitere Entwicklung der Behindertenhilfe, wie z. B. die Etablierung des Schulwesens auch für Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Lindmeier 2006, S. 42f), nicht zuletzt auch auf die Gründungen eben jener engagierter Elternvereinigungen der damaligen Zeit – wie bspw. der „ Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V. “ (vgl. ebd., S. 43) – zurück zu führen. Auch Hähner schreibt „ von einem großen Engagement “ (Hähner 2009b, S. 29) in Bezug auf die Gründung zahlreicher (bis dato neuartiger) Behinderteneinrichtungen in den 60iger bis 70iger Jahren des 20. Jahrhunderts (vgl. ebd.).
2.2. Das Normalisierungsprinzip
Als dominierendes Leitprinzip der professionellen Maßstäbe jener zeitgemäßen Strömungen ist der Begriff der „Normalisierung“ anzuführen:
„ In den 1950er und 1960er Jahren diente das Normalisierungsprinzip als bewusstes Anti-Dogma zur Beendigung früherer menschenunwürdiger Isolierung und Kasernierung in Großanstalten außerhalb der üblichen Wohngebiete. “
(Pitsch, Hans Jürgen 2006 S. 225)
Während zunächst die „Normalisierung“ der Lebensverhältnisse innerhalb von Familien (mit einem behinderten Kind) erfolgreich angestrebt wurde (vgl. Lindmeier 2006, S. 41), erweiterte sich das Prinzip schnell auf den Anspruch einer ganzheitlichen Wandlung wesentlicher Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung. Die grundlegende Maxime des Normalisierungsprinzips bildet dabei die rechtliche und ethische Gleichstellung des Menschen mit Behinderung mit dem „Normal-Bürger“ und parallel dazu die Akzeptanz behinderungsspezifischer Unterstützungsbedürfnisse (Pitsch 2006, S. 224). Anhand der Orientierung an der breiten „Norm“ gesellschaftsinterner Lebensverhältnisse lassen sich nun handlungsweisende Ansprüche im professionellen Umgang mit Menschen mit Behinderung herleiten. Dementsprechend wirkte sich die umfassende Orientierung an der „normalen“ Bevölkerung auf die Verwaltung des staatlichen Fürsorgesystems ebenso aus, wie auf die wesentlichen Wohn-, Arbeits- und Freizeitbedingungen von Menschen mit Behinderung (ebd., S. 225f). Im Zuge dieser Wandlungsbestrebungen sind v.a. strukturelle Rahmenbedingungen zu nennen, wie etwa die Gewährleistung eines, an „normalen“ Maßstäben ausgerichteten Tages-, Wochen-, und Jahresrhythmus, oder „ die räumliche Trennung von Wohnort, Arbeitsstelle und Freizeitangeboten “ (ebd., S. 226). Die Etablierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sorgte für ein flächendeckendes Berufstätigkeitspotential und einer relativen Gewährleistung eines gewissen ökonomischen Standards (Hähner 2009b, S. 39ff). Im Bereich des Wohnens gilt der strukturelle Wandlungsprozess verwahrender Großeinrichtungen durch „ ein differenziertes System aus Wohnheimen, Trainingswohnungen, Außenwohngruppen, Appartementwohnungen, betreutem Einzel,- Paar- und Kleingruppenwohnen “ (Pitsch 2006, S. 229) als wesentlicher Erfolg im professionellen Prozess der Normalisierung.
Dennoch sind diesen Umstrukturierungsmaßnahmen überwiegend die von Hähner aufgeführten Aspekte (siehe oben) charakterisierend zuzuschreiben. So vollzog sich im Rahmen des Normalisierungsprinzips lediglich „ eine Humanisierung von Lebensbedingungen innerhalb bestehender Großeinrichtungen “ (Theunissen 2010a, S. 62). Zwar änderte sich der professionelle Umgang von der vorrangegangen Ablehnung zu einer gewissen Akzeptanz, doch lässt sich die damalige Perspektive dennoch als weitestgehend defizitär-orientiert charakterisieren (vgl. ebd.). So „ wurden gemeindenahe Wohnangebote fast ausschließlich nur in Form neuer Wohnheime geschaffen; […] wurde [...], insbesondere die Betrachtung geistig behinderter Menschen als belieferungs- und anweisungsbedürftige Defizitwesen, kaum hinterfragt; [...] wurden Betroffene an der Normalisierung ihrer Lebensbedingungen nur selten beteiligt “ (ebd.). Auch anhand der Werkstätten für behinderte Menschen – unabhängig von ihrer zentralen, weit über dem bloß ökonomischen Wertgehalt hinausgehenden Relevanz – lässt sich ein gewisser fremdbestimmt-bewahrender Charakter aufzeigen. Neben einer Lohnauszahlung auf „ Taschengeldniveau “ (Pitsch 2006, S. 229) lässt v.a. das Konzept der WfbM als „ Beschützende und geschützte Werkstätten “ (Schlummer/Schütte 2006, S. 61) für Menschen mit Behinderung entsprechende Rückschlüsse auf eben jenes ausschließende Menschen- bzw. Leitbild zu.
2.3. Wohnverhältnisse und Lebensbedingungen
Der oben dargelegte defizitäre Charakter der „traditionellen“ Behindertenhilfe wird in Bezug auf die realen Wohnverhältnisse von Menschen mit Behinderung noch deutlicher. Zwar zielt insbesondere das Normalisierungsprinzip auch auf eine generelle De-Institutionalisierung zu Gunsten von kleineren, betreuten Wohnformen von etwa 1-6 Personen pro Wohnung ab (Pitsch 2006, S. 228), die reale Umsetzung kam jedoch nur vereinzelt über die „ Planung und Erstellung von Wohnheimen, mit Einzelzimmern ausgestattet “ (Hähner 2009b, S. 42) hinaus. Allen Bestrebungen zum Trotz entwickelten sich kleinere Wohnformen – nach den zielgebenden Maßstäben des Normalisierungsprinzips – erst ab den 80er Jahren (Thesing 1993, S. 57), wobei die Unterbringung in Wohnheimen und sog. Komplexeinrichtungen bis heute als eine gängige Wohnform für Menschen mit Behinderung gilt (Dennhöfer 2004, S. 345). Demnach werden deinstitutionalisierte Wohnangebote nur von einem verschwindend geringen Teil in Anspruch genommen (vgl. Seifert 2006, S. 379). Vordergründig stellen Wohneinrichtungen mit wenigstens 40 Plätzen, neben der Herkunftsfamilie, die mit am häufigsten von Menschen mit geistiger Behinderung genutzte Wohnform (Theunissen 2010a, S. 63). Dabei besitzen jene Einrichtungen häufig eine isolierende Lage, lassen Bewohner bei Wohnplatzvergaben außer Acht, oder zeichnen sich durch spezifische Regelungen und interne Alltagsstrukturen mit einem vorgegebenen (Zwangs-) Rahmen aus (Dennhöfer 2004, S. 348). Dem Lebensstandard des „Norm-Bürgers“ ist dies nicht zuzuordnen. Im Spiegel des etablierten Systems jener institutionellen Wohn- und Lebensformen äußert sich das „ traditionelle Verständnis von geistiger Behinderung als totaler Abhängigkeit “ (Mattke 2004, S. 304) v.a. auch hinsichtlich des professionellen Leitbildes. Diesem ist dabei analog zur Defizit-Perspektive eine „paternalistische Grundhaltung“ zuzuordnen, welche sich v.a. in dem Anspruch manifestiert, „ die wirklichen Interessen der Benachteiligten besser verstehen zu können als diese selbst “ (ebd., S. 306)
Dennhöfer konstatiert in diesem Zusammenhang eine gesellschaftliche Zuschreibung, aus der die dominierende Perspektive auf Menschen mit Behinderung resultiert, und letztlich zu eben jenen beschriebenen Wohn- und Lebensbedingungen geführt hat:
„ Es scheint, als hätte sich aus den Erfahrungen der letzten 150 Jahre ein Behinderungsbild entwickelt und festgesetzt, welches Wohnheime bzw. Großeinrichtungen als einzige Lebensmöglichkeit für Menschen mit einer geistigen Behinderung akzeptiert, ja voraussetzt. “
(Dennhöfer 2004, S. 349)
Es ist hierbei zu erwähnen, dass den entsprechenden Wohneinrichtungen seit der Gründung der BRD diesbezüglich v.a. eine schützende Funktionsweise inne wohnt (Dennhöfer 2004, S. 347). Parallel zu einer grundsätzlichen Anerkennung des Normalisierungsprinzips lassen sich nun als Leitbild der ehemaligen Ver -wahrung eindeutig dominierende Prinzipien der Be -wahrung gegenüberstellen (Hähner 2009b, S. 42). Werkstätten und insbesondere Wohnheime sind in diesem Zusammenhang durchaus als „Schonraum“ für Menschen mit Behinderung zu bezeichnen (vgl. Dennhöfer 2004, S. 357), während das Sonderschulwesen – unabhängig von der hohen Bedeutung als fundamentale Innovation der damaligen Zeit – schon terminologisch ähnliche Schlüsse zulässt (vgl. Lindmeier 2006, S. 42), wie auch der Begriff der allgemeinen Sonder -Pädagogik selbst. Menschen mit Behinderung scheinen somit im Rahmen des „traditionellen“ Behindertenhilfesystems den Status eines „Sonder-“, wenn nicht sogar „Mängelwesens“ einzunehmen:
„ Behindert sein heißt in dieser Gesellschaft, nicht über besondere Fähigkeiten und Talente, sondern über reduzierte Leistungs- und Kommunikationsfähigkeiten zu verfügen. Behinderte Menschen sind Wesen, die über ihre Defekte definiert werden, deren körperlicher, geistiger oder psychischer Zustand als ,,regelwidrig" angesehen wird. “
(Waldschmidt 2012, S. 28f)
Eine wesentliche Vorbedingung und gleichzeitige Konsequenz dieser asymmetrischen Sicht bildet dabei das umfassende gesellschaftliche und professionssystematische Absprechen wesentlicher Elemente der eigenverantwortlichen Handlungsfähigkeit, der Selbstständigkeit und der subjektiven Autonomie von Menschen mit Behinderung. Gerade die oben beschriebenen Verhältnisse einrichtungsgebundener Wohnformen der „traditionellen“ Behindertenhilfe machen dies deutlich.
Nach Anne Waldschmidt ist hierbei von einem engen Zusammenhang zwischen chronischer Erkrankung bzw. Behinderung und der gesellschaftlichen Zuschreibung von individueller Autonomie auszugehen (vgl. Waldschmidt 2012, S. 23ff). Ersteres schränkt dabei Letzteres im gesellschaftlich gängigen Bild des Menschen mit Behinderung stark ein:
„ Nicht nur Urteils-, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, sondern auch das Vermögen zu Selbstständigkeit und zu einem Leben ohne Unterstützung werden den als behindert klassifizierten Kindern und Erwachsenen leicht abgesprochen. “
(Waldschmidt 2012, S. 29)
Aus der augenscheinlichen Ausprägung einer solchen defizitären Orientierung im „traditionellen“ Hilfesystem, insbesondere im Bereich des Wohnens, ergibt sich somit v.a. ein Autonomie absprechendes Behindertenbild. Aus diesem lässt sich wieder ein breites Spektrum fremdbestimmender Umgangsweisen in Bezug auf Menschen mit Behinderung ableiten. Die Bedeutung des „Mängelwesens“ zieht demnach das Recht, ja sogar die Pflicht der beteiligten Helfer nach sich, in ihrem eigenen, „professionellen“ Sinne über die Belange von Menschen mit Behinderung zu entscheiden, da diese allein auf Grund ihrer Behinderung eben nicht als Personen gleichrechtlichen Ranges gelten. So heißt es bei Waldschmidt weiter:
„ Dauerhafte gesundheitliche Mängel und Schädigungen disqualifizieren anscheinend dazu, als autonomes, frei handelndes und vernünftig urteilendes Subjekt zu gelten. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu haben schließt das Individuum zwar nicht im Einzelfall, so doch grundsätzlich von der Teilhabe am Subjektstatus eher aus. “
(Waldschmidt 2012, S. 29)
Besonders auffallend in diesen Ausführungen ist nun die verwendete Terminologie, wie Urteils- und Handlungsfähigkeit, Autonomie/Selbstständigkeit, oder Subjektstatus. Dabei lässt sich der relevante Bedeutungsgehalt zunächst auf den allgemeinen Begriff der Selbstbestimmung im vereinheitlichenden Sinne subsumieren. Letztlich ist es eben dieser Grundwert, der Menschen mit Behinderung im professionellen Unterstützungs- und Wohnformsystem der „traditionellen“ Behindertenhilfe weitest gehend abgesprochen wird.
3. Exkurs: Selbstbestimmung
In diesem Kapitel wird der eher vage Begriff der Selbstbestimmung thematisiert, um den darin enthaltenen wesentlichen Bedeutungsgehalt darzustellen. Neben der Herstellung relevanter Bezüge zu verwandten Aspekten – bspw. Autonomie, eigener Wille, Subjektstatus, oder Individualität – wird auch weitestgehend die lebenspraktische Relevanz von Selbstbestimmung näher beschrieben. Durch diese vorrangehende Untersuchung lässt sich anschließend der spezifische Zusammenhang zwischen dem Selbstbestimmungsgedanken und dem aktuellem Behindertenhilfesystem anhand der aktuell bestehenden Leitlinien professioneller Behindertenarbeit in adäquater Weise darstellen.
3.1. Was heißt Selbstbestimmung? Eine theoretische Analyse
Dem anthropologischen Bedeutungsgehalt des Begriffes Selbstbestimmung geht zunächst die prinzipielle Funktionsweise der Selbstregulation „ als grundlegendes, biophysisches Merkmal alles Lebendigen “ (Walther 2009. S. 70) voraus. Damit sind existenziell notwendige, intra-organismische Selbsterhaltungsprozesse gemeint, die sich in der direkten Wechselwirkung mit der Umwelt äußern (ebd.). Hinsichtlich dieser Selbstregularien gelten besondere Bedingungen für die menschliche Existenz:
„ Der Mensch ist das als letzte auf die Welt gekommene Geschöpf. Es hat keinen vorgegebenen Bestand an körperlichen Fähigkeiten, kein vorbestimmtes Verhaltensrepertoire. […] Und weil ihm all diese natürlichen Bestimmungen fehlen, kommt der Mensch gleichsam kompensatorisch in den Mittelpunkt der Welt – also an den angestammten Platz Gottes! Und in dieser Position hat er die göttliche Vollmacht, sich selbst vollkommen frei überlassen zu sein. “
(Gerhardt 1999, S. 132)
Der Mensch als instinktarmes „Mängelwesen“ besitzt demnach besondere Eigenschaften und auch Fähigkeiten der freien Bestimmung über sich selbst, um das Defizit an Instinkten auszugleichen (vgl. Gerhardt 1999, S. 193). Dies wird nun gemeinhin erfüllt durch die, dem Menschen gegebene, Rationalität, im weitesten Sinne die menschlich-kognitiven Fähigkeiten, als funktionale Notwendigkeit für das Lernen und die Aneignung selbstregulativer Verhaltensweisen (Walther 2009, S. 70). Für die Konstruktion und den Erhalt jener instinktlosen Selbstregularien ist dem Menschen „ als ein prinzipiell autonomes bio-psycho-soziales System “ (Kulig/Theunissen 2006, S. 241) nun ein wesentliches Instrumentarium mit konstitutiver Funktion quasi genetisch vorgegeben: gemeint ist hierbei die Fähigkeit zu einem Sich-In-Beziehung-Setzens mit dem eigenen Selbst: „ Und schließlich schreibt man dem Menschen die Ausbildung von Subjektivität, von Bewußtsein über sich selbst zu “ (Walther 2009, S. 70). Das Bewusstsein von der eigenen Existenz ist in diesem Kontext als ein notwendiges Kriterium für die Erschaffung jener Regularien menschlicher Autopoiesis zu betrachten. Die selbst-bewusste Selbst-regulation eines Individuums verweist durch den Bezug des Selbst und der konkreten Ausübung des regulativen „Tuns“ auf ein wesentliches Spezifikum, welches sich letztlich in adäquater und verdeutlichender Weise mit dem Begriff der Selbstbestimmung zusammenfassen lässt:
„ Der Mensch kann und muss in eine Beziehung zu sich selbst treten. Er nimmt sich selbst wahr, seine Gefühle, sein Tun, er baut sich ein Bild auf über sich selbst. Und er kann sich selbst mögen oder nicht, er kann mit sich selbst ablehnend oder akzeptierend umgehen, er kann sein Leben „selbst in die Hand nehmen“ und gestalten. “
(Walther 2009, S. 70f).
Die menschliche Befähigung zur Selbstbestimmung ist in ihrer Bedeutung somit als zentrales anthropologisches Merkmal des Menschen, quasi als eine Art existenzielle Vorbedingung zu betrachten.
An dieser grund-anthropologischen Fundierung anknüpfend, stellt sich der relevante Bedeutungsgehalt menschlicher Selbstbestimmung außerdem in dem Gedanken dar, „ dass trotz aller konstitutiven Eingebundenheit des Menschen in die Natur und in eine Gesellschaft es letztlich doch immer der einzelne Mensch ist, der sein Leben nach seiner eigenen Einsicht führen muss. “ (Willaschek 2009, S. 91). Dem zu Folge leitet sich selbstbestimmtes Handeln primär von der gegebenen Individualität und Rationalität des Menschen ab. Auf diese Verknüpfung verweist, allein schon nach semantischen Gesichtspunkten, das Begriffspaar „Selbst-Bestimmung“: so kommt in dem Wort „Selbst“ die wesensgebundene Singularität – also Individualität – zum Ausdruck, während „Bestimmung“ u.a. synonym zum kognitiven Prozess des Erkennens – u.a. auch als konkreter Ausdruck von Rationalität – zu verstehen ist (vgl. Theunissen 2009b, S. 40); und darüber hinaus auch als gewisse Form der Machtausübung (über sich selbst) (ebd.). In Anlehnung an Anne Waldschmidt lässt sich Selbstbestimmung nun mit zwei wesentlichen Aspekten in Zusammenhang bringen: (1) als kultur-historisch explizites Merkmal der Moderne und (2) als gegebener elementar-menschlicher Grundwert (vgl. Waldschmidt 2012, S. 17). Beide Aspekte gilt es im Näheren zu betrachten.
(1) Auf den Aspekt Selbstbestimmung als kultur-historisch explizites Merkmal der Moderne verweist u.a. auch Georg Theunissen: „ Mit dem Begriffsanteil des „Selbst“ verbindet sich eine moderne Vorstellung der Identität und des Subjektes “ (Theunissen 2009b, S. 40). Die Idee des autonomen Subjekts ist dabei in die Epoche der Aufklärung anzusiedeln, welche u.a. als grundlegende Zäsur für die „Bewusstseinserweiterung des modernen Menschen und damit als anthropologischer Wandel interpretiert wird “ (Meyer 2009, S. 25). Namentlich ist der Begriff Selbstbestimmung insbesondere mit Immanuel Kant und der praktischen Vernunft als das elementare, spezifisch-anthropologische Wesensmerkmal des Menschen in Zusammenhang zu bringen (Kulig/Theunissen 2006, S. 238). Nach diesem beschreibt sich Subjektivität und Autonomie durch die implizite Rationalität menschlicher Handlungsweisen, und konkret in der am Individuum orientierten und auf sich selbst bezogenen Anwendung jener (Gerhardt 1999, S. 140f). Zur vernunftgemäßen Einsicht befähigt, setzt dies den Menschen in die Lage, aus sich selbst heraus Maßstäbe für das eigene Handeln zu setzen und dieses von und an sich selbst zu kontrollieren; der Kern des Kant’schen Selbstbestimmungsbegriffs (ebd., S. 141). Somit ist dem autonomen Subjekt allein durch sein vernunftgemäßen Einsichtsvermögens – heute etwa als „Intellekt“ zu bezeichnen (Fröhlich 2009, S. 2) – als konstituierendes Element zur Befähigung zu individueller Freiheit, Selbstbestimmung überhaupt zuzuschreiben.
(2) Der Aspekt Selbstbestimmung als gegebener menschlicher Grundwert konstatiert die bestehende Selbstverständlichkeit und Unantastbarkeit des autonomen Menschen in seiner individuellen Gestalt, was darüber hinaus „ als konstitutives Merkmal des eigenen Subjektstatus angesehen “ (Waldschmidt 2012, S. 17) wird. Allein das im Grundgesetz verankerte Recht auf die freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) zeugt von der hohen, gesellschaftlichen Bedeutung, welche dem individuellen Selbstbestimmungsrecht gewährt wird. Der Denkfigur des autonomen Subjekts der Aufklärung ist demnach im weiteren historischen Verlauf und v.a. für die westlichen Industrienationen eine überaus hohe Bedeutung beizumessen, welche sich in diesem Kontext „ als ein Ergebnis gesamtgesellschaftlicher Wandlungsprozesse “ (Kulig/Theunissen 2006, S. 229) beschreiben lässt. Den gesamtgesellschaftlich-normativen Bedeutungszuwachs von, auf das Individuum bezogenen Werten – wie bspw. persönliche Freiheit und individuelle Unabhängigkeit – manifestiert sich dabei im Allgemeinen in einer generellen „ Hervorhebung der formalen Selbstreferenz bewussten Lebens “ (Sturma 2009, S. 243) in den westlichen Gesellschaften. Diese „ Steigerung von Komplexität im Medium der Individualität “ (Gerhardt 1999, S. 185) ließe sich nun als entwicklungslogisches Ergebnis gesellschaftlicher Ausdifferenzierungsprozesse deuten (vgl. ebd.) und lässt sich gemeinhin als konstatierte „ Dramatisierung der Individualität “ (ebd.) beschreiben. Dass dabei gerade auch Menschen mit Behinderung vermehrt eine umfassende Realisierung eben jenes, eigentlich bestehenden Rechts auf Selbstbestimmung anstreben, scheint anhand dieses kultur-historischen Entwicklungsprozesses nur wenig verwunderlich (vgl. Fröhlich 2009, S. 3).
3.2. Behindert-Sein und Selbstbestimmung – ein paradoxes Verhältnis?
Im Hinblibk auf den traditionell-philosophisch enggefassten Zusammenhang zwischen Selbstbestimmung und intellektuellem Urteilsvermögen nach Kant, wirft die betreffende Denkfigur eine wesentliche Konsequenz mit einem höchst relevantem Problemgehalt in Bezug auf Menschen mit Behinderung auf: das Paradoxon der Vereinbarkeit von praktischer Vernunft und geistiger Behinderung. So scheint diese Verknüpfung das Potential zur individuellen Selbstbestimmung behinderter Menschen von vorne herein gering zu halten bzw. überhaupt auszuschließen (vgl. Kulig/Theunissen 2006, S. 239). Bei Andreas Fröhlich heißt es hierbei wie folgt:
„ Vernunft, hat Kant erkannt, hat sehr viel mit Verstand und Intellekt, mit Einsichtsvermögen und „Durchblick“ zu tun. An Menschen mit einer kognitiven Einschränkung, an Menschen mit einer geistigen Behinderung, an Menschen mit psychischen Besonderheiten hat Kant dabei niemals gedacht. “
(Fröhlich 2009, S. 1f).
Nach der klassischen Auffassung erfährt das Subjekt – in einem konkreten Krankheitsfalle – einen vorübergehenden Autonomieverlust (für die Dauer der Krankheit), der sich bei einer chronischen Beeinträchtigung dementsprechend problematisiert (vgl. Waldschmidt 2012, S. 22). Den Denk- und Handlungsstrukturen bezüglich des „traditionellen“ Behindertenbilds entsprechend, besitzt die Vorstellung der Unvereinbarkeit von praktischer Vernunft und damit Selbstbestimmung und (geistiger) Behinderung bis heute eine zu beobachtende Verbreitung, bspw. in bestehenden Formen des Paternalismus (vgl. Kulig/Theunissen 2006, S. 239).
Sind nun Menschen mit Behinderung überhaupt in der Lage, oder gar berechtigt, ihren Anspruch auf Selbstbestimmung geltend zu machen? Um dieser Fragestellung eine positive Antwort entgegenzusetzen, bedarf es an dieser Stelle eines Rückgriffs auf die zu Beginn dieses Kapitels aufgeführten Erläuterungen.
Im Rahmen innerlicher Selbstregulierungsprozesse fungiert Selbstbestimmung als zentrale Steuerungsinstanz individueller Handlungsweisen. Im Gegensatz zu bloß animalischen Verhalten weist der Handlungsbegriff dabei ein zentrales Wesensspezifikum des Menschen auf: „Der Mensch ist das handelnde Wesen par excellence . “ (Gerhardt 1999, S. 195). Nach Kant ließe sich in der handlungsweisenden Regulationsfunktion nun die Rolle der praktischen Vernunft verorten (ebd., S. 137ff). Entscheidend an der menschlichen Autopoiesis ist aber zunächst nicht der konkrete, rationale Ausprägungsgrad hinsichtlich der selbstregulativen Prozesse, sondern primär die vorangehende Beziehung zu sich selbst, kurz: seine Individualität (vgl. Gerhardt 1999, S. 327). Quasi als Vorbedingung aller, auch rationaler Regularien ist das Selbst-Bewusstsein von entscheidender Relevanz für selbstbestimmtes Handeln (vgl. Fröhlich 2009, S. 2). Denn wie kann ich mir Handlungsmaßstäbe setzen, ohne dass ich mir selbst, als Subjekt, bewusst bin? Ohne diese Prämisse wäre selbst das leistungsstärkste kognitive Fähigkeitspotential nicht ausreichend für selbstbestimmtes Handeln. Der Vernunft als wirksames Element der Selbstbestimmung ist demnach zwar ein, im technischen Sinne zweckorientierter, aber kein ultimativer Charakter zuzuordnen. Vielmehr zeigt sich am menschlichen Individuum, dass „ die zweckmäßige Tätigkeit der Vernunft […] ohne Beziehung zum zwecksetzenden Willen“ (Gerhardt 1999, S. 322) nicht funktionieren kann (ebd.). Der besagte Wille vereint nun hierbei eben jene individuellen Handlungsmotive, „ die man sich selbst angeeignet hat (oder doch aneignen könnte), indem man sie an normativen (und zwar nicht bloß instrumentellen) Maßstäben misst und ihnen in Abhängigkeit vom Ausgang dieser Prüfung in seinen Entscheidungen Gewicht gibt oder nicht. “ (Willaschek 2009, S. 110). Dies wiederum ist unmittelbar mit dem Bewusstsein über die eigene, individuelle Existenzweise, dem eigenen Selbstverständnis unter der Prämisse der „ eigenen Einsicht “ (Gerhardt 1999, S. 76f) zu verstehen. Gleichzeitig gilt dieser existenzielle Selbstbezug als Ausgangspunkt jedweder individueller Handlungen (ebd., S. 104), womit die Eigenständigkeit des Wollens, der „eigene Wille“ in der Abgrenzung zum „Anderen“ überhaupt als einzige Rahmenbedingung für subjektive Freiheit (ebd., S. 258) zu verstehen ist.
Gilt das Sich-Selbst-Bewusstsein zwar als konstitutiv-notwendiges Element für den Aufbau und den Erhalt von Selbstbestimmung, so lässt sich letztere aber nicht ohne weiteres auf ersteres reduzieren. Eine solche Formulierung hieße, dass Selbstbestimmung lediglich als Bewusstheit über die eigene Existenz „ nicht nur auf die humane Lebensform, sondern auch auf andere animalische Lebensformen “ (Sturma 2009, S. 243) bezogen werden müsse, da „ jeder Prozess bewussten Lebens […] sich in struktureller Hinsicht durch eine formale Selbstreferenz zu konstituieren “ (ebd.) scheint. Auch die Rolle der Vernunft kann hierbei nur bedingt als Kriterium für Selbstbestimmung gelten, insbesondere in Form eines konkret notwendigen Maßes kognitiver Fähigkeiten. In Kombination aber mit dem ausgeprägten Selbstbewusstsein – den Bezug an die eigene Existenz – sowie der Grundsätzlichkeit der individuell unterschiedlich ausgeprägten, technisch-rationalen Fähigkeit eigenständiger Weltaneignung, als kompensatorisches Funktionsinstrumentarium für mangelnde Instinkte, ist dem Menschen letztlich eine höchst spezifische und über das bloß Strukturelle weit hinausgehende Form der „Selbstregulierung individuellen Lebens“ (Fröhlich 2009, S. 2) zuzuschreiben: nämlich in dem umfassenden Prinzip individueller Selbstbestimmung.
Letztlich ist das Prinzip der Selbstbestimmung unmittelbar mit der individuellen Existenzweise des Menschen verknüpft, und damit nun in Abhängigkeit mit dem Individuum zu sehen. Gleichzeitig äußert sich Individualität eben im selbstbestimmten Handeln. Auf Grund dieser Wechselseitigkeit ergibt sich folglich ein anthropologisches Rahmenkonstrukt, in welchem Menschen mit Behinderung nun als selbstbestimmte Individuen anzuerkennen sind.
3.3. Selbstbestimmung als Leitlinie der professionellen Behindertenhilfe
Anknüpfend an der gesellschaftlichen Bedeutung und der aufgezeigten anthropologischen Fundierung von Individualität, ist insbesondere der persönlichen (Willens-) Freiheit des Menschen, also dem Recht auf Selbstbestimmung, eine allgemeine, überaus hohe normative Wertung zu attestieren (vgl. Kulig/Theunissen 2006, S. 237). Gleichzeitig scheinen gesellschaftliche Autonomiezuschreibungen bei Menschen mit Behinderung die Problematik einer gewissen Unvereinbarkeit von beiden Eigenschaften mit sich zu führen (vgl. Waldschmidt 2012, S. 17ff). Dies ist gerade anhand „traditioneller“ Gedanken- und Handlungsmuster der professionellen Behindertenhilfe aufzuweisen. Dem entgegen gilt es festzuhalten, dass Selbstbestimmung als spezifisches Merkmal menschlicher Individualität auch Menschen mit behinderungsbedingten Einschränkungen bezüglich ihrer alltäglichen Selbstständigkeit zu zuschreiben ist:
„ Selbstbestimmung ist nicht mit Selbstständigkeit gleichzusetzen. Selbstständigkeit ist nicht die Voraussetzung von Selbstbestimmung. Menschen können selbst bestimmen, auch wenn sie zur Durchführung Assistenz benötigen. “
(Fröhlich 2009, S. 6)
Nach dieser Auffassung ist „ in den letzten Jahren vor allem auf Initiative und Druck der Betroffenen selbst “ (Kulig/Theunissen 2006, S. 237) „ der Dreiklang von Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität “ (ebd., S, 246) als leitendes Prinzip im professionellen Unterstützungsumgang mit Menschen mit Behinderung formuliert worden. Dies bedeutet an sich nichts weniger als den Vollzug eines grundlegenden, mehrdimensionalen Wandlungsprozesses des paradigmatischen Hintergrundes im professionellen Umgang mit Menschen mit Behinderung. Repräsentativ ist für diese Entwicklung der Empowerment-Ansatz zu nennen, dessen Philosophie sich in der konzeptionellen Etablierung des Selbstbestimmungsgedankens konkretisiert. Die Bedeutung von Empowerment vereint im Rahmen selbstbestimmter Handlungsziele konkret individuelles Ressourcenpotential mit dem sozialen Zusammenschluss von Betroffenen, also „Gleichen“, etwa zu Vereinigungen mit sozial-politisch ausgerichteter Aktionsorientierung (bspw. politische Interessenvertretung). Der Begriff lässt sich daher im Deutschen grob mit „Selbstermächtigung“ auf individueller und sozialer Ebene übersetzen (vgl. KuligTheunissen 2006, S. 243). Die wesentlichen Handlungsebenen von Empowerment sind nun unter folgenden Punkten dargestellt (vgl. ebd., S. 247f):
1. subjektzentrierte Ebene: dies bezeichnet in Bezug auf enthospitalisierende Unterstützungsmaßnahmen v.a. die individuelle „ (Wieder-) Gewinnung von Lebensautonomie […] sowie […] Entwicklung neuer Lebenskräfte und Handlungskompetenzen “ (ebd. S. 247), insbesondere angesichts der langjährig gesellschaftlichen Negativ-Zuschreibungen.
2. gruppenbezogene Ebene: dies bezieht sich auf das nähere soziale Umfeld eines Menschen mit Behinderung und verweist durch die (Re-) Aktivierung von sozialraumbezogenen Ressourcen ebenfalls auf ein am Individuum orientierter Enthospitalisierungsprozess.
3. institutionelle Ebene: Ausgehend von der nach wie vor etablierten Form institutionellen Wohnens und Lebens von Menschen mit Behinderung, gilt es auf dieser Ebene strukturelle Möglichkeiten für einen deinstitutionalisierenden Veränderungsprozess wahrzunehmen.
4. sozialpolitische und gesellschaftliche Ebene: auf dieser Ebene letztlich lassen sich Ansätze gesellschaftspolitischer Einflussnahme, bspw. durch soziale Aktivitäten, einer umfassenden Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit, usw., anführen.
Allen genannten Handlungsebenen liegt dabei prinzipiell die Prämisse der Selbstbestimmung zu Grunde. Verwandte Aspekte, wie bspw. Selbstständigkeit und Selbstverantwortung zeichnen sich darüber hinaus als weitere und wesentliche „ Bausteine für eine veränderte Sichtweise von Menschen mit einer Behinderung “ (Walther, Helmut 2009, S. 69) aus. Gerade auf der Mikroebene, der subjektzentrierten Ebene, gestaltet sich der paradigmatische Wandel in einem deutlichen, praktisch-relevanten Wirkungsumfang. Die Gewährleistung von Selbstbestimmung in der direkt personenbezogenen Interaktion bedarf zum einen die ausgeprägte „ Regiekompetenz “ (Niehoff 2009, S. 53ff) seitens des Betroffenen, und zum anderen auch den nötigen „Freiraum“ seitens des professionellen Helfers; jener muss also die erzielte Selbstverantwortlichkeit des Betroffenen zunächst einmal akzeptieren (vgl. ebd., S. 77). Sind beide relevanten Positionen in einer adäquaten Konstellation gewährleistet, lässt sich vor allem bezüglich der alltäglichen Wohn- und Lebensbedingungen der Betroffenen ein enormer Zuwachs an realistischen Selbstbestimmungsmöglichkeiten erzielen.
Die relevanten Handlungsmaßstäbe für eine selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinderung decken in ihrem Bedeutungsgehalt vor allem alltagspraktische Aspekte ab. Ausgehend von der zentralen Position des Begriffes der Selbstbestimmung als oberste und maßgebende Prämisse sind dabei folgende Punkte zu nennen (vgl. Theunissen 2009b, S. 42f):
- Entscheidungsfreiheit
- „Selbstaktualisierung“
- „Selbstregelung/Selbstbeobachtung/Selbstkontrolle“
- Eigene Zielsetzung
- Eigenaktivität
- Verfügung/Kontrolle über die eigenen Lebensumstände
- Selbstrealisierende Lebensverwirklichung
Augenscheinlich ist der Spannbreite und der praktischen Relevanz der genannten Aspekte die wesentliche Nähe zu dem generell grundlegenden Verständnis von persönlicher Freiheit und subjektiver Autonomie zu konstatieren. Hinsichtlich des Wohnens von Menschen mit Behinderung zieht eine umfassende Realisierung des Prinzips Selbstbestimmung v.a. strukturelle Fragen auf (vgl. Sack 2009, S. 194):
- Wird ein Einzelzimmer bewohnt? Lässt sich dieses abschließen?
- Ist persönlicher Besitz möglich? Lässt sich der Wohnraum selbst gestalten?
- Besteht Wahlfreiheit bezüglich der Nahrungsaufnahme, oder der Hygiene?
- Ist das Empfangen von Besuch eingeschränkt?
- Herrschen eingeschränkte Mobilitätsbedingungen vor?
- usw.
Somit scheint die Umsetzung des Selbstbestimmungsgedankens als Leitlinie professioneller Behindertenarbeit vor allem auf die Wandlung struktureller Verhältnisse zu zielen. Inwieweit hierbei konkrete Ansätze vorherrschen, oder bereits wirken, wird im nächststehenden Kapitel genauer erörtert. Weiterhin sind bei dem Vollzug des umfassenden paradigmatischen Wandlungsprozesses auch potentielle Problemfelder abzusehen, welche ebenso dargestellt werden.
4. Selbstbestimmung in Theorie und Praxis der Behindertenhilfe
In Theorie und Praxis der professionellen Behindertenhilfe ist in Anbetracht der neuen, an der Idee der Selbstbestimmung orientierten Wertefundierung ein weitreichender Wandel zu beobachten (siehe Seifert 2006, S. 377). So streben aktuelle Strömungen innerhalb der professionellen Behindertenarbeit u.a. eine flächendeckende Umstrukturierung der alten Wohn- und Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderung im Sinne der Leitprinzipien von Selbstbestimmung und Inklusion an. Ausgehend von einem, in der Literatur häufig benannten „Paradigmenwechsel“ (Schlummer/Schütte 2006, S. 13), sind diesen innovativen Ansätzen unabsehbare Impulse in den elementaren Lebensbereichen von Beruf, Freizeit und Wohnen zu zuzuordnen (vgl. Heimlich 2003, S. 71-85). In Abgrenzung zur „traditionellen“ Behindertenhilfe setzen diese Ansätze dabei zunächst eine veränderte Denk- und Herangehensweise voraus und zielen gleichermaßen auf ideelle, strukturelle und institutionelle Reformprozesse.
Dieses Kapitel liefert zunächst eine Charakterisierung der paradigmatischen Wirkung von Selbstbestimmung als Leitlinie auf die Profession der allgemeinen Behindertenhilfe. Ausgehend von den Prinzipien Integration und Inklusion wird dabei, neben dem breiten Spektrum relevanter Handlungsfelder, hauptsächlich die zentrale Stellung selbstbestimmter Elemente im allgemeinen System der Behindertenhilfe verdeutlicht. Des Weiteren sind auch auf der strukturellen Ebene, etwa anhand sozialpolitischer Neuregelungen, kennzeichnende Impulse zu Gunsten des paradigmatischen Wandels zu konstatieren. Nicht zuletzt für den Bereich des Wohnens ergibt sich dabei in besonderer Weise ein Strukturpotential, aus welchem konkrete Umsetzungsformen gemäß der Maßstäbe von Selbstbestimmung und Inklusion hervorzuheben sind.
4.1. Das (neue) Professionsverständnis
Aktuell ist der prägnante Perspektivenwechsel – wie schon erwähnt – als grundlegend und prädestinierend für den professionellen Umgang mit dem betreffenden Personenkreis zu bezeichnen. Sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis zeigen sich eine Vielzahl innovativer Projekte, Ansätze und Konzepte mit einem vielfältigen Bereichsspektrum. Von höchster Relevanz ist dabei die Wende hin zu dem Realisierungsanspruch einer flächendeckenden Umsetzung von gesellschaftlich inkludierten und selbstbestimmten Partizipationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung (Waldschmidt 2012, S. 22). Beispielhaft sei an dieser Stelle wieder die Empowerment-Bewegung innerhalb der professionellen Behindertenarbeit genannt, die sich u.a. in dem Verein „ Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V. “ manifestiert hat (Göthling/Schirbort & Theunissen 2006, S. 558ff). Abgesehen von der, im Strafgesetzbuch IX verankerten, rechtlichen Anerkennung gleichberechtigter Möglichkeiten zu selbstbestimmter Lebensführung und gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen mit Behinderung (vgl. Trenk-Hinterberger 2006, S. 54ff), betonen aber auch „traditionelle“ Träger der Behindertenhilfe in ihren Satzungen die Umsetzung dieser neuen Leitlinien (gesellschaftliche Teilhabe, Selbstbestimmung, Inklusion) als gezielte Aufgaben ihres Tätigkeitbereiches (vgl. Niehoff 2007-2008).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Selbstbestimmtes Wohnen“ für Menschen mit Behinderung?
Es ist ein Paradigma, das darauf abzielt, dass Menschen mit Behinderung frei entscheiden können, wie und wo sie leben, unterstützt durch Assistenz und soziale Teilhabe statt Bevormundung.
Welche Wohnformen werden in der Mainzer Behindertenhilfe unterschieden?
Die Arbeit unterteilt in einrichtungsgebundenes Wohnen (Wohnstätten), betreutes Wohnen in Gruppen sowie das Wohnen in der eigenen Wohnung mit persönlicher Assistenz.
Was ist das „Normalisierungsprinzip“?
Es besagt, dass Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung so weit wie möglich an die Lebensweisen von Menschen ohne Behinderung angepasst werden sollten, insbesondere im Bereich des Wohnens.
Wie bewerten Betroffene in Mainz ihre Wohnsituation?
Anhand einer empirischen Erhebung wird untersucht, wie Menschen mit Behinderung in Mainz ihre Selbstbestimmung erleben und inwieweit die bestehenden Strukturen ihren Wünschen nach Teilhabe entsprechen.
Was sind innovative Ansätze wie „Supported Living“?
Konzepte wie Supported Living oder Community Care setzen auf gemeindeintegriertes Wohnen und Assistenzmanagement, um Inklusion und ein eigenständiges Leben außerhalb von Heimen zu ermöglichen.
- Citation du texte
- Martin Merkl (Auteur), 2012, Selbstbestimmtes Wohnen mit Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195382