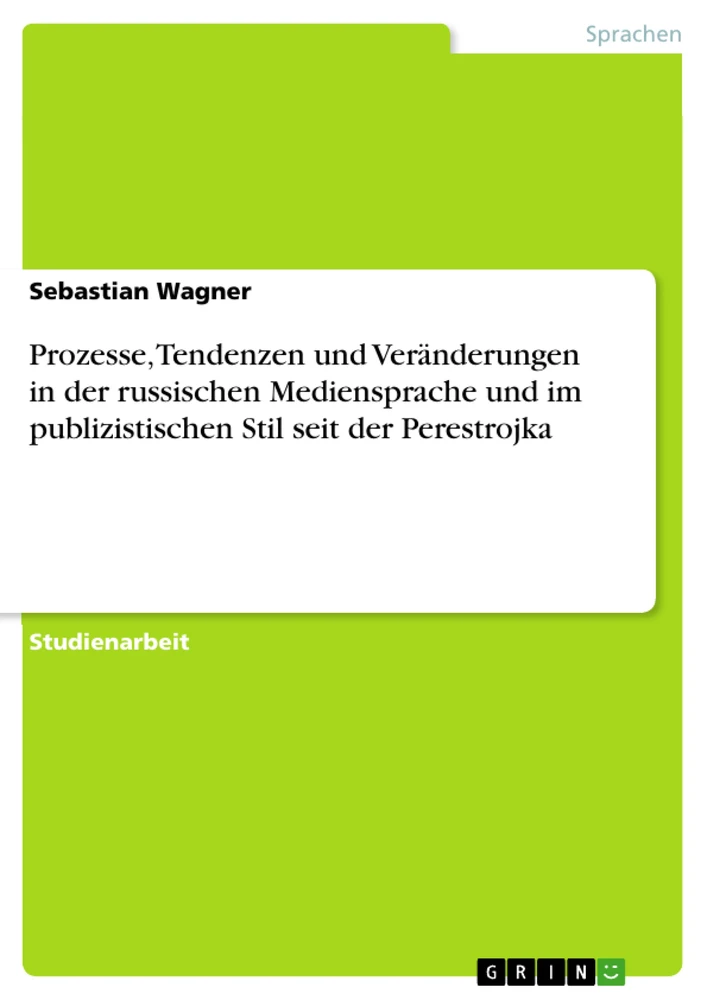Die Sprache – das ist immer ein Versuch, die Wirklichkeit zu beschreiben, wobei eine solche Beschreibung nicht nur eine Sache bezeichnet, sondern jene Sache zugleich in eine bestimmte Weltanschauung setzt. Mit den politischen Umwälzungen in der UdSSR, die schließlich zu deren Zerfall führten, änderten sich schlagartig die sozialen, ökonomischen, politischen u.a. Lebensbereiche. Nicht zuletzt war es schließlich die Sprache, die sich der neuen Realität anpassen musste. Und dies war in Russland nicht nur nach dem Zerfall der UdSSR so, sondern schon einige Male zuvor; man erinnere sich nur einmal an die Zeit Peters des Großen, der durch seine Europareisen zahlreiche westliche Neuerungen in die russische Kultur brachte.
In diesem Zusammenhang ist es dabei besonders die Mediensprache, die den gesellschaftlichen Veränderungen unterliegt. Denn letztendlich werden solche Neuerungen erst durch das Informieren in die einzelnen Köpfe gebracht. Dass dabei gerade dieses Informieren über etwas stark abhängig ist von den vorherrschenden Macht- und Gesellschaftsverhältnissen überhaupt, sollte einem jeden klar sein. Denn jede Information birgt in sich auch eine determinierte Interpretation.
Mit den eingeleiteten Reformen von Glastnost‘ und Perestrojka, und schließlich dem Zerfall der UdSSR, endete zugleich eine totalitäre Norm, die das gesellschaftliche Leben stark prägte. Vorne weg ist wohl an dieser Stelle die Zensur zu nennen, die einherging mit einer totalitären Ideologie, und welche bis zu den Umwälzungen der 1980er Jahre bestimmte, über was informiert wird, und vor allem auch wie.
Die Sprache der Medien bekam seitdem eine immer größer werdende Individualität, die an vielen Stellen deutlich erkennbar ist. Nicht zuletzt veränderte sich nicht nur die Sprache als solche, sondern zugleich auch ihr Stil. Neues kam hinzu, altes wurde reaktiviert. Diese Neuerungen jedoch als positiv oder negativ einzustufen, erweist sich als nicht einfach. Denn ob etwas gut oder schlecht ist, hat die Geschichte – besser die Menschen – noch nie davon abgehalten, es trotzdem zu tun. Nichts ist ewig, alles ist in Bewegung; so auch die Sprache. Zudem sind solche Betrachtungen auch in gewisser Weise eher subjektiv zu sehen.
Welche genauen Prozesse, Veränderungen und Tendenzen die russische Sprache der Medien und auch der publizistische Stil seit der Perestrojka erfahren haben, und eventuell auch weiterhin erfahren, wird im Folgenden dargelegt. ...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Entwicklungen und Tendenzen der Mediensprache
- Medien und Sprache
- Veränderungen der Mediensprache mit und seit der Perestrojka
- Lehnwörter als Massenphänomen der Mediensprache
- Der publizistische Stil
- Überblick über den publizistischen Stil
- Der Stil von Überschriften
- Intertextualität
- Wortspiele
- Ironie und Cтëб
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Veränderungen in der russischen Mediensprache und im publizistischen Stil seit der Perestrojka. Sie analysiert die Prozesse und Tendenzen, die die Sprache der Medien und den Stil des Journalismus beeinflusst haben, und betrachtet die Auswirkungen dieser Veränderungen auf das gesellschaftliche Leben und die Sprachnormen in Russland.
- Entwicklungen und Tendenzen der Mediensprache nach der Perestrojka
- Einfluss der Medien auf die Sprachnorm und gesellschaftliche Anschauungen
- Veränderungen im publizistischen Stil, insbesondere in Überschriften und Intertextualität
- Rolle von Lehnwörtern und anderen sprachlichen Phänomenen in der Mediensprache
- Der Einfluss von Ironie und Стьоб auf den russischen publizistischen Stil
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Mediensprache als Teil der lebendigen Sprache und untersucht die Veränderungen, die sie mit und seit der Perestrojka erfahren hat. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Lehnwörtern als einem Massenphänomen der Mediensprache. Kapitel 3 widmet sich dem publizistischen Stil und seinem Wandel. Es behandelt die Stilistik von Überschriften, die Rolle der Intertextualität, Wortspiele sowie den Einfluss von Ironie und Стьоб.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der russischen Mediensprache und des publizistischen Stils nach der Perestrojka. Zu den wichtigsten Schlüsselwörtern gehören: Mediensprache, publizistischer Stil, Perestrojka, Lehnwörter, Überschriften, Intertextualität, Ironie, Стьоб, Sprachnorm, gesellschaftliche Anschauungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat die Perestrojka die russische Sprache verändert?
Mit dem Ende der Zensur und der totalitären Ideologie wurde die Sprache individueller. Es fand eine Abkehr von starren Normen statt, und neue Stilelemente sowie Lehnwörter hielten Einzug.
Welche Rolle spielen Lehnwörter in der modernen russischen Mediensprache?
Lehnwörter, insbesondere aus dem Englischen, wurden zu einem Massenphänomen, um neue soziale, ökonomische und politische Realitäten nach dem Zerfall der UdSSR zu beschreiben.
Was zeichnet den russischen publizistischen Stil seit den 1990er Jahren aus?
Der Stil ist geprägt durch eine hohe Intertextualität, kreative Wortspiele und einen verstärkten Einsatz von Ironie.
Was bedeutet der Begriff „Стьоб“ (Stjob) im Journalismus?
„Stjob“ bezeichnet eine spezifische Form der Ironie oder des Spottes, die in der russischen Publizistik oft genutzt wird, um gesellschaftliche Zustände provokant zu kommentieren.
Warum ist die Mediensprache für gesellschaftliche Veränderungen so wichtig?
Medien transportieren neue Konzepte und Informationen in die Köpfe der Menschen. Die Sprache der Medien spiegelt dabei stets die vorherrschenden Macht- und Gesellschaftsverhältnisse wider.
- Quote paper
- Sebastian Wagner (Author), 2012, Prozesse, Tendenzen und Veränderungen in der russischen Mediensprache und im publizistischen Stil seit der Perestrojka, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195509