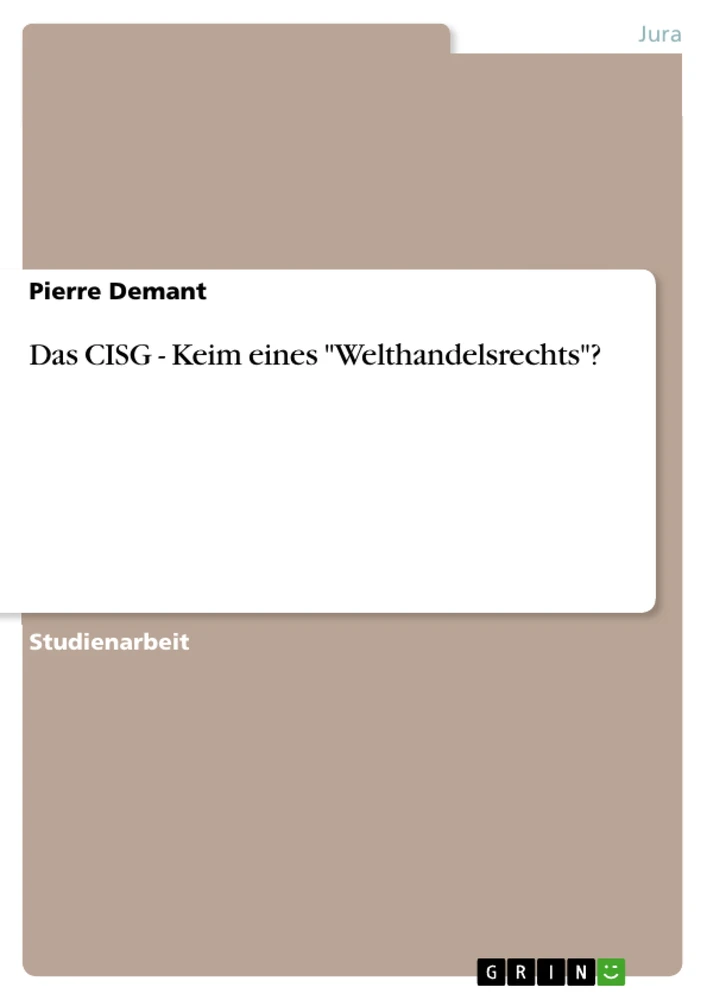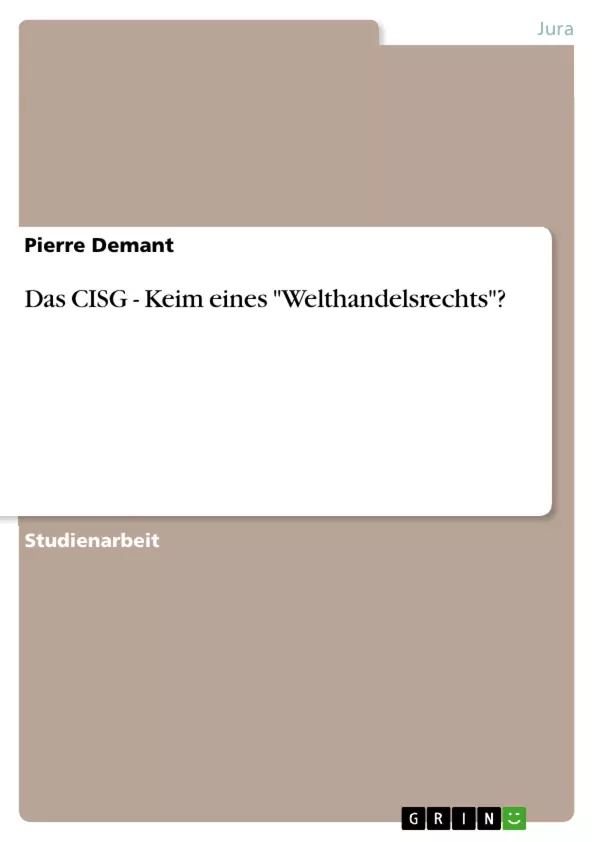Ist das UN-Kaufrecht der Keim eines zukünftigen Welthandelsrechts?
In dieser Arbeit soll die Frage geklärt werden, ob das UN-Kaufrecht andere Regelwerke in ihrer Wachstumsphase ernährte bzw. diese ernährt, sie befruchtet hat und ob es schließlich als Ausgangsstoff für ein gemeinsames Welthandelsrecht angesehen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsgeschichte und allgemeines
- Bezeichnungen
- Entstehungsgeschichte
- Mitgliedsstaaten und Vorbehalte
- Aufbau
- Anwendungsbereich
- Sachlicher Anwendungsbereich
- Räumlich-persönlicher Anwendungsbereich
- Zeitlicher Geltungsbereich
- Ausschluss
- Vertragsabschluss
- Regelungslücken
- Einfluss und Bedeutung des CISG
- Einfluss auf Europa, Deutschland und andere Regelwerke
- Vergleich / Einfluss auf nationales Recht der BRD
- UNIDROIT-Principles
- OHADA / AUDCG
- Einfluss auf Europa, Deutschland und andere Regelwerke
- Lando-Kommission / Europäisches Zivilgesetzbuch
- Internationale Handelsbräuche
- INCOTERMS
- Lex Mercatoria
- Vorteile des CISG
- Probleme / Nachteile
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Studienarbeit befasst sich mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) und untersucht dessen Bedeutung für die Entwicklung eines „Welthandelsrechts“. Die Arbeit analysiert die Entstehungsgeschichte, den Anwendungsbereich und den Einfluss des CISG auf nationale und internationale Rechtsordnungen.
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung des CISG
- Anwendungsbereich und Geltung des CISG
- Einfluss des CISG auf nationale Rechtsordnungen
- Vorteile und Herausforderungen des CISG
- Bedeutung des CISG für die Gestaltung des internationalen Handelsrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Diese Einleitung führt in das Thema des CISG und seine Bedeutung für das internationale Handelsrecht ein. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und stellt die wichtigsten Fragestellungen dar.
Kapitel 2: Entstehungsgeschichte und allgemeines
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des CISG und seine grundlegenden Elemente. Es untersucht die Bezeichnungen, die Entstehungsgeschichte, die Mitgliedsstaaten und Vorbehalte sowie den Aufbau des Übereinkommens.
Kapitel 3: Anwendungsbereich
Hier werden die verschiedenen Aspekte des Anwendungsbereichs des CISG betrachtet. Es werden der sachliche, der räumlich-persönliche und der zeitliche Anwendungsbereich sowie die Ausschlussgründe und Regelungslücken erläutert.
Kapitel 4: Einfluss und Bedeutung des CISG
Dieses Kapitel untersucht den Einfluss des CISG auf nationale und internationale Rechtsordnungen. Es analysiert die Auswirkungen auf das Recht der BRD, die UNIDROIT-Principles sowie die OHADA / AUDCG-Regelungen.
Kapitel 5: Lando-Kommission / Europäisches Zivilgesetzbuch
Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Lando-Kommission und das Europäische Zivilgesetzbuch im Kontext des internationalen Handelsrechts.
Kapitel 6: Internationale Handelsbräuche
Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung internationaler Handelsbräuche, insbesondere INCOTERMS und Lex Mercatoria, im Zusammenhang mit dem CISG.
Kapitel 7: Vorteile des CISG
Dieses Kapitel analysiert die Vorteile des CISG für den internationalen Handel, wie z.B. die Rechtssicherheit und die Vereinfachung von Vertragsabwicklungen.
Kapitel 8: Probleme / Nachteile
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Nachteile des CISG, z.B. die mögliche Inkompatibilität mit nationalen Rechtsordnungen und die Schwierigkeiten bei der Auslegung des Übereinkommens.
Schlüsselwörter
CISG, Welthandelsrecht, internationales Handelsrecht, Warenkauf, Vertragsrecht, UN-Kaufrecht, Rechtsvereinheitlichung, Rechtsharmonisierung, Handelsbräuche, INCOTERMS, Lex Mercatoria, Rechtssicherheit, Vertragsabwicklung, Rechtsstreitigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was genau ist das CISG?
Das CISG ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, auch bekannt als UN-Kaufrecht.
Kann das CISG als Grundlage für ein Welthandelsrecht angesehen werden?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und analysiert, ob das CISG als "Keim" oder Ausgangsstoff für eine globale Vereinheitlichung des Handelsrechts fungiert.
Welchen Einfluss hat das CISG auf das deutsche Recht?
Das CISG hat die deutsche Schuldrechtsreform maßgeblich beeinflusst und dient als Modell für moderne nationale Gesetzgebungen.
Was sind die Vorteile des UN-Kaufrechts?
Zu den Vorteilen gehören die Steigerung der Rechtssicherheit im grenzüberschreitenden Handel, die Vereinfachung von Vertragsabwicklungen und die Reduzierung von Transaktionskosten.
Was versteht man unter der "Lex Mercatoria"?
Die Lex Mercatoria bezeichnet das nicht-staatliche, übernationale Recht des Welthandels, das aus Handelsbräuchen und allgemeinen Rechtsgrundsätzen besteht und oft im Zusammenhang mit dem CISG genannt wird.
- Citar trabajo
- Pierre Demant (Autor), 2012, Das CISG - Keim eines "Welthandelsrechts"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195547