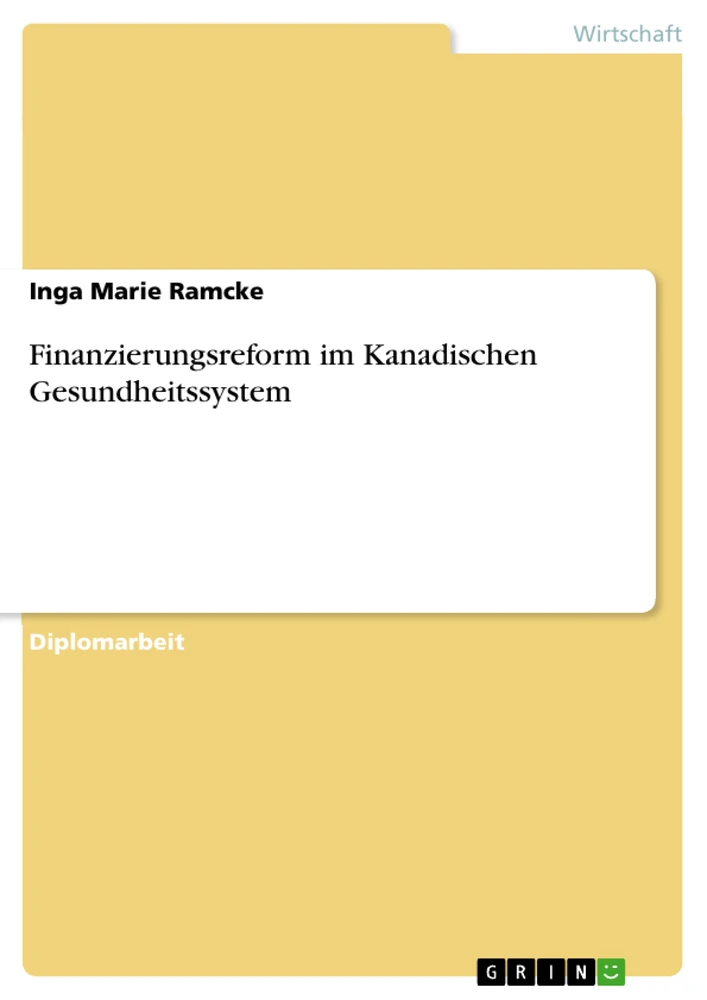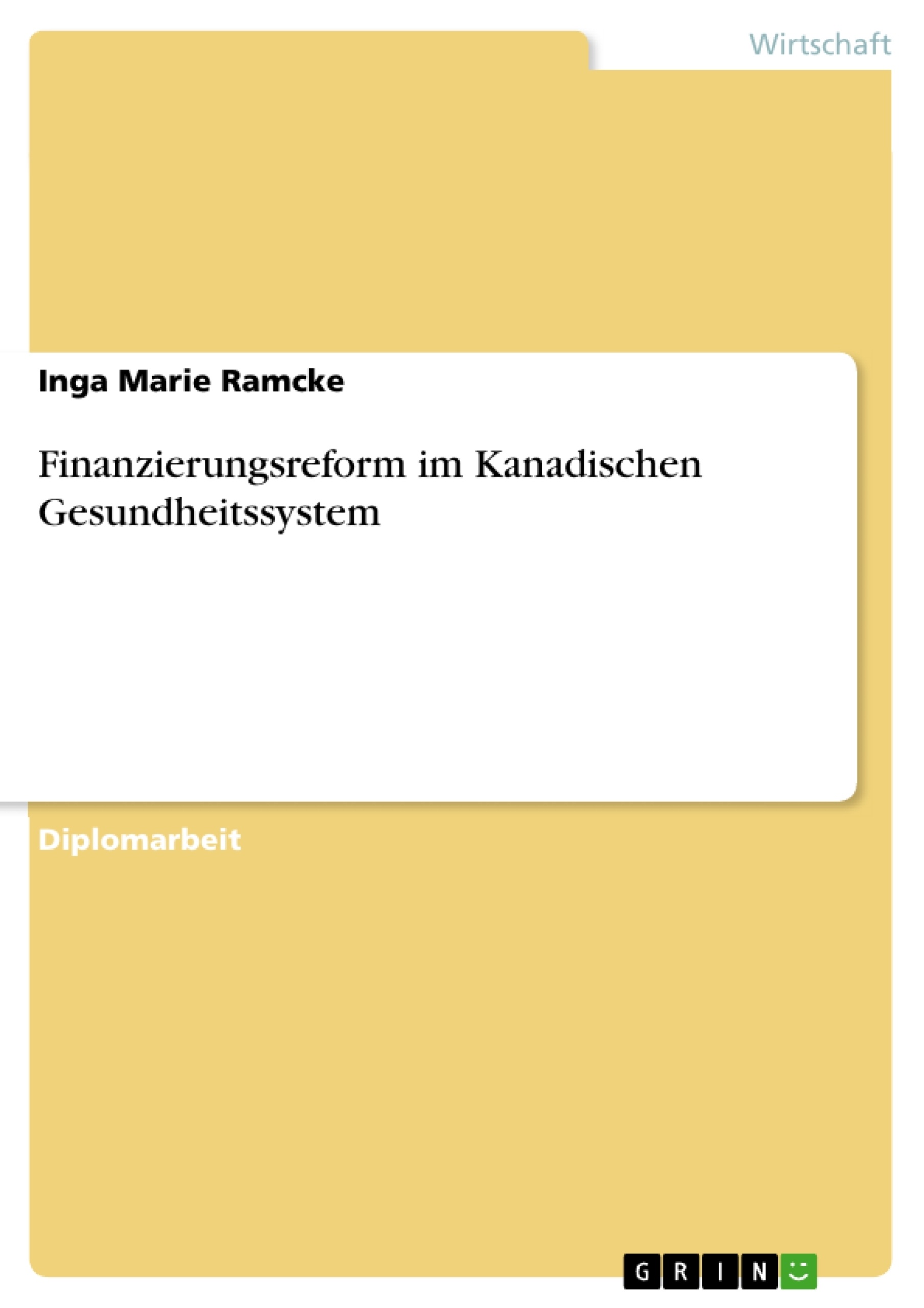Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Finanzierungsreform des Kanadischen Gesundheitssystems.
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in das kanadische Gesundheitssystem, in der auch die Rollenverteilung zwischen Bund und Provinzen / Territorien erläutert wird. Da diese Rollenverteilung Finanzierungsungleichgewichte zur Folge hat, die sich auf das Gesundheitssystem auswirken, werden im darauffolgenden Kapitel die Finanzierungsprobleme behandelt. Dieser Abschnitt beinhaltet ebenfalls das Thema Verdrängungseffekte und demographische Probleme, die großen Einfluss auf das Gesundheitssystem ausüben und zentrale Diskussionspunkte
im Rahmen der Finanzierungsreform darstellen.
Die Finanzierungsungleichgewichte sollen im kanadischen System durch Transferleistungen ausgeglichen werden. Die für das Gesundheitssystem relevanten Transferleistungen werden im
vierten Abschnitt erläutert. Hierbei liegt das Gewicht vor allem auf dem Vorgängermodell des heutigen Canada Health Transfers (CHT), dem Canada Health and Social Transfer (CHST), um im Folgenden die durch die Reformvorschläge eingetretenen Veränderungen beurteilen zu können. Die Reformansätze Romanows und Kirbys sind in Abschnitt fünf dargelegt und analysiert. Hier finden sich ebenfalls die auf Basis der Kommissionsvorlagen erstellten Tabellen. Die Vorschläge
werden mit der Umsetzung in den Folgejahren verglichen. Hierzu dienen die im „Health Care Renewal Accord“ und „10 Jahres Plan“ festgelegten Beschlüsse. Sie werden im letzten Unterabschnitt
mit dem Titel Erfolgsaussichten bewertet. Dort findet sich auch die genaue Darstellung des heutigen Transferleistungsmodells CHT, der aus den Reformvorschlägen hervorging.
Vor dem Fazit werden alternative Finanzierungsvorschläge vorgestellt, die bislang nicht umgesetzt wurden, aber in kritischen Phasen des Gesundheitssystems häufig diskutiert werden. Sie
könnten im Falle einer erneuten Reformphase an Aktualität gewinnen, da sie weitere Möglichkeiten der Umgestaltung bieten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das kanadische Gesundheitssystem
- Rolle der Bundesregierung
- Rolle der Provinzregierung
- Probleme des Systems
- Finanzierungsprobleme
- Vertikales Finanzierungsungleichgewicht
- Transferzahlung CHST
- Horizontales Finanzierungsungleichgewicht
- Ausgleichszahlungsprogramm „Equalization Program“
- Ausgleichszahlungsprogramm „Territorial Formula Financing“
- Neufundland und Labrador und Nova Scotia Abkommen
- Zukünftige Nachfrage
- Verdrängungseffekte
- Demographische Probleme
- Finanzierungsprobleme
- Umstrukturierung der Finanzierung
- Vom Established Program Financing zum Canada Health and Social Transfer
- Established Program Financing
- Canada Assistance Plan
- Canada Health and Social Transfer
- Zahlungsbedingungen
- Kalkulation des CHST
- Verbesserung gegenüber EPF und CAP
- Kritik an CHST
- Vom Established Program Financing zum Canada Health and Social Transfer
- Reformansätze
- Romanow Report
- Kirby
- Health Care Renewal Accord
- 10 Jahres Plan
- Canada Health Transfer
- Weitere Neuerungen
- Alternative Finanzierungsvorschläge
- Nutzungsbeitrag / „User fee“
- Privatisierung
- Steueränderung
- Ansatz der Steuererhöhung auf Bundesebene
- Ansatz der Steuererhöhung auf Provinzebene
- Zuschlag
- Gesundheitssteuer
- Vermehrte Nutzung des Canadian Medical Expense Credit
- Gesundheitskonto
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Finanzierungsreform des kanadischen Gesundheitssystems und die damit verbundenen Herausforderungen. Ziel ist es, verschiedene Reformvorschläge zu untersuchen und deren Vor- und Nachteile zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die komplexen Finanzierungsprobleme, die sich aus dem föderalen System Kanadas ergeben.
- Finanzierungsprobleme des kanadischen Gesundheitssystems
- Analyse der Rollenverteilung zwischen Bund und Provinzen
- Bewertung verschiedener Reformansätze (Romanow Report, Kirby Report etc.)
- Diskussion alternativer Finanzierungsmodelle
- Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Finanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Finanzierungsreform des kanadischen Gesundheitssystems ein und begründet die Notwendigkeit einer Reform aufgrund steigender Kosten und bestehender Defizite. Sie beschreibt den Umfang der Arbeit und die verwendeten Quellen, vor allem die Berichte der Romanow- und Kirby-Kommissionen sowie den "Health Care Renewal Accord" und den "10 Jahres Plan". Die Arbeit hebt die Seltenheit von Literatur zu diesem spezifischen Thema hervor und unterstreicht den innovativen Charakter der durchgeführten Analyse.
Das kanadische Gesundheitssystem: Dieses Kapitel beschreibt das kanadische Gesundheitssystem und die Rollenverteilung zwischen Bundes- und Provinzregierungen. Es beleuchtet die föderale Struktur und die daraus resultierenden Herausforderungen bei der Finanzierung. Die jeweiligen Verantwortlichkeiten und die komplexen Interaktionen zwischen den Regierungsebenen werden detailliert dargestellt. Die Bedeutung dieses Kapitels liegt in der Schaffung eines fundierten Verständnisses der institutionellen Grundlage der Finanzierungsprobleme.
Probleme des Systems: Dieses Kapitel analysiert die finanziellen Herausforderungen des kanadischen Gesundheitssystems. Es untersucht sowohl das vertikale als auch das horizontale Finanzierungsungleichgewicht, wobei konkrete Beispiele wie das „Equalization Program“ und die „Territorial Formula Financing“ erläutert werden. Zusätzlich werden die zukünftigen Herausforderungen wie steigende Nachfrage aufgrund demografischer Veränderungen und Verdrängungseffekte beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der komplexen Interdependenzen und der Auswirkungen der Ungleichgewichte auf die Qualität und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung.
Umstrukturierung der Finanzierung: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Transformation der Finanzierung vom Established Program Financing (EPF) zum Canada Health and Social Transfer (CHST). Die einzelnen Phasen der Reform werden detailliert analysiert, inklusive der Vor- und Nachteile des CHST im Vergleich zum EPF und CAP. Es werden sowohl die Gründe für die Reform als auch die damit verbundenen Kritikpunkte umfassend diskutiert. Das Kapitel liefert einen wichtigen Einblick in die historische Entwicklung der Gesundheitsfinanzierung in Kanada und die Motive hinter den jeweiligen Reformen.
Reformansätze: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Reformansätze, darunter die Berichte von Romanow und Kirby sowie den "Health Care Renewal Accord" und den "10 Jahres Plan". Die verschiedenen Vorschläge werden verglichen und kritisch bewertet. Es wird die unterschiedliche Herangehensweise an das Problem der Finanzierung beleuchtet und die jeweiligen Stärken und Schwächen aufgezeigt. Das Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Debatte um die Reform des kanadischen Gesundheitssystems.
Alternative Finanzierungsvorschläge: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene alternative Finanzierungsmodelle, wie z.B. Nutzungsbeiträge ("User fees"), Privatisierung und Steueränderungen auf Bundes- und Provinzebene. Es diskutiert die Vor- und Nachteile jedes Ansatzes und deren potenzielle Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Der Fokus liegt auf der umfassenden Darstellung verschiedener Optionen und einer kritischen Bewertung ihrer Machbarkeit und Implikationen. Die ausführliche Betrachtung verschiedener Alternativen zeigt die Komplexität und die Diversität der Lösungsansätze.
Schlüsselwörter
Finanzierungsreform, kanadisches Gesundheitssystem, Föderalismus, Finanzierungsungleichgewicht, Romanow Report, Kirby Report, Canada Health and Social Transfer (CHST), Established Program Financing (EPF), Canada Assistance Plan (CAP), Health Care Renewal Accord, 10 Jahres Plan, Nutzungsbeiträge, Privatisierung, Steuererhöhung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Finanzierungsreform des kanadischen Gesundheitssystems
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert die Finanzierungsreform des kanadischen Gesundheitssystems und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie untersucht verschiedene Reformvorschläge und deren Vor- und Nachteile, wobei der Fokus auf den komplexen Finanzierungsproblemen liegt, die sich aus dem föderalen System Kanadas ergeben.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Finanzierungsprobleme des kanadischen Gesundheitssystems, die Rollenverteilung zwischen Bund und Provinzen, verschiedene Reformansätze (Romanow Report, Kirby Report etc.), alternative Finanzierungsmodelle, und die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Finanzierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, dem kanadischen Gesundheitssystem (inkl. Rollen von Bund und Provinzen), den Problemen des Systems (vertikales und horizontales Finanzierungsungleichgewicht, zukünftige Nachfrage), der Umstrukturierung der Finanzierung (EPF zu CHST), Reformansätzen (Romanow, Kirby, Health Care Renewal Accord, 10-Jahres-Plan), alternativen Finanzierungsvorschlägen (Nutzungsbeiträge, Privatisierung, Steueränderungen etc.) und einem Fazit.
Was sind die wichtigsten Finanzierungsprobleme des kanadischen Gesundheitssystems?
Die Arbeit identifiziert vertikales und horizontales Finanzierungsungleichgewicht als zentrale Probleme. Das vertikale Ungleichgewicht betrifft die Aufteilung der Finanzierung zwischen Bund und Provinzen, während das horizontale Ungleichgewicht die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Provinzen betrifft. Zusätzlich werden steigende Nachfrage aufgrund demografischer Veränderungen und Verdrängungseffekte als zukünftige Herausforderungen genannt.
Welche Reformansätze werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Reformansätze, darunter die Berichte von Romanow und Kirby, den "Health Care Renewal Accord" und den "10-Jahres-Plan". Diese werden hinsichtlich ihrer Herangehensweise an das Finanzierungsproblem, ihrer Stärken und Schwächen verglichen und kritisch bewertet.
Welche alternativen Finanzierungsmodelle werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert alternative Finanzierungsmodelle wie Nutzungsbeiträge ("User fees"), Privatisierung, Steueränderungen auf Bundes- und Provinzebene, eine Gesundheitssteuer, vermehrte Nutzung des Canadian Medical Expense Credit und die Einführung eines Gesundheitskontos. Für jeden Ansatz werden Vor- und Nachteile und deren potenzielle Auswirkungen auf das Gesundheitssystem erörtert.
Welche Rolle spielen der Bund und die Provinzen in der Finanzierung des kanadischen Gesundheitssystems?
Die Arbeit beschreibt die komplexe Rollenverteilung zwischen Bund und Provinzen und die daraus resultierenden Herausforderungen bei der Finanzierung. Die jeweiligen Verantwortlichkeiten und die Interaktionen zwischen den Regierungsebenen werden detailliert dargestellt, um das institutionelle Fundament der Finanzierungsprobleme zu verdeutlichen.
Wie wird die historische Entwicklung der Gesundheitsfinanzierung in Kanada dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die Transformation der Finanzierung vom Established Program Financing (EPF) zum Canada Health and Social Transfer (CHST). Die einzelnen Phasen der Reform werden detailliert analysiert, inklusive der Vor- und Nachteile des CHST im Vergleich zum EPF und CAP. Die Gründe für die Reform und die damit verbundenen Kritikpunkte werden umfassend diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Finanzierungsreform, kanadisches Gesundheitssystem, Föderalismus, Finanzierungsungleichgewicht, Romanow Report, Kirby Report, Canada Health and Social Transfer (CHST), Established Program Financing (EPF), Canada Assistance Plan (CAP), Health Care Renewal Accord, 10-Jahres-Plan, Nutzungsbeiträge, Privatisierung, Steuererhöhung.
- Arbeit zitieren
- Inga Marie Ramcke (Autor:in), 2007, Finanzierungsreform im Kanadischen Gesundheitssystem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195597