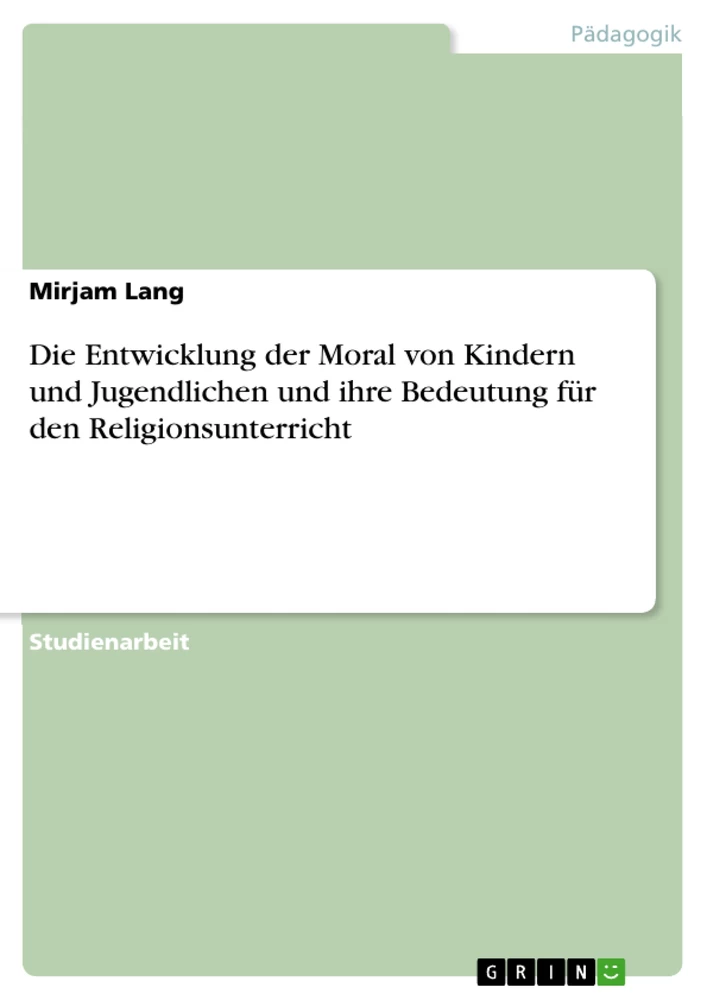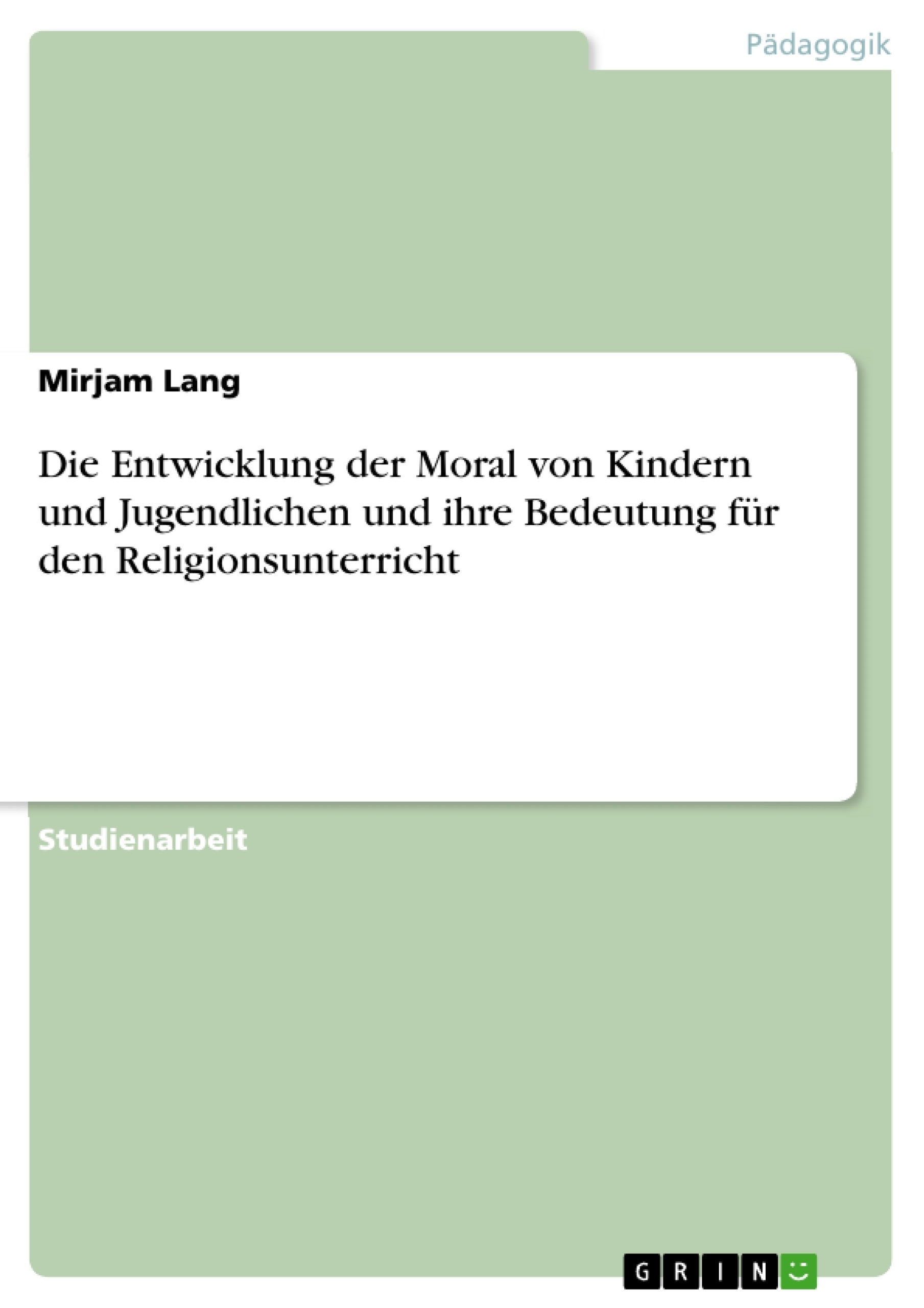1. Lawrence Kohlberg: Entwicklung des moralischen Urteils 6
1.1 Moralische Dilemmata 7
1.2 Stufenkonzept 9
1.2.1 Präkonventionelle Ebene 10
1.2.2 Konventionelle Ebene 10
1.2.3 Zwischen- bzw. Übergangsebene 11
2.2.4 Postkonventionelle Ebene 11
2. Carol Gilligans Thesen einer „weiblichen Moralauffassung“ 13
2.1 Konzept der zwei Moralen: Fürsorge- und Gerechtigkeitsmoral 13
2.2 Gilligans Stufenmodell der weiblichen Moralentwicklung 14
2.2.1 Präkonventionelle Moral: Orientierung am individuellen Überleben 15
2.2.2 Konventionelle Moral: Orientierung an Konventionen 15
2.2.3 Postkonventionelle Moral: Die Moral der Gewaltlosigkeit 15
2.3 Kritik an Gilligans Theorie (Nunner-Winkler) 16
3. Bedeutung und Konsequenzen für die Pädagogik 17
3.1 Gilligans Konsequenzen für die Pädagogik 18
3.2 Kohlbergs „Just-Community“-Ansatz 19
4. John Rawls 21
Zusammenfassung 24
Literaturverzeichnis: 26
Inhalt
1. Lawrence Kohlberg: Entwicklung des moralischen Urteils
1.1 Moralische Dilemmata
1.2 Stufenkonzept
1.2.1 Präkonventionelle Ebene
1.2.2 Konventionelle Ebene
1.2.3 Zwischen- bzw. Übergangsebene
2.2.4 Postkonventionelle Ebene
2. Carol Gilligans Thesen einer „weiblichen Moralauffassung“
2.1 Konzept der zwei Moralen: Fürsorge- und Gerechtigkeitsmoral
2.2 Gilligans Stufenmodell der weiblichen Moralentwicklung
2.2.1 Präkonventionelle Moral: Orientierung am individuellen Überleben
2.2.2 Konventionelle Moral: Orientierung an Konventionen
2.2.3 Postkonventionelle Moral: Die Moral der Gewaltlosigkeit
2.3 Kritik an Gilligans Theorie (Nunner-Winkler)
3. Bedeutung und Konsequenzen für die Pädagogik
3.1 Gilligans Konsequenzen für die Pädagogik
3.2 Kohlbergs „Just-Community“- Ansatz
4. John Rawls
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis:
Häufig gestellte Fragen
Welche Stufen umfasst das Modell von Lawrence Kohlberg?
Kohlberg unterscheidet die präkonventionelle Ebene (Eigennutz), die konventionelle Ebene (soziale Ordnung) und die postkonventionelle Ebene (universelle Prinzipien).
Was ist Carol Gilligans Hauptkritik an Kohlberg?
Gilligan kritisiert, dass Kohlbergs Modell eine männlich dominierte Gerechtigkeitsmoral bevorzugt und die weiblich geprägte Fürsorgemoral vernachlässigt.
Was versteht man unter „Fürsorgemoral“?
Nach Gilligan ist dies eine Moralauffassung, die auf Beziehungsgeflechten, Verantwortung füreinander und der Vermeidung von Leid basiert.
Welche Bedeutung haben diese Theorien für den Religionsunterricht?
Sie helfen Lehrkräften, die moralische Urteilsfähigkeit von Schülern einzuschätzen und Themen wie Dilemmata und ethische Werte altersgerecht zu vermitteln.
Was ist der „Just-Community“-Ansatz?
Ein pädagogisches Konzept von Kohlberg, bei dem Schulen als demokratische Gemeinschaften organisiert werden, um moralisches Handeln praktisch zu üben.
Welche Rolle spielt John Rawls in diesem Kontext?
Rawls' Theorie der Gerechtigkeit dient oft als philosophische Ergänzung zu Kohlbergs Modell, insbesondere bei der Frage nach fairen gesellschaftlichen Strukturen.
- Citar trabajo
- Mirjam Lang (Autor), 2011, Die Entwicklung der Moral von Kindern und Jugendlichen und ihre Bedeutung für den Religionsunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195668