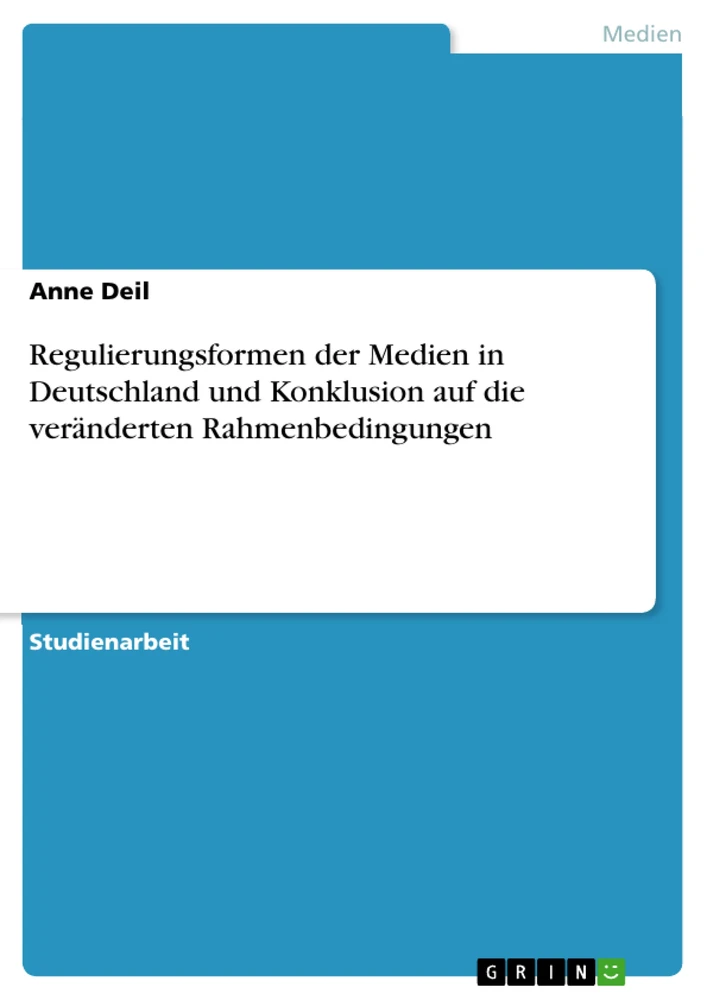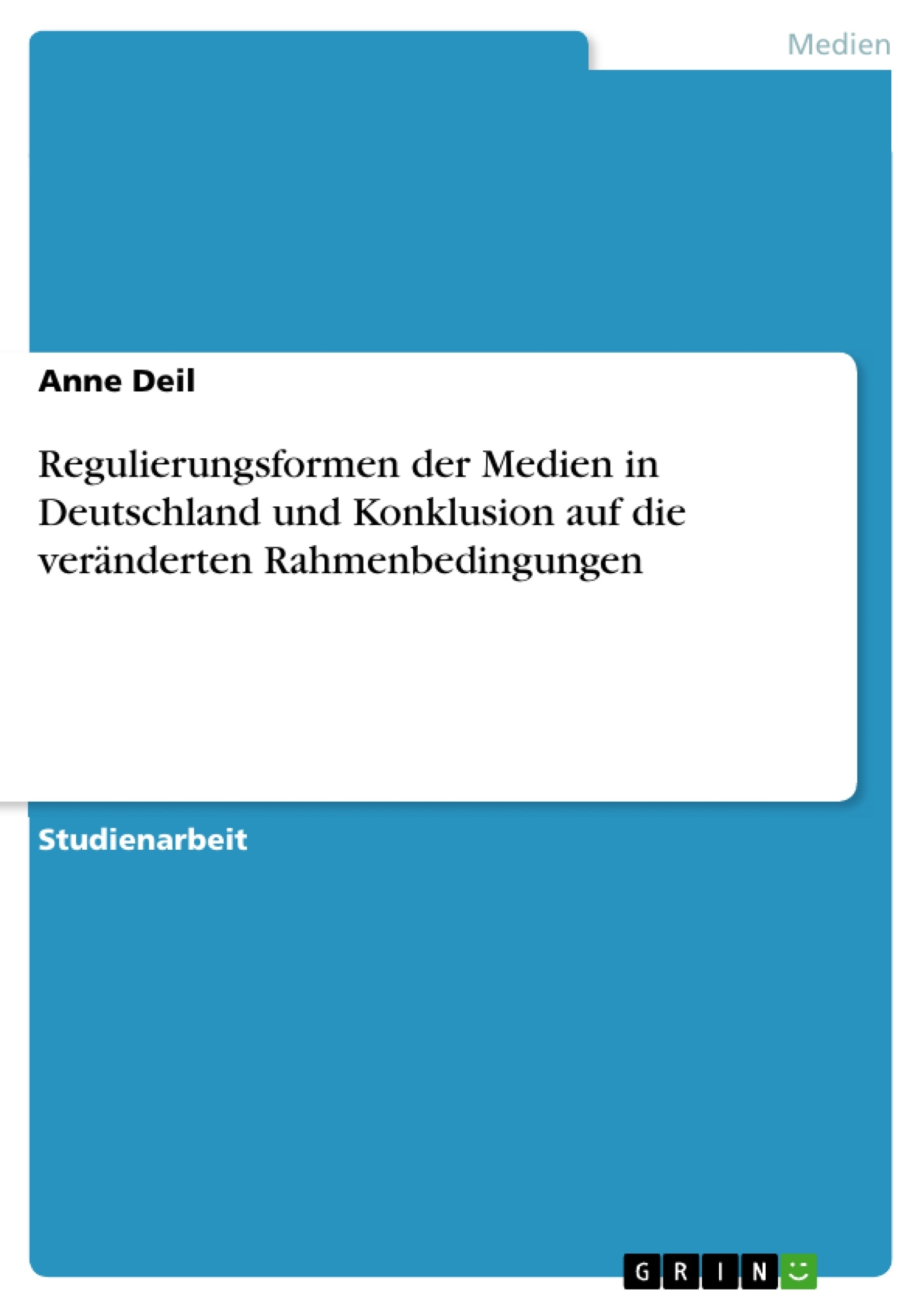Aufgrund der Deregulierung der Medienpolitik ab den 70er Jahren konnten unter anderem in Deutschland verschiedene Formen der Medienregulierung entstehen. Der Wandel von staatlicher Regulierung zu einer Deregulierung, der häufig mit einer Loslösung von unnötigen Einschränkungen verglichen wird, wurde aufgrund vermehrter Kritik am staatlichen Umgang mit politischen, sozialen, ökonomischen und technischen Veränderungen begründet.
Als neue Regulierungsform entstand unter anderem die Selbstregulierung; dies bedeutet, dass die Regulierung nicht der Staat übernimmt, sondern eigene Mitglieder oder Vertreter der Regulierten dafür zuständig sind. Jedoch stellt sich laut Puppis die Frage, inwieweit auch der Staat an der Selbstregulierung beteiligt sein soll, da es unklar ist, ob Selbstregulierung wirklich im öffentlichen Interesse liegt. Aus diesem Grund kann man noch von einer weiteren Regulierungsform sprechen, der Co-Regulierung. Diese bezeichnet die Zusammenarbeit von staatlicher Regulierung und Selbstregulierung. Die Verantwortung wird demnach zwischen dem Staat und den Selbstregulierungsorganisationen aufgeteilt. Als letzte Form der Regulierung nimmt auch die Media Governance einen wichtigen Platz ein. Puppis (2007) führt dazu aus: „Media Governance, verstanden als horizontale Ausweitung von Government, umfasst sowohl staatliche Medienregulierung als auch Selbst- und Co-Reguliuerung im Mediensektor.“
Da es in heutigen Gesellschaften immer mehr zu einem Differenzierungsprozess kommt, sich also die Teilbereiche in immer mehr Subsysteme untergliedern, ist es kaum noch möglich regulierend auf bestimmte Institutionen einzuwirken. Die heutige Medienpolitik und Medienregulierung muss sich außerdem der Herausforderung stellen, den politischen, ökonomischen, technischen und soziokulturellen Veränderungen gerecht zu werden. Im folgenden werden die einzelnen Regulierungsformen erläutert, jedoch wird hierbei nur exemplarisch auf einzelne Teilbereiche eingegangen. Außerdem soll die Frage geklärt werden, wie und in welchem Maße die Regulierung der Medien an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst wird.
Inhaltsverzeichnis
- Unterschiedliche Regulierungsformen der Medien in Deutschland
- Regulierung der Medien
- Definition und Ziele der Regulierung
- Gründe für die Regulierung der Medien
- Fremdregulierung
- Definition und Modelle am Beispiel der Telekommunikations- und Internetregulierung
- Die Akteure der Fremdregulierung
- Selbstregulierung
- Was ist Selbstregulierung?
- Selbstregulierung am Beispiel der FSM
- Co-Regulierung
- Co-Regulierung als Mischform zwischen staatlicher und privater Regulierung
- Jugendschutz als Beispiel für Co-Regulierung
- Media Governance
- Was ist Media Governance, welche Formen gibt es und wer ist daran beteiligt?
- Der Rundfunkrat als Beispiel für Media Governance
- Veränderung der Rahmenbedingungen und Konklusion
- Veränderung der Rahmenbedingungen
- Reaktion auf die Veränderungen
- Medienpolitik- und Regulierung als Gratwanderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Regulierungsformen der Medien in Deutschland und analysiert deren Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung von staatlicher Regulierung hin zu Selbst- und Co-Regulierung, sowie den Einfluss von Media Governance.
- Unterschiedliche Regulierungsformen (Fremd-, Selbst-, Co-Regulierung)
- Der Einfluss der Deregulierung seit den 1970er Jahren
- Die Rolle des Staates in der Medienregulierung
- Anpassung der Regulierung an technische und gesellschaftliche Veränderungen
- Media Governance als umfassenderer Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Unterschiedliche Regulierungsformen der Medien in Deutschland: Die Deregulierung der Medienpolitik ab den 1970er Jahren führte zur Entstehung verschiedener Regulierungsformen in Deutschland. Neben der staatlichen Fremdregulierung etablierten sich Selbstregulierung, in der die Regulierten selbst die Verantwortung übernehmen, und Co-Regulierung als Kooperation zwischen Staat und Selbstregulierungsorganisationen. Die Arbeit untersucht diese Entwicklung im Kontext des gesellschaftlichen Differenzierungsprozesses und der Notwendigkeit, auf politische, ökonomische, technische und soziokulturelle Veränderungen zu reagieren.
Regulierung der Medien: Dieses Kapitel definiert Medienregulierung als allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen über Medienorganisationen und die massenmediale Kommunikation, inklusive deren Implementierung. Es beschreibt die Ziele der Regulierung – die Gestaltung von Handlungssystemen zur Erreichung bestimmter Zustände – und untersucht verschiedene Ansätze (interessen-, institutionen- und ideenzentriert) zum Verständnis von Regulierungsprozessen. Die Kapitel beleuchtet auch die Gründe für Medienregulierung, wie Frequenzknappheit, Zugang zur Infrastruktur, Schutz vor Marktversagen, und die Wahrung der sozialen, kulturellen und politischen Bedeutung der Medien.
Fremdregulierung: Das Kapitel erklärt Fremdregulierung als staatliche Festlegung, Durchsetzung und Sanktionierung von Regeln für Medienorganisationen und öffentliche Kommunikation. Es konzentriert sich auf die Telekommunikations- und Internetregulierung, die durch Deregulierung und Privatisierung in den 1970er Jahren relevant wurde. Die staatliche Regulierung zielt darauf ab, einen fairen Wettbewerb unter Telekommunikationsunternehmen zu gewährleisten und den Missbrauch von Marktmacht zu verhindern, insbesondere durch Regulierungen in den Bereichen Zugangsverpflichtung, Interkonnektionsverpflichtung, Preisregulierung, Nummernportabilität und Wahlparität.
Selbstregulierung: Der Abschnitt behandelt Selbstregulierung, bei der die Regulierung nicht vom Staat, sondern von den Betroffenen selbst übernommen wird. Es stellt die Frage nach dem angemessenen Verhältnis zwischen Selbstregulierung und staatlicher Beteiligung, insbesondere in Bezug auf das öffentliche Interesse. Am Beispiel der FSM (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) wird ein konkreter Fall von Selbstregulierung näher betrachtet.
Co-Regulierung: Dieses Kapitel erläutert Co-Regulierung als Mischform aus staatlicher und privater Regulierung, bei der die Verantwortung zwischen Staat und Selbstregulierungsorganisationen aufgeteilt wird. Es untersucht den Jugendschutz als Beispiel für Co-Regulierung, um die praktische Umsetzung und Herausforderungen dieser Mischform zu verdeutlichen.
Media Governance: Der Abschnitt definiert Media Governance als horizontale Erweiterung von Government, welche staatliche Medienregulierung, Selbst- und Co-Regulierung im Mediensektor umfasst. Es beleuchtet die verschiedenen Formen von Media Governance und die beteiligten Akteure und nimmt den Rundfunkrat als Beispiel für Media Governance unter die Lupe.
Schlüsselwörter
Medienregulierung, Fremdregulierung, Selbstregulierung, Co-Regulierung, Media Governance, Deregulierung, Telekommunikationsregulierung, Internetregulierung, Jugendschutz, öffentliches Interesse, Medienpolitik, Rahmenbedingungen, Marktversagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Regulierungsformen der Medien in Deutschland
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht verschiedene Regulierungsformen der Medien in Deutschland und analysiert deren Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Sie beleuchtet die Entwicklung von staatlicher Regulierung hin zu Selbst- und Co-Regulierung sowie den Einfluss von Media Governance.
Welche Regulierungsformen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Fremdregulierung (staatliche Regulierung), Selbstregulierung (von den Betroffenen selbst), und Co-Regulierung (Kooperation zwischen Staat und Selbstregulierungsorganisationen). Sie analysiert diese im Kontext der Deregulierung seit den 1970er Jahren.
Was ist Fremdregulierung und welche Beispiele werden genannt?
Fremdregulierung beschreibt staatliche Festlegung, Durchsetzung und Sanktionierung von Regeln für Medienorganisationen und öffentliche Kommunikation. Die Arbeit konzentriert sich auf die Telekommunikations- und Internetregulierung als Beispiel, inklusive Aspekten wie Zugangsverpflichtung, Interkonnektionsverpflichtung, Preisregulierung, Nummernportabilität und Wahlparität.
Was ist Selbstregulierung und welches Beispiel wird verwendet?
Selbstregulierung bedeutet, dass die Regulierung nicht vom Staat, sondern von den Betroffenen selbst übernommen wird. Die Arbeit analysiert die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSM) als konkretes Beispiel.
Was ist Co-Regulierung und welches Beispiel wird genannt?
Co-Regulierung ist eine Mischform aus staatlicher und privater Regulierung. Der Jugendschutz dient als Beispiel, um die praktische Umsetzung und Herausforderungen dieser Mischform zu verdeutlichen.
Was ist Media Governance und welches Beispiel wird genannt?
Media Governance ist eine horizontale Erweiterung von Government und umfasst staatliche Medienregulierung, Selbst- und Co-Regulierung im Mediensektor. Der Rundfunkrat wird als Beispiel für Media Governance untersucht.
Welche Ziele verfolgt die Medienregulierung?
Die Ziele der Medienregulierung umfassen die Gestaltung von Handlungssystemen zur Erreichung bestimmter Zustände. Die Arbeit untersucht verschiedene Ansätze (interessen-, institutionen- und ideenzentriert) zum Verständnis dieser Prozesse. Gründe für die Regulierung sind unter anderem Frequenzknappheit, Zugang zur Infrastruktur, Schutz vor Marktversagen und die Wahrung der sozialen, kulturellen und politischen Bedeutung der Medien.
Wie hat sich die Medienregulierung in Deutschland entwickelt?
Die Deregulierung der Medienpolitik ab den 1970er Jahren führte zur Entstehung verschiedener Regulierungsformen. Die Arbeit untersucht diese Entwicklung im Kontext des gesellschaftlichen Differenzierungsprozesses und der Notwendigkeit, auf politische, ökonomische, technische und soziokulturelle Veränderungen zu reagieren.
Welche Rolle spielt der Staat in der Medienregulierung?
Die Arbeit analysiert die Rolle des Staates in der Medienregulierung, insbesondere im Verhältnis zu Selbst- und Co-Regulierung. Sie untersucht den Wandel vom staatlichen Monopol hin zu einer stärker verteilten Verantwortung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Medienregulierung, Fremdregulierung, Selbstregulierung, Co-Regulierung, Media Governance, Deregulierung, Telekommunikationsregulierung, Internetregulierung, Jugendschutz, öffentliches Interesse, Medienpolitik, Rahmenbedingungen, Marktversagen.
- Citar trabajo
- Anne Deil (Autor), 2011, Regulierungsformen der Medien in Deutschland und Konklusion auf die veränderten Rahmenbedingungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195689