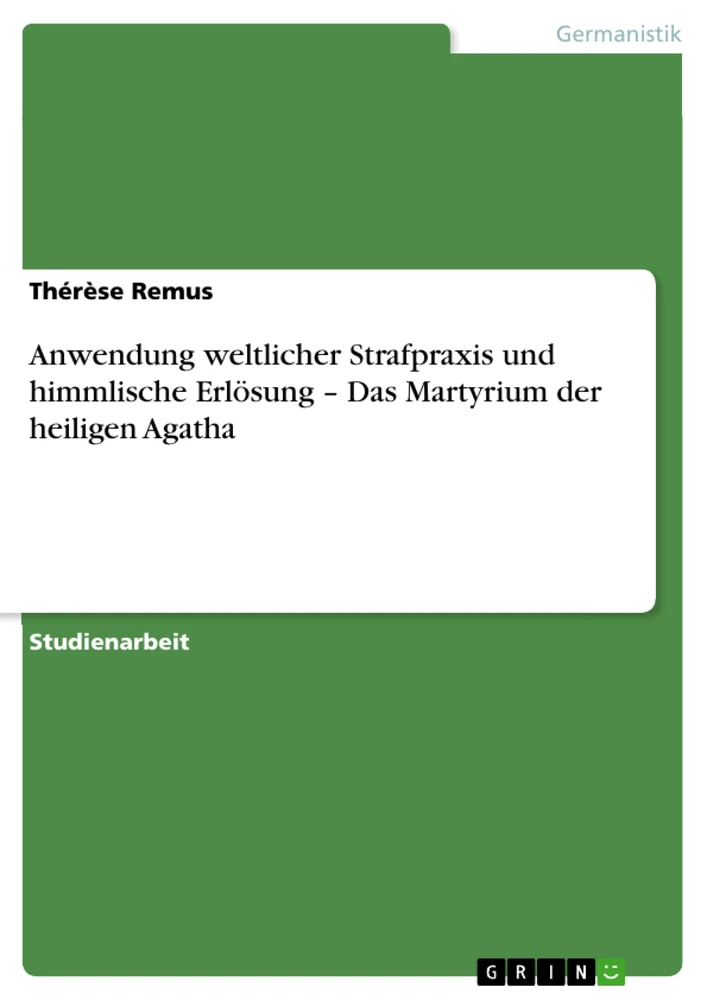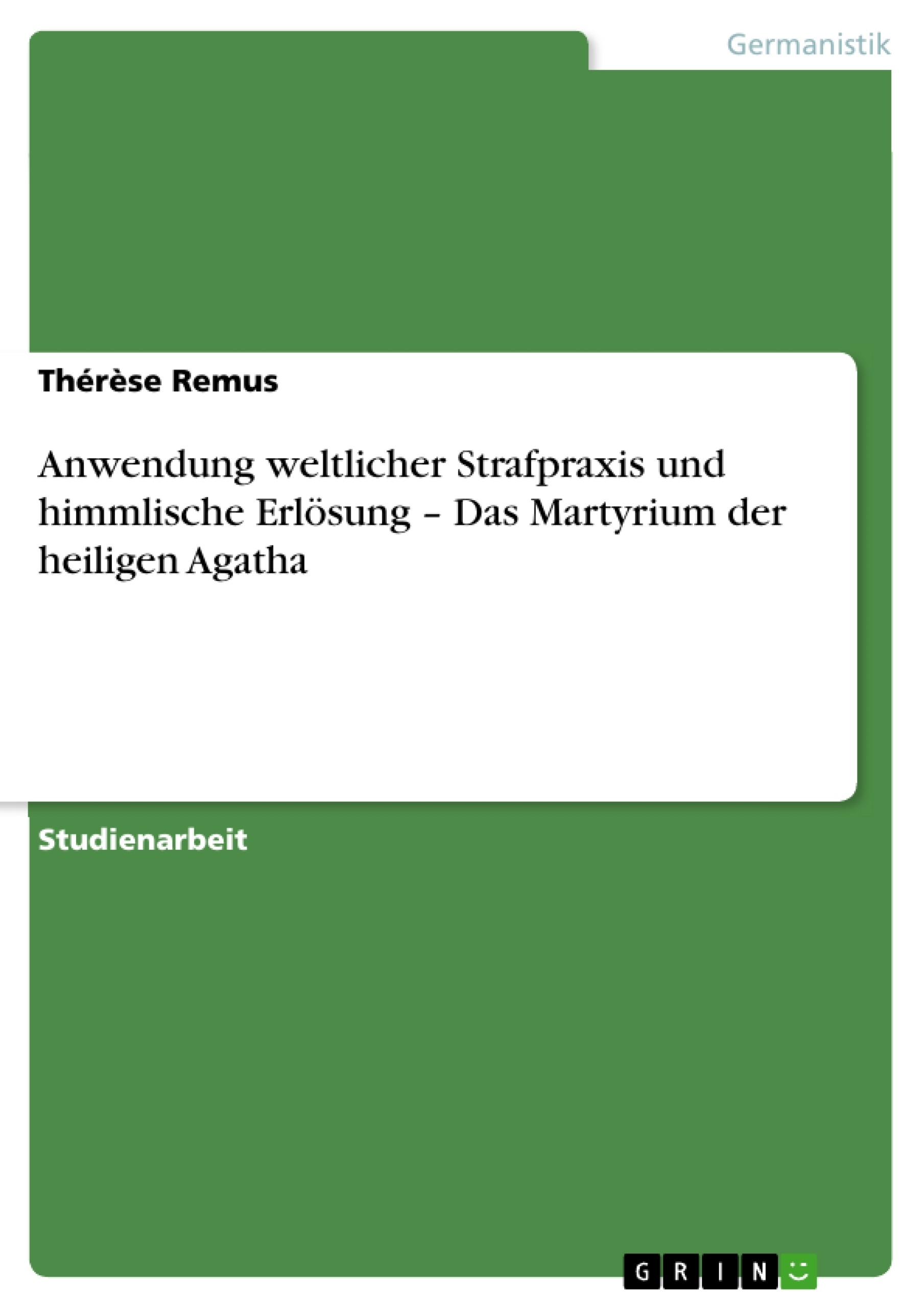Ausgehend von der Faszination, welche die vom Dominikaner Jacobus de Voragine in seiner Sammlung "Legenda Aurea" gesammelten Heiligen-Legenden auf auf die Leserschaft vom Mittelalter bis zur Gegenwart ausübt, wird in der Arbeit die Legende der Heiligen Agatha besonders in den Blick genommen. Es wird untersucht, woher die schaurig-spannende Wirkung rüht, welche die Märtyrer-Legenden ausstrahlen. Besondere Berücksichtigung erfährt die Symbolik der Martern (zB. das Abschneiden der Brüste) als Ausdruck der weltlichen Strafe, welche mit Rekurrenz auf Foucault und seiner Betrachtung des mittelalterlichen Strafsystems zur Analyse des Aufbaus dieser Heiligen-Legende verhandelt wird. Abschließend werden Bezüge zur gegenwärtigen Strafpraxis hergestellt und die Relevanz der Textgattung "Heiligenlegende" als kulturelles Vermächtnis diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Relevanz der Thematik
- Die Legende der heiligen Agatha
- Mittelalterliche Körperkonzepte
- Die Beschreibung des Körpers von „außen“: Die Marter als weltliche Strafpraxis
- Das Versagen des weltlichen Aufschreibsystems
- Die Negierung des irdischen Leibes: Agathas Sehnsucht nach dem Martyrium
- Die Wundertätigkeit der heiligen Reste
- Schlussbemerkungen
- Literaturverzeichnis
- Quellentexte
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Martyrium der heiligen Agatha im Kontext mittelalterlicher Krankheitsdiskurse und Körperkonzepte. Sie untersucht die Symbolik der Martern sowie die Rolle der Folter als weltliches Strafritual im Mittelalter. Im Mittelpunkt stehen die Darstellung des Körpers in der Legende und die Frage, wie die heilige Agatha durch ihr Martyrium sowohl eine weltliche Strafe erfährt als auch eine himmlische Erlösung erlangt.
- Die Legende der heiligen Agatha als literarisches und religiöses Dokument
- Der Körper der heiligen Agatha als Ort von weltlicher Strafpraxis und himmlischer Erlösung
- Die Symbolik der Martern und ihre Bedeutung im Kontext des mittelalterlichen Krankheitsverständnisses
- Die Rolle der Folter im Mittelalter und ihre Funktion als Instrument der Macht
- Agathas Widerstand und ihre Sehnsucht nach dem Martyrium als Ausdruck ihrer Glaubensüberzeugung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Relevanz der Thematik und erläutert den historischen und literarischen Kontext des Heiligenlebens. Das zweite Kapitel stellt die Legende der heiligen Agatha vor und schildert Agathas Lebensweg sowie ihre Begegnung mit dem römischen Statthalter Quintianus. Im dritten Kapitel werden die mittelalterlichen Körperkonzepte im Kontext des Martyriums erörtert. Es werden die Beschreibung des Körpers von „außen“ als Ort der Marter, das Versagen des weltlichen Aufschreibsystems, Agathas Sehnsucht nach dem Martyrium und die Wundertätigkeit der heiligen Reste untersucht.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Literatur, Heiligenleben, Martyrium, Körperkonzepte, Folter, Strafpraxis, Erlösung, Glaubensüberzeugung, Heilige Agatha, Passional.
Häufig gestellte Fragen
Wer war die heilige Agatha?
Die heilige Agatha war eine frühchristliche Märtyrerin, deren Legende unter anderem in der berühmten Sammlung „Legenda Aurea“ des Jacobus de Voragine überliefert ist.
Welche Symbolik hat das Abschneiden der Brüste in der Legende?
Es symbolisiert die grausame weltliche Strafpraxis und den Versuch, die weibliche Identität und Reinheit zu brechen, was Agatha jedoch durch ihren standhaften Glauben überwindet.
Wie wird die Folter im Mittelalter in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit nutzt Ansätze von Michel Foucault, um die Folter als ein öffentliches Ritual der Macht und als Teil des mittelalterlichen Strafsystems zu untersuchen.
Was bedeutet die „Negierung des irdischen Leibes“?
Agatha sieht ihren Körper nicht als wertvoll an sich an, sondern sehnt sich nach dem Martyrium als Weg zur himmlischen Erlösung und Vereinigung mit Gott.
Welche Rolle spielen „heilige Reste“ (Reliquien)?
Die Legende betont die Wundertätigkeit der Überreste der Heiligen, die als Beweis für ihre göttliche Erwählung und ihre fortdauernde Kraft nach dem Tod gelten.
Ist die Gattung der Heiligenlegende heute noch relevant?
Ja, sie wird in der Arbeit als wichtiges kulturelles Vermächtnis diskutiert, das Aufschluss über historische Körperkonzepte und religiöse Mentalitäten gibt.
- Arbeit zitieren
- Thérèse Remus (Autor:in), 2009, Anwendung weltlicher Strafpraxis und himmlische Erlösung – Das Martyrium der heiligen Agatha, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195779