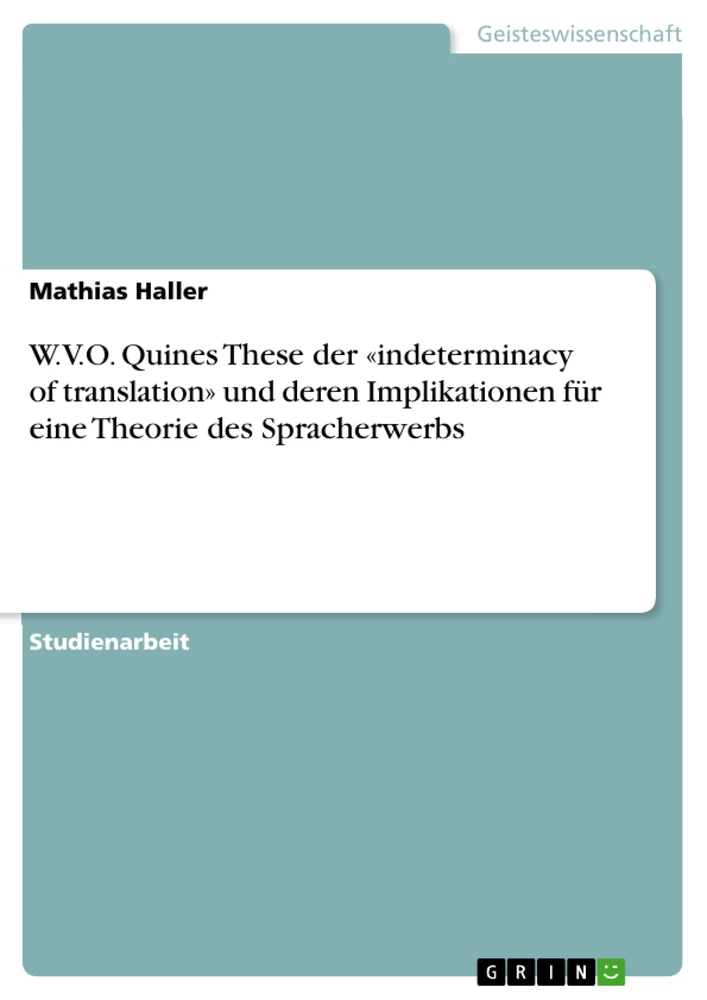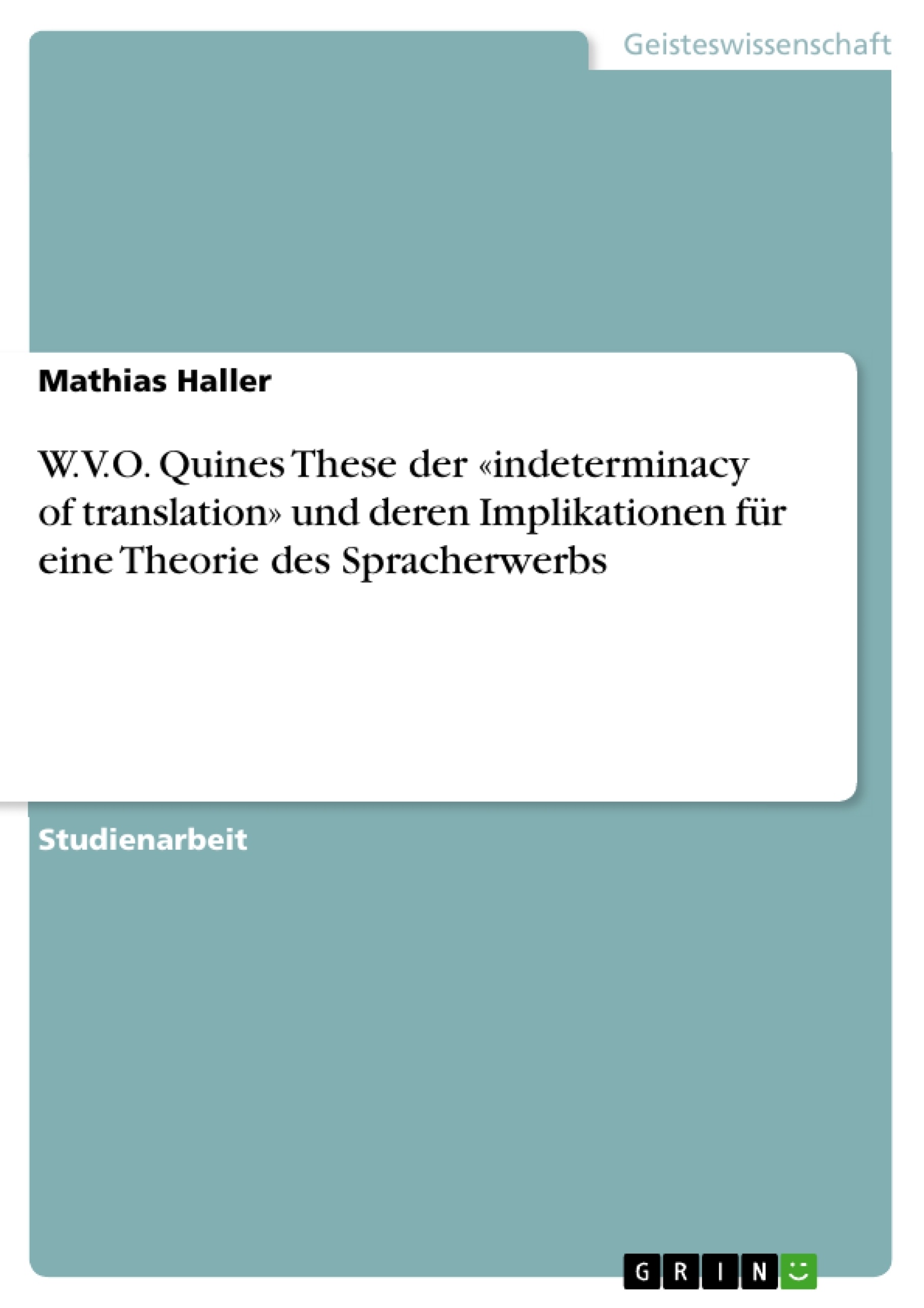Willard Van Orman Quine gilt als einer der einflussreichsten und am meisten diskutierten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen nimmt sein 1960 erschienenes Buch Word and Object einen besonders kontroversen Stellenwert ein. Vor allem das darin enthaltene Gedankenexperiment der «radical translation» hat weit über das eigentliche Feld der analytischen Philosophie hinaus Berühmtheit erlangt. Dieses berühmt-berüchtigte Gedankenexperiment stellt den Ausganspunkt der vorliegenden Arbeit dar. In einem ersten Schritt werden, ausgehend von der „Dschungelszene“, in der Quines «radical translation» passiert, die für seine Argumentation zentralen Begriffe erarbeitet. In einem weiteren Schritt wird das Argument, das zu Quines These der «indeterminacy of translation» führt, rekonstruiert. Im Folgenden sollen die darin enthaltenen Prämissen zu Quines behaviouristischer Konzeption von Sprache auf den Erstspracherwerb übertragen werden. Die Idee dahinter ist, dass es eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen der «radical translation» und dem Erstspracherwerb gibt. Dabei steht eine Frage im Zentrum: Wenn sprachlernende Kinder mit denselben Problemen konfrontiert sind, wie urübersetzende Feldlinguisten, wie ist es dann zu erklären, dass der Erstspracherwerb in den meisten Fällen so verblüffend gut funktioniert? Diese Frage ist der Anknüpfungspunkt zweier nativistischer Einwände gegen Quines Spracherwerbstheorie, auf die ich im weiteren Verlauf der Arbeit den Fokus richten werde. Es sind die „Unzulänglichkeit des Stimulus“ und die „Ambiguität ostensiver Definition“. Zum Abschluss werde ich die Kritik an Quine, die bei diesen beiden Einwänden ansetzt, zumindest teilweise zurückzuweisen versuchen.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Radical Translation
II.I. Die Dschungelszene
II.II. Reizbedeutung
II.III. Unbestimmheit des Bezugs
II.IV. Analytische Hypothesen
II.V. Unterdeterminiertheit der Übersetzung und Bedeutungsskepsis
III. Erster nativistischer Einwand: Unzulänglichkeit des Stimulus
IV. Zweiter nativistischer Einwand: Ambiguität ostensiver Definition
V. Sind die nativistischen Einwände gerechtfertigt?
VI. Schlusswort
VII. Literaturverzeichnis:
- Arbeit zitieren
- Mathias Haller (Autor:in), 2009, W.V.O. Quines These der «indeterminacy of translation» und deren Implikationen für eine Theorie des Spracherwerbs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195862