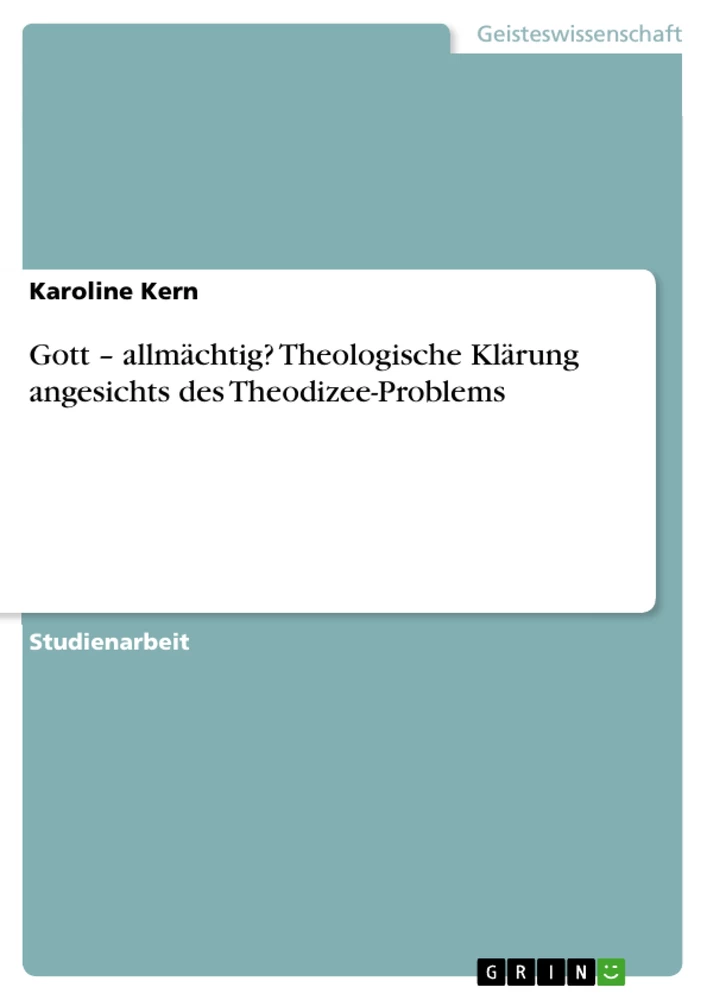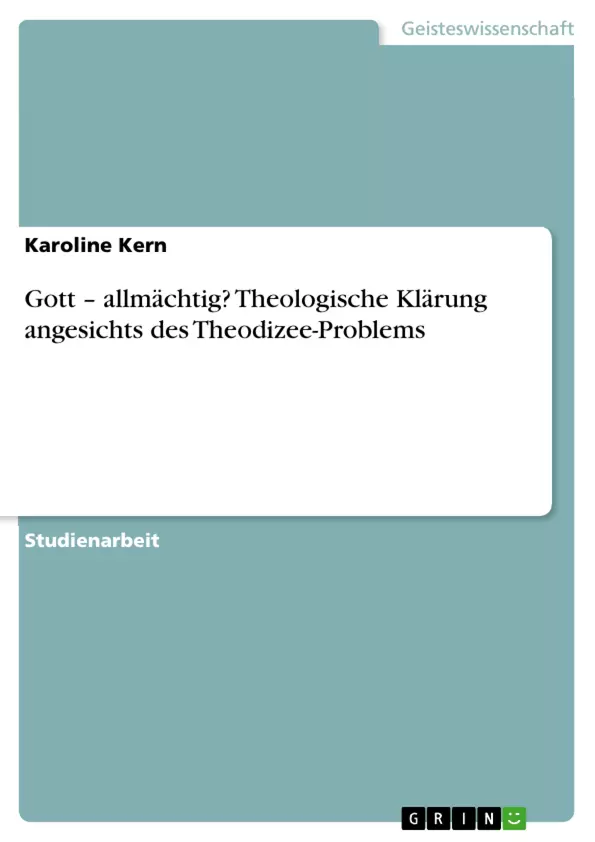„Woran liegt die Schuld? Ist etwa Unser Herr nicht ganz allmächtig? Oder treibt er selbst den Unfug? Ach, das wäre niederträchtig.“ Seit Anbeginn der Schöpfung sind Menschen aus allen Ländern der Erde – wie auch Heinrich Heine in seinem oben auszugsweise dargestellten Gedicht „Zum Lazarus“ – auf der Suche nach der Antwort, warum Gott Leid zulässt. Heinrich Heine sucht die Schuld des Leides nicht in sich oder den Menschen selbst, denen Leid wiederfährt, sondern beginnt, an der Allmacht Gottes zu zweifeln. Er fragt sich, warum Gott die Menschheit leiden lässt, wenn er als allmächtiger Gott allein die Macht hätte, das Böse von seiner Schöpfung abzuwenden. Die nachgestellte These Heines deutet Gottes mutwilliges Versehen der Menschheit mit dem Bösen an, das als Bestrafung bzw. Prüfung angesehen werden kann.
Nachdem im Weiteren zunächst auf die Begriffe „Allmacht Gottes“ und „Theodizee“ eingegangen wird, werden im Anschluss daran verschiedene Thesen aus der Philosophie, Theologie und der Naturwissenschaft zu einer ansatzweisen Klärung der Theodizee-Frage erläutert, um mit dem Aufzeigen der Relevanz der Theodizee-Frage für die heutige Gesellschaft abzuschließen.
Inhaltsverzeichnis
I. Vorwort
II. Hauptteil
1. Begrifflichkeit / Definition Allmacht Gottes bzw. Theodizee
2. Losungsansatze verschiedener Philosophen bzw. Theologen
2.1 Philosophischer Ansatz nach Gottfried Wilhelm Leibniz
2.2 Katholisch - Theologischer Ansatz nach Karl Rahner
2.3 Naturwissenschaftlicher Ansatz - Die Chaostheorie
III .Schlussbemerkung...
IV. Literaturverzeichnis
I. Vorwort
Woran liegt die Schuld? 1st etwa Unser Herr nicht ganz allmachtig? Oder treibt er selbst den Unfug? Ach, das ware niedertrachtig[1] Seit Anbeginn der Schopfung sind Menschen aus allen Landern der Erde - wie auch Heinrich Heine in seinem oben auszugsweise dargestellten Gedicht „Zum Lazarus“ - auf der Suche nach der Antwort, warum Gott Leid zulasst. Heinrich Heine sucht die Schuld des Leides nicht in sich oder den Menschen selbst, denen Leid wiederfahrt, sondern beginnt, an der Allmacht Gottes zu zweifeln. Er fragt sich, warum Gott die Menschheit leiden lasst, wenn er als allmachtiger Gott allein die Macht hatte, das Bose von seiner Schopfung abzuwenden. Die nachgestellte These Heines deutet Gottes mutwilliges Versehen der Menschheit mit dem Bosen an, das als Bestrafung bzw. Prufung angesehen werden kann.
Nachdem im Weiteren zunachst auf die Begriffe „Allmacht Gottes“ und „Theodizee“ eingegangen wird, werden im Anschluss daran verschiedene Thesen aus der Philosophie, Theologie und der Naturwissenschaft zu einer ansatzweisen Klarung der Theodizee-Frage erlautert, um mit dem Aufzeigen der Relevanz der Theodizee-Frage fur die heutige Gesellschaft abzuschlieBen.
II. Hauptteil
1. Begrifflichkeit / Definition Allmacht Gottes bzw. Theodizee
Mit den Worten „nioTsbopsv si^ sva 0sov, naxspa, navxoKpaxopa“ (Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmachtigen) beginnt das auf dem Konzil von Konstantinopel vervollstandigte Glaubensbekenntnis, das wir Christen bis heute verwenden. Die Allmacht Gottes ist demzufolge eine grundlegende Voraussetzung des christlichen Glaubens, die seinen Ursprung in den Erzahlungen des Alten Testament aufweist. Dort wird er zu Beginn des Buches Genesis‘ als Schopfer von „Himmel und Erde“ bezeichnet. Des Weiteren wird Gott als „Starken“ Jakobs (Gen 49,24 ff), „Felsen“ (Dtn 32, 4 + 30) und „Schild“ (Dtn 33,29 ff) dargestellt [2], der durch seine Macht, das Meer zu teilen, das Volk Israel trockenen FuBes durch den Ozean ziehen lasst, die Agypter jedoch unter den Wogen des Meeres begrabt. Aber nicht nur im Christentum, sondern auch im Judentum oder Islam wird unter der Allmacht Gottes dessen Fahigkeit, „jeden moglichen Zustand der Welt herbeizufuhren“[3], verstanden, der nur von „logische[n] Unmoglichkeiten“[4] begrenzt wirdund es ist kein anderer als Gott, der zu Beginn des Buches Genesis‘ als Schopfer von „Himmel und Erde“ genannt wird.[5]
Doch wenn unser Schopfer allmachtig ist, warum lasst er uns leiden? Die Theodizee versucht, die Losung dieser Frage in Erfahrung zu bringen und zielt darauf ab, Gott von seiner Schuld an den Leiderfahrungen der Menschen zu entbinden und gegenuber dem „von ihm zugelassenen Ubel und Bosen in der Welt“[6] zu rechtfertigen.[7] Gepragt wurde der Begriff der Theodizee, dessen Fragestellung bereits seit der Entstehung der monotheistischen Religionen existiert, erst 1697 durch den deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, der diese Begrifflichkeit aus einer Zusammensetzung der griechischen Ausdrucke 9so^ (Gott) und dkp (Gerechtigkeit) neu bildet und somit einem seit Menschengedenken bestehenden Problem einen Namen gibt. Im Jahre 1710 wird sein Werk „Essais de Theodicee, Sur la bonte de Dieu, la liberte de l'homme et l'orgine du mal" (Studien zur Theodizee, uber die Gute Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Ubels) publiziert, das unter anderem zwei Losungsansatze Leibniz‘ enthalt, wobei im Folgenden auf einen der beiden naher eingegangen wird.[8]
2. Losungsansatze verschiedener Philosophen bzw. Theologen
2.1. Philosophischer Losungsansatz nach Gottfried Wilhelm Leibniz
Nach Gottfried Wilhelm Leibniz kann die Theodizee-Frage beantwortet werden, indem man das Leid bzw. Ubel in drei Kategorien einteilt: „Das metaphysische Ubel besteht in der einfachen Unvollkommenheit [Anm.: malum metaphysicum], das physische im Leiden [malum physicum] und das moralische [malum morale] in der Sunde.“[9]
Das metaphysische Ubel beinhaltet den Gedanken, dass Gott allein vollkommen ist.
Leibniz bezeichnet ihn daher als monas monadum, die Monade[10] der Monaden bzw. ursprungliche Einheit, die uber allen anderen existierenden Monaden bzw. Einheiten steht. Er als Ursubstanz allein besitzt in ganzer Vollkommenheit alle Attribute, auf welche die
Gesamtheit der Monaden hinzielt. Gott war es demzufolge unmoglich, seine Geschopfe als vollkommen zu erschaffen, da diese ansonsten Gotter gewesen waren, deren Identitat mit der Jahwes ubereingestimmt hatte. Daher konnte Gott nur relative, begrenzte Kreaturen erzeugen, deren Vollkommenheit zwar geringer ist als seine eigene, die jedoch in der Lage sind, sich fortlaufend weiterzuentwickeln und nach der Vollkommenheit zu streben. Ein Teil des Leides bzw. des Bosen auf Erden resultiert nach Leibniz demzufolge daraus, dass die Welt gewollt unvollkommen ist.
Als Konsequenz des metaphysischen Ubels resultiert das malum physicum bzw. das naturliche Ubel, dessen Theorie bereits Augustinus von Hippo vertreten hatte, ehe es Leibniz durch seine Thesen uber das malum metaphysicum und morale erganzte.
Nimmt man - wie oben erlautert - metaphysisch an, dass Gottes Schopfung zwangslaufig unvollkommen ist, geht damit auch die Unvollkommenheit der Physis bzw. der Natur an sich, aus dessen Folge Krankheit, Schmerz, Leid und Tod, sowie Missbildungen und Naturkatastrophen entstehen, einher.
Durch die „Asthetisierung, Padagogisierung und Instrumentalisierung der Ubel‘[11] kann denselben aber auch eine positive Seite abgewonnen werden[12]. „Etwas Saures, Scharfes oder Bitteres gefallt oft besser als Zucker; der Schatten lasst die Farbe starker hervortreten und selbst eine Dissonanz am rechten Platze hebt die Harmonie“[13] Auf gewisse Art und Weise ist Leid also notwendig, um Gluck erfahren zu konnen. Findet beispielsweise ein armer Mensch einen Funf-Euro-Schein auf der StraBe, empfindet dieser dabei ein anderes bzw. um ein vielfach starkeres Glucksgefuhl als ein Millionar, da beide eine andere Vorgeschichte und somit eine andere Wahrnehmung in Bezug auf Geld besitzen. Daher impliziert das malum physicum nicht nur leidvolle Erfahrungen, sondern auch positive. Meist geht aus dem physischen Ubel das moralische hervor, das Leibniz fur das gravierendste der drei Mala halt. Da jeder Mensch mit einer Moral ausgestattet ist, befahigt ihn dies dazu, das Bose und das Gute wahrzunehmen. Durch die den Menschen von Gott gegebene Willensfreiheit haben diese aber auch die Autonomie inne, Entscheidungen zu fallen oder Taten auszufuhren, die Leid bzw. Ubel hervorrufen. Der Mensch „als handelndes und willensbegabtes Wesen“[14] ist daher im Stande, zu sundigen. Dieses wertvolle Attribut - die Freiheit des Menschen - hatte Leibniz‘ Ansicht nach nur verhindert werden konnen, indem ihm diese Eigenschaft von vorne herein von Gott verwehrt worden ware. Die prinzipielle Eliminierung des moralisch Bosen hatte zugleich das Ende der Freiheit des Menschen bedingt. Gott kommt der Menschheit entgegen und gesteht ihnen die Freiheit zu, welche die Konsequenz des Leides und des Bosen nach sich.
[...]
[1] Kuschel, Der Kampf mit Gott 170.
[2] vgl. Theologisches Taschenlexikon 75f.
[3] Klinge, No Best World Solutions 24.
[4] Rommel, Mensch - Leid - Gott 17.
[5] Vgl. Rommel, Mensch - Leid - Gott 17.
[6] Schilling, Das Problem der Theodizee 11.
[7] Vgl. Schilling, Das Problem der Theodizee 11
[8] Vgl. Schilling, Das Problem der Theodizee 12 f.
[9] Leibniz, Theodizee 106.
[10] lateinisch monas = Einheit, das Einfache; bei Leibniz: letzte, in sich geschlossene, vollendete, nicht mehr auflosbare Ureinheit (Duden!!! Stichwort Monade)
[11] Schilling, Das Problem der Theodizee 46.
[12] Vgl. Schilling, Das Problem der Theodizee 43 ff.
[13] Leibniz, Theodizee 99.
[14] Schilling, Das Problem der Theodizee 44.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Theodizee-Problem?
Die Frage, wie ein allmächtiger, gütiger Gott das Leid und das Böse in der Welt zulassen kann.
Wie löst Gottfried Wilhelm Leibniz die Theodizee-Frage?
Leibniz unterscheidet zwischen metaphysischem, physischem und moralischem Übel und argumentiert, dass wir in der „besten aller möglichen Welten“ leben.
Was bedeutet „Allmacht Gottes“ im christlichen Glauben?
Es ist die grundlegende Annahme, dass Gott die Fähigkeit besitzt, jeden logisch möglichen Zustand der Welt herbeizuführen.
Welchen Ansatz verfolgt Karl Rahner zum Thema Leid?
Der katholische Theologe Karl Rahner betrachtet das Leid als ein Geheimnis, das im Kontext der menschlichen Endlichkeit und Gottes Unbegreiflichkeit steht.
Kann die Chaostheorie zur Klärung beitragen?
Die Arbeit zieht naturwissenschaftliche Ansätze wie die Chaostheorie heran, um komplexe Zusammenhänge von Ursache und Wirkung in der Welt zu erklären.
- Citar trabajo
- Karoline Kern (Autor), 2011, Gott – allmächtig? Theologische Klärung angesichts des Theodizee-Problems, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195975