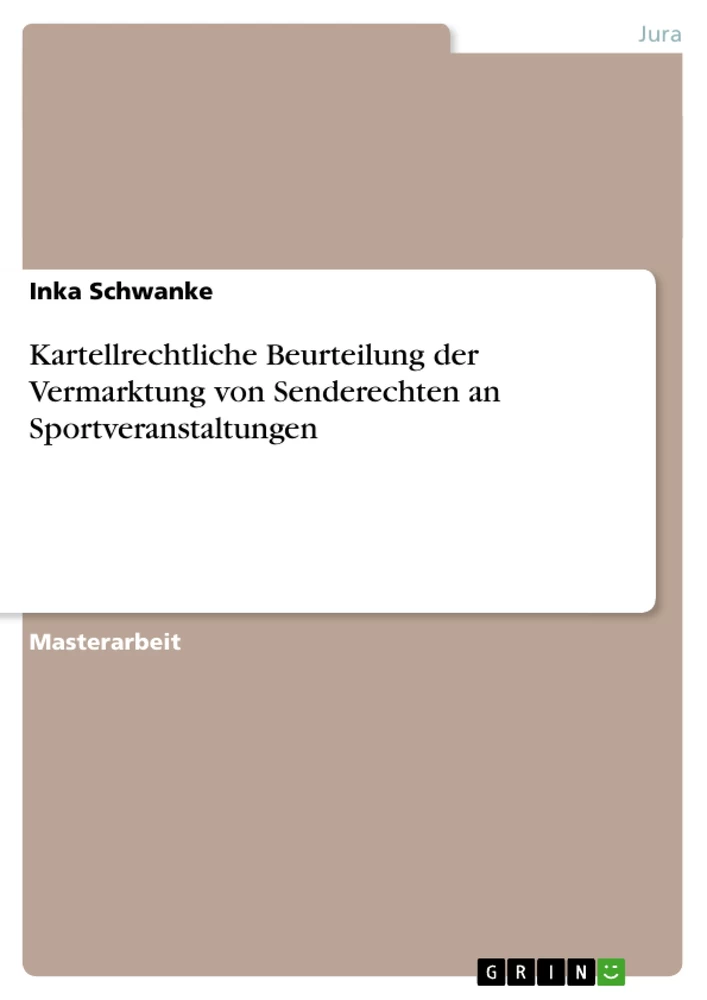Die Frage nach der kartellrechtlichen Beurteilung der sich im Zusammenhang mit der
Vermarktung der Senderechte an Sportveranstaltungen stellenden Probleme hat in den letzten
Jahren, insbesondere seit der Untersagung der vom Deutschen Fußball-Bund (DFB)
vorgenommenen zentralen Vermarktung der Heimspiele deutscher Europapokalteilnehmer
durch den Bundesgerichtshof1, eine wahrhafte Flut juristischer Publikationen hervorgerufen.
Dies mag erstaunen – wurde der Sport doch ursprünglich als rein gesellschaftliches Phänomen
und der gesamte mit ihm verknüpfte Regelungsbereich dementsprechend als rechtsfreier
Raum aufgefaßt.2 Die Anwendung von Vorschriften staatlichen Rechts auf sportbedingte
Sachverhalte stößt insbesondere von Seiten der ihre Regelungszuständigkeit proklamierenden
Sportverbände auf Widerstand.3 Denn diese hatten unter Berufung auf ihre grundrechtlich
garantierte Satzungsautonomie lange Zeit nahezu frei schalten und walten können.4 Immer
wieder begegnet man dem Hinweis auf die gesellschaftliche und soziale Funktion des Sports,
deren Berücksichtigung auch im Geltungsbereich des Wirtschaftsrechts eingefordert wird.5 [...]
1 BGH, Beschl. v. 11.12.1997, BGHZ 137, 297-314.
2 Vieweg, Normsetzung, 1990, S. 51 ff., 128; Heermann, RabelsZ 2003, 106, 108.
3 Vgl. insoweit beispielhaft das Vorbringen der Beteiligten im Bosman-Verfahren vor dem Europäischen
Gerichtshof, EuGH, Urt. v. 15.12.1995, Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-5040, 5062 Tz. 69 ff. Zu den ablehnenden
Reaktionen auf die Bosman-Entscheidung des EuGH vgl. auch Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen,
2001, S. 37.
4 Waldhauser, Fernsehrechte, 1999, S. 32. Zur Bedeutung der Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 Abs. 1 GG bzw.
Art. 11 Abs. 1 EMRK für die Satzungsautonomie der Sportverbände vgl. eingehend Krogmann, Grundrechte,
1998, S. 58 ff. bzw. 195 f. Zur grundlegenden Rolle des Sportsverbandswesens vgl. auch Hannamann/Vieweg,
in: Württembergischer Fußballverband e.V. (Hrsg.), Sport, Kommerz und Wettbewerb, 1998, S. 49, 51 ff. sowie
Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen, 2001, S. 53 ff.
5 Mit der Einführung einer Bereichsausnahme für den Sport in § 31 durch die 6. GWB-Novelle hat der
Gesetzgeber dieser Forderung nachgegeben. Ausführlich zur Bereichsausnahme des § 31 GWB sowie der hieran
geäußerten Kritik vgl. unten unter B VI 1 a.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- I. Die gesellschaftliche Dimension des Sports
- II. Sport als Wirtschaftsfaktor
- III. Die Anwendung des Wirtschaftsrechts auf den Sport
- IV. Gang der Untersuchung
- B. Zentrale Vermarktung von Senderechten
- I. Rangverhältnis von europäischem und deutschem Kartellrecht
- II. Anwendbarkeit des Kartellrechts auf Sportvereine und -verbände
- 1. Unternehmensbegriff
- 2. Sportvereine und -verbände als Unternehmen bzw. Unternehmensvereinigungen
- III. Beschluß einer Unternehmensvereinigung
- IV. Wettbewerbsbeschränkung
- 1. Anwendungsausschluß des Kartellrechts mangels Wettbewerbsverhältnisses
- a) Single-Entity-Theorie
- b) Konzerninterne Absprachen
- c) Ergebnis zu 1.
- 2. Rechtsnatur der Senderechte
- a) Rechtsnatur der Fernsehrechte
- aa) Rechte der Sportler
- (1) Bildnisschutz des Sportlers
- (a) Öffentliche Zurschaustellung
- (b) Grenzen des Rechts am eigenen Bild
- (c) Entgegenstehende Interessen des Abgebildeten
- (2) Schutz der sportlichen Leistung
- (a) Urheberrechtlicher Leistungsschutz
- (bb) Der Schutz der sportlichen Darbietung
- (aa) Allgemeine urheberrechtliche Schutzvoraussetzungen
- (cc) Zwischenergebnis
- (b) Analoge Anwendung der §§ 73 ff. UrhG
- (c) Leistungsschutz als Ausfluß des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
- (d) Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz
- (aa) Anwendbarkeit des § 1 UWG
- (bb) Handeln im geschäftlichen Verkehr
- (cc) Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs
- (e) §826 BGB
- (3) Ergebnis zu aa)
- bb) Rechte des Sportveranstalters
- (1) Urheberrechtlicher Veranstalterschutz nach § 81 UrhG
- (2) Wettbewerbsrecht
- (a) Anwendbarkeit des § 1UWG
- (b) Handeln im geschäftlichen Verkehr
- (c) Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs
- I(d) Sittenwidrigkeit der Leistungsübernahme
- (3) Recht am Unternehmen
- (4) §826 BGB
- (5) Hausrecht
- (a) Begriff und Rechtsnatur
- (b) Reichweite des eigentums- bzw. besitzrechtlichen Schutzes
- (6) Ergebnis zu a)
- b) Besonderheiten des Hörfunkrechts
- aa) Wettbewerbsrecht
- (1) Wettbewerbsverhältnis
- (2) Sittenwidrigkeit der Wettbewerbshandlung
- bb) Recht am Unternehmen
- cc) Hausrecht
- c) Ergebnis zu 2.
- 3. Veranstalterbegriff
- a) Der Veranstalterbegriff der Rechtsprechung
- aa) Ausgangspunkt der Rechtsprechung
- bb) Weitere Entwicklung in der Rechtsprechung
- cc) Bewertung der jüngsten Rechtsprechung zum Veranstalterbegriff
- b) Der Veranstalterbegriff in der Literatur
- aa) Urheberrechtlicher Veranstalterbegriff
- bb) Veranstalter als Berechtigter aus den gesetzlichen Abwehrrechten
- cc) Wertschöpfung
- c) Stellungnahme und Ergebnis zu 3.
- d) Annex: Rechtliche Konsequenzen der Mitberechtigung an den Senderechten
- aa) Gesellschaft bürgerlichen Rechts gemäß §§ 705 ff. BGB
- bb) Bruchteilsgemeinschaft analog §§ 741 ff. BGB
- 4. Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung
- a) Relevanter Markt
- aa) Relevanter Produktmarkt
- bb) Räumlich relevanter Markt
- cc) Zeitlich relevanter Markt
- b) Spürbare Auswirkungen auf den relevanten Markt
- V. Zweck oder Wirkung
- VI. Ausnahmen vom Kartellverbot
- 1. Deutsches Recht
- a) § 31 GWB
- b) Arbeitsgemeinschaftsgedanke
- c) Immanenztheorie
- d) Rechtsgüterabwägung
- 2. EG-Recht
- a) Rule of Reason
- b) Markterschließungsdoktrin und Immanenz
- VII. Freistellung vom Kartellverbot
- 1. EG-Recht
- a) Warenerzeugung / -verteilung bzw. technischer / wirtschaftlicher Fortschritt
- b) Angemessene Beteiligung der Verbraucher
- c) Unerläßlichkeit der Wettbewerbsbeschränkung
- d) Ausschaltung wesentlichen Wettbewerbs
- f) Ergebnis zu 1.
- II2. Deutsches Recht
- a) Rationalisierungskartelle, § 5 Abs. 1 und 2 GWB
- b) Freistellung nach § 7 Abs. 1 GWB
- c) Ministererlaubnis, § 8 GWB
- d) Ergebnis zu 2.
- VIII. Annex: Mißbrauch von Marktmacht
- 1. Marktbeherrschung
- 2. Preismißbrauch
- 3. Ergebnis zu VIII.
- IX. Ergebnis zu B.
- C. Exklusivvereinbarungen
- I. Typen und Umfang von Exklusivvereinbarungen
- II. Zulässigkeit von Exklusivvereinbarungen
- 1. Deutsches Recht
- a) § 16 Nr. 2 GWB
- aa) Vereinbarungen zwischen Unternehmen über gewerbliche Leistungen
- bb) Abgabebeschränkung
- cc) Wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs
- (1) Relevanter Markt
- (2) Wettbewerbsbeschränkung
- dd) Ergebnis zu a)
- b) § 20 Abs. 1 und 2 GWB
- 2. EG-Recht
- a) Art. 81 Abs. 1 EG
- b) Art. 82 EG
- III. Ergebnis zu C.
- D. Gemeinsamer Einkauf von Senderechten
- I. Allgemeines
- II. Der EBU/Eurovisions-Fall
- 1. Sachverhalt
- 2. Kartellrechtliche Würdigung
- a) Art. 81 Abs. 1 EG
- aa) Beschluß einer Unternehmensvereinigung
- bb) Wettbewerbsbeschränkung oder -verfälschung
- cc) Zwischenstaatlichkeitsklausel
- dd) Spürbarkeit
- b) Art. 81 Abs. 3 EG
- aa) Warenerzeugung / -verteilung bzw. technischer / wirtschaftlicher Fortschritt
- bb) Angemessene Beteiligung der Verbraucher
- cc) Unerläßlichkeit der Wettbewerbsbeschränkung
- dd) Ausschaltung wesentlichen Wettbewerbs
- ee) Zugang von Nichtmitgliedern
- III. Ergebnis zu D
- E. Gesamtergebnis
- Die Anwendung des Kartellrechts auf Sportvereine und -verbände
- Die Rechtsnatur von Senderechten und deren kartellrechtliche Relevanz
- Die Zulässigkeit von Wettbewerbsbeschränkungen im Sport
- Die Ausnahmen und Freistellungen vom Kartellverbot
- Der Missbrauch von Marktmacht im Zusammenhang mit der Vermarktung von Senderechten
- Kapitel A: Die Arbeit führt in die Thematik ein und erläutert die gesellschaftliche Dimension des Sports sowie seine Bedeutung als Wirtschaftsfaktor. Zudem werden die Anwendung des Wirtschaftsrechts auf den Sport und der Gang der Untersuchung dargestellt.
- Kapitel B: Dieses Kapitel behandelt die zentrale Vermarktung von Senderechten. Dabei werden die Anwendbarkeit des Kartellrechts auf Sportvereine und -verbände, der Begriff der Wettbewerbsbeschränkung und die Ausnahmen vom Kartellverbot untersucht.
- Kapitel C: Exklusivvereinbarungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Senderechten stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels. Die Zulässigkeit von Exklusivvereinbarungen nach deutschem und europäischem Kartellrecht wird analysiert.
- Kapitel D: Das Kapitel befasst sich mit dem gemeinsamen Einkauf von Senderechten und analysiert den EBU/Eurovisions-Fall anhand der kartellrechtlichen Vorgaben.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kartellrechtliche Beurteilung der Vermarktung von Senderechten an Sportveranstaltungen. Dabei werden insbesondere die zentralen Vermarktung von Senderechten, exklusive Vereinbarungen und der gemeinsame Einkauf von Senderechten analysiert.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Kartellrecht, Sport, Senderechte, Wettbewerbsbeschränkung, Ausnahmen, Freistellungen, Missbrauch von Marktmacht, Exklusivvereinbarungen, Gemeinsamer Einkauf, EBU/Eurovisions-Fall, Unternehmensbegriff, Veranstalterbegriff, Rechtsnatur, Sportvereine, Sportverbände, Europäisches Recht, Deutsches Recht.
Häufig gestellte Fragen
Darf der DFB die Fernsehrechte seiner Vereine zentral vermarkten?
Die zentrale Vermarktung steht oft im Konflikt mit dem Kartellrecht, da sie den Wettbewerb zwischen den Vereinen einschränken kann.
Wer ist rechtlich Inhaber der Senderechte an einem Sportevent?
Rechtlich wird zwischen den Rechten der Sportler (Bildnisschutz) und des Veranstalters (Hausrecht, unternehmerische Leistung) unterschieden.
Gibt es Ausnahmen vom Kartellverbot für den Sport?
In Deutschland gibt es Bereichsausnahmen (§ 31 GWB), zudem werden im EU-Recht oft die soziale Funktion und die Solidarität im Sport berücksichtigt.
Was sind Exklusivvereinbarungen bei Sportrechten?
Es handelt sich um Verträge, die einem Sender das alleinige Recht zur Übertragung für einen bestimmten Zeitraum oder Markt einräumen.
Sind Sportvereine im Sinne des Kartellrechts "Unternehmen"?
Ja, sobald sie wirtschaftlich tätig sind (z.B. Ticketverkauf, Merchandising), unterliegen sie den kartellrechtlichen Bestimmungen.
- Citation du texte
- Inka Schwanke (Auteur), 2003, Kartellrechtliche Beurteilung der Vermarktung von Senderechten an Sportveranstaltungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19604