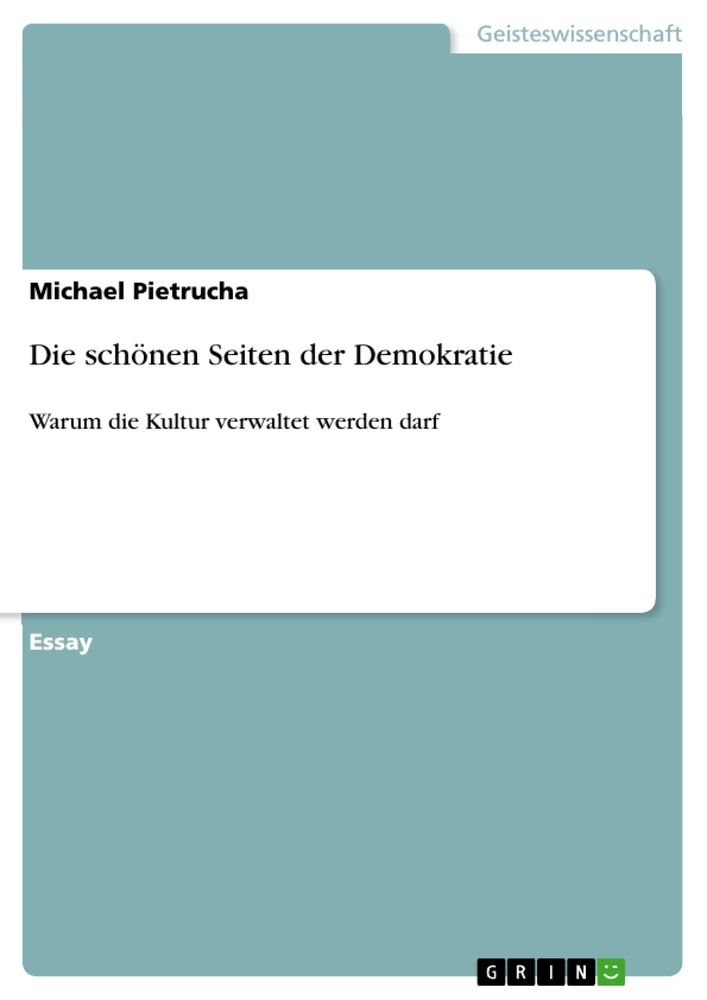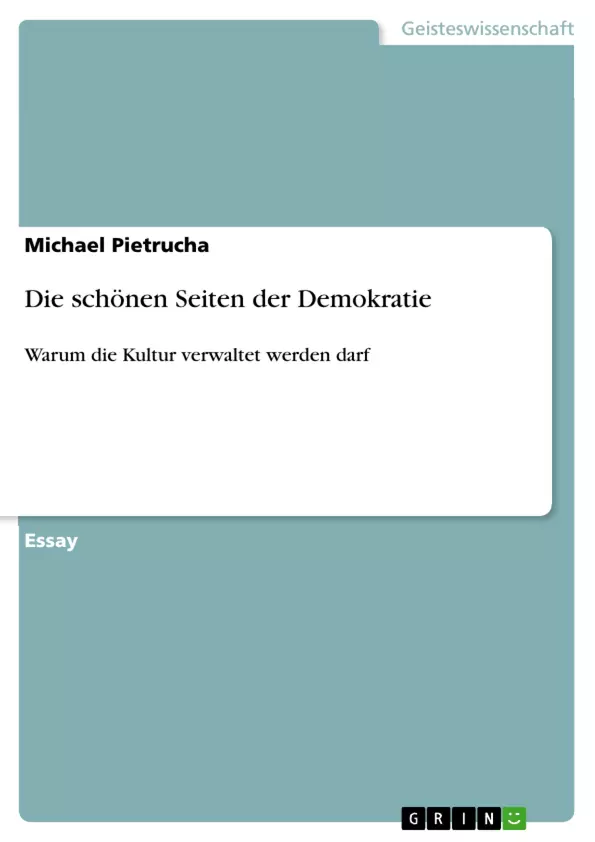In allen Zeiten der menschlichen Entwicklung waren Kunst und höhere Kultur Privilegien. Nur sehr wenige beherrschten sie, um sie nur wenigen mehr anbieten zu können. Die Generationen tradierten dabei jene gemalten, geschriebenen oder aufgeführten Kulturgüter weiter, von deren außergewöhnlicher Qualität sie überzeugt waren.
Davon zumindest gehen wir heutzutage aus.
Die schönen Seiten der Demokratie -
Warum die „Kultur“ verwaltet werden darf
In allen Zeiten der menschlichen Entwicklung waren Kunst und höhere Kultur Privilegien. Nur sehr wenige beherrschten sie, um sie nur wenigen mehr anbieten zu können. Die Generationen tradierten dabei jene gemalten, geschriebenen oder aufgeführten Kulturgüter weiter, von deren außergewöhnlicher Qualität sie überzeugt waren.
Davon zumindest gehen wir heutzutage aus.
Was aber, wenn auch in früheren Zeiten weniger die Botschaft, als vielmehr Zufall und Inszenierung ausschlaggebender waren für den Erfolg eines Werkes? Immerhin darf nicht aus den Augen verloren werden, dass auch ein William Shakespeare für sich und seine Familie einen Lebensunterhalt bestreiten musste und dementsprechend für seine Königin um des Profits Willen einige der bedeutendsten Dramen der europäischen Zivilisation produzierte. Damit war die kreative Tätigkeit jenes großen Engländers in gewisser Weise einer Verwaltung von Seiten des Staates, der Herrschaft um genauer zu sein, unterworfen.
Eines der buntesten Gesellschaftsbilder der Literaturgeschichte, die „Comédie humaine“, entstand, weil ihr Autor, Honoré (de) Balzac, bekanntlich ständig in Geldnot war. Dabei produzierte er regelrecht ein Buch nach dem anderen, wobei nicht jedes, darin ist man sich weitgehend einig, dieselbe stilistische und inhaltliche Qualität besaß. Beispiele wie diese lassen sich praktisch für jedes künstlerische Genre, jedes Jahrhundert und jede Nation finden. Dazu gehören die Grabbeigaben der Pharaonen genauso, wie die prachtvollen Statuen der alten Griechen, bis hin zu tschechischen Komponisten des 19. Jahrhunderts, die eine Nationalmusik schaffen wollten, oder auch polnischen und ukrainischen Schriftstellern, die, um finanziell über die Runden zu kommen, Massen an Büchern sowie Zeitungsartikeln verfassen mussten.
Es gibt auch in diesem Metier weder Schwarze Schafe, noch Weiße Westen. Es zeigt uns vielmehr die menschlichen Seiten der Kunst und höheren Kultur:
Fehlbarkeit, Spontaneität, Kurzsichtigkeit, ein Hang zum Experimentieren und nicht zuletzt einen Urheber, der vielleicht noch übermorgen sein Brot essen und im eigenen Bett schlafen möchte.
Wie bereits gesagt, erreichten Kunst und Kultur in früheren Jahrhunderten, in denen sie auch schon einer gewissen Kontrolle von oben unterlagen und trotzdem fruchtbar waren, ein allzu kleines Publikum, oder sie konnten vielmehr kein besonders großes Publikum erreichen, da beispielsweise entsprechende Infrastrukturen und Kapazitäten nicht bereit standen.
Darin liegt der wichtigste Unterschied zu heutigen Gegebenheiten. Denn höhere Kultur und Kunst war streng genommen schon immer eine verwaltete Ware, die man sich hat leisten müssen.
Anders verhält es sich bis heute mit der einfachen Kultur einer Gesellschaft, also die Art und Weise wie man miteinander und mit seinen Gütern umgeht, die zwar durch die Ware „höhere Kultur“ beeinflusst werden kann; diese Beeinflussung und Veränderung muss sich jedoch unbewusster vollziehen. Gewaltsame, von oben diktierte, kulturelle Umwälzungen, wie sie nicht selten in diktatorischen und ideologisch geprägten Regimen vorkommen, haben - das zeigen uns Beispiele des 20. Jahrhunderts - in den wenigsten Fällen das Regime überleben können.
In einem natürlichen Entwicklungsprozess der Gesellschaft, also ohne gewaltsame und aufoktroyierte Zwischenspiele, müssen sich Kunst und Kultur innerhalb der Gesellschaft und ihrer Gesetzmäßigkeiten in dieselbe Richtung entwickeln wie es ihre Träger tun.
Die seit dem 17. und 18. Jahrhundert sich immer stärker ausprägende Staatlichkeit und Durchstrukturierung der europäischen Nationen diente zwar Zwecken der effizienteren Beherrschung und Kontrolle der Bevölkerung und erfasste selbstverständlich auch das Kulturschaffen, zivilisierte und ordnete ihre Lebensweise hingegen nebenbei. Man sollte allerdings, trotz dieser augenscheinlichen Bevormundung und des Abhängigmachens der Kultur von Verwaltungsorganen, nicht außer Acht lassen, dass es sich zumindest in westlichen Staaten nicht mehr um einige wenige „Herrscher“ oder „Verwalter“ handelt, sondern um hoch entwickelte demokratische Republiken, weshalb der Staat - wie auch alles, was er verwaltet - der Kontrolle des mündigen Bürgers unterworfen ist. Dementsprechend muss man zugeben, dass Kunst und Kultur verwaltet werden.
Diese Verwaltung befindet sich momentan noch in einer ausgewogenen Balance zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, weswegen auch ihre Qualität und Quantität sämtliche Stufen abdeckt und somit auch jede Bevölkerungsschicht Zugang zu allen Kulturgütern hat.
Freilich ist das, was weniger Interesse weckt, wie beispielsweise Opern oder Luxus-und Kunstmobiliar auch weniger erschwinglich. Denn der Wunsch, sich kreativ
auszudrücken, ist zwar zutiefst menschlich, Kunst und Kultur gehören aber nicht in
allen Fällen zu den lebensnotwendigen Bedürfnissen des Menschen. Die kulturelle Ablenkung, die er braucht, sucht sich der Mensch individuell nach Interesse und Intellekt. Jene ausbalancierte Dreiteilung der Kulturverwaltung ist notwendig, um auch weiterhin alle Formen des Kulturschaffens der gesamten Bevölkerung zugänglich zu machen. Zöge sich die Politik beispielsweise zurück, könnte die Kultur dem bloßen Primat der Wirtschaftlichkeit ähnlich zum Opfer fallen, wie es das so genannte Gesundheitswesen bereits zu sehr getan hat. Die Folge wäre inhaltliche Verarmung, trotz eines wahrscheinlichen Überangebots. Zöge sich die Wirtschaft wiederum zurück, könnte früher oder später das diktatorische Element von der Kultur Besitz ergreifen, wodurch ihr ein lebensfernes Dasein drohte.
Langfristig fällt die Gesellschaft, als Zünglein an der Waage und treibende Kraft hinter allem, solche Entscheidungen in Wechselwirkungen mit ihrer Entwicklung, nicht etwa Einzelne.
Daher ist die Verwaltung von Kultur in einer Demokratie durch eine Wechselwirkung jener drei geschilderten Pole etwas ganz Natürliches und vor allem Gesundes. Einzelne Intellektuelle können zeitnah entscheiden, ob und inwiefern solche Tendenzen gut oder schlecht sind. Sie können auch darüber Debatten führen, ob das, was die Kultur dabei hervorbringt, hohe oder niedrige Qualität hat. Es ändert jedoch nichts an der Natürlichkeit dieser Entwicklung und hat nur begrenzten Einfluss auf die Frage, was von dem Geschaffenen überdauern können wird.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum darf Kultur in einer Demokratie verwaltet werden?
Die Verwaltung ist notwendig, um eine Balance zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu halten. Dies stellt sicher, dass Kulturgüter für alle Bevölkerungsschichten zugänglich bleiben und nicht nur rein wirtschaftlichen Interessen unterliegen.
War Kunst früher wirklich "frei" von Verwaltung?
Nein, auch bedeutende Künstler wie Shakespeare oder Balzac produzierten ihre Werke oft unter finanziellem Druck oder im Auftrag von Herrschern, was einer Form von staatlicher oder wirtschaftlicher Verwaltung entsprach.
Was ist der Unterschied zwischen "höherer Kultur" und "einfacher Kultur"?
Höhere Kultur (wie Opern oder Kunstobjekte) ist oft eine verwaltete Ware. Einfache Kultur beschreibt die Art und Weise des täglichen Umgangs in einer Gesellschaft, die sich natürlicher und unbewusster entwickelt.
Welche Gefahr besteht, wenn sich die Politik aus der Kulturverwaltung zurückzieht?
Es bestünde die Gefahr, dass Kultur ausschließlich dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit geopfert wird, was zu einer inhaltlichen Verarmung trotz eines möglichen Überangebots führen könnte.
Welche Rolle spielt der Bürger in der Kulturverwaltung einer Demokratie?
Da der Staat in einer Demokratie der Kontrolle des mündigen Bürgers unterliegt, ist auch die Verwaltung der Kultur letztlich durch die Gesellschaft legitimiert und beeinflussbar.
- Quote paper
- Michael Pietrucha (Author), 2010, Die schönen Seiten der Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196068