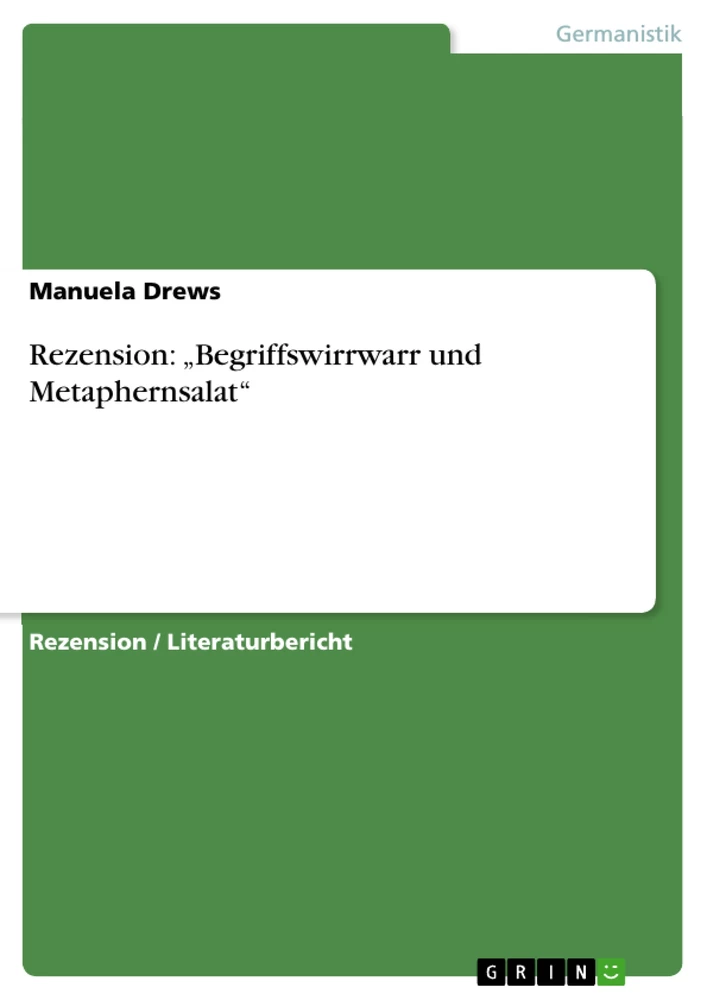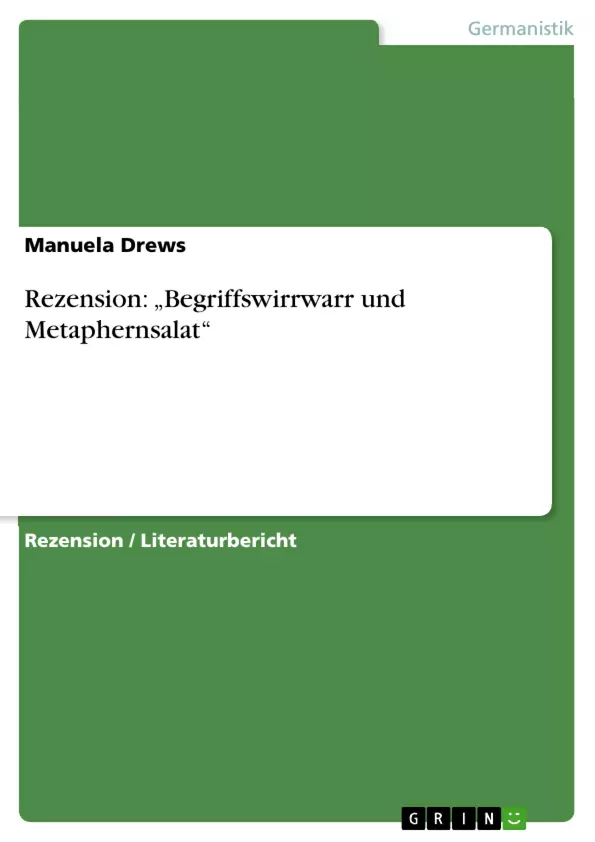Die Rezension beschäftigt sich mit einem Ausschnitt aus der „Einführung in die Medienwissenschaft“ von Werner Faulstich und setzt sich kritisch mit seinen Ansichten und Aussagen auseinander.
Faulstich, Werner (2002): Begriffswirrwarr und Metaphernsalat. In: Einführung in die Me-dienwissenschaft Fink. München
Rezension: „Begriffswirrwarr und Metaphernsalat“
Faulstich, Werner (2002): Begriffswirrwarr und Metaphernsalat. In: Einführung in die Medienwissenschaft. Fink Verlag. München. S. 19-26
Um Medienkompetenz überhaupt verstehen und definieren zu können stellen sich zunächst zwei grundlegende Fragen: Was ist ein Medium? Und möglicherweise noch wichtiger: Was genau bedeutet Medienwissenschaft? Dieser Problematik stellt sich auch Werner Faulstich und beginnt gleich zu Beginn des Aufsatzes zu erläutern, warum diese Frage seit Jahren nicht eindeutig geklärt und beantwortet werden konnte. Seiner Ansicht nach sind die Schuldigen schnell gefunden. An Literatur rund um das Thema „Einführung in Medientheorien“ mangele es nämlich keineswegs, so Faulstich. Stattdessen würde sich einfach nicht die Mühe gemacht werden den Begriff konkret zu erläutern. Sogenannte Einführungen sammeln aktuelle Medientheorien und erzählen sie arbiträr gebündelt und selektiv nach (vgl. S. 19) ohne eigene Definitionen zu entwickeln. Daher herrsche, so kritisiert Faulstich, auch heute „nach wie vor eine große Verwirrung um den Medienbegriff“ (S.19). Um den Begriff Medium zu spezifizieren, wird er oftmals in partielle Kategorien gebündelt, beispielsweise in einen „biologischen“, „soziologischen“ oder „kulturellen“ Medienbegriff (vgl. S.19). Diese Einteilung ist für Faulstich nicht nur unverständlich, sondern sogar „unlogisch, unverständlich, dysfunktional, unvollständig, unbegründet oder banal“ (S. 20). Das ist allerdings auch seine einzige, an dieser Stelle unzureichende Äußerung, zu den gemachten Kategorisierungen. Warum sie nun „dysfunktional“ und „banal“ sind, überlässt Faulstich der Fantasie des Lesers. Hier hätte ein Beleg oder eine kurze Abhandlung womöglich für ein wenig mehr Klarheit sowie für ein weiterführendes Verständnis gesorgt.
Gibt es nun einen Hauptverantwortlichen für das bereits erwähnte „Begriffswirrwarr“? Ja, so sieht es jedenfalls Faulstich. Auslöser der ganzen Verwirrung sei der auch „als Vater der modernen Medientheorie“ (S. 21) bezeichnete Marshall McLuhan. Dieser veröffentlichte im Jahr 1964 „Understanding Media“ und prägte einen sehr weiten Medienbegriff, in Faulstichs Augen ein unwissenschaftliches Vorgehen. Er wirft McLuhan vor „getrickst“ zu haben und betrachtet ihn auch gar nicht als ernst zunehmenden Wissenschaftler (S. 22). Anders als bei den vorherigen Kritikpunkten konkretisiert Faulstich an dieser Stelle seine Argumentation. Die Medientheorie benötige eine „präzise, kritisch-rationale und möglichst eindeutige Sprache“, McLuhan hingegen konstruiere ein „Konglomerat aus ungeordneten Meinungen, Thesen, Ausdrücken und Behauptungen“ (vgl. S. 22). Um seine Aussagen an dieser Stelle eindeutig zu verifizieren, hätte Faulstich allerdings entsprechende Textstellen oder Zitate anführen können. So bleibt seine Begründung oberflächlich und auch nicht unbedingt wissenschaftlich belegt- einer seiner Hauptkritikpunkte an McLuhan.
Nachdem Faulstich zunächst sämtliche bisherige Definitionsversuche kritisiert hat, beginnt er nun selbst mit der eigentlichen Annäherung an den Medienbegriff. So bedient sich auch Faulstich Kategorisierungen. Er teilt Medien in vier Oberbegriffe ein:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Faulstich 2002, S. 25)
Interessanterweise orientiert sich diese Einteilung an bereits erstellten Modellen von Harry Pross aus dem Jahr 1969 und Manfred Faßler aus dem Jahr 1997. Faulstich übernimmt die Kategorisierungen an dieser Stelle ohne beide Autoren zu erwähnen. Er bezeichnet diesen Vorschlag schlicht als „historisch fundiert“ (S. 24). Unter Berücksichtigung seiner vorherigen Kritik an anderen medientheoretischen Einführungen stellt sich an dieser Stelle dann schon die Frage: Warum ist dieses Modell also doch geeignet?
Fraglich sind außerdem die einzelnen Kategorien selbst. Warum ist nur das Theater ein Primärmedium? Lesungen, Predigten und Co. fallen laut Faulstich anscheinend nicht in diese Kategorie.
Der Aufsatz endet mit einer Definition des Begriffs „Medium“ von Faulstich:
„Ein Medium ist ein institutionalisiertes System um einen organisierten Kommunikationskanal von spezifischem Leistungsvermögen mit gesellschaftlicher Dominanz“ (S.26).
Faulstich gibt insgesamt einen groben Überblick über den Forschungsstand und die Problematik des Begriffs „Medienwissenschaft“, der sich für ihn aus den Teilen „Medien“ und „Wissenschaft“ zusammensetzt. Vor allem Ersterer, das wird im Aufsatz mehr als deutlich, wurde nach Faulstichs Ansicht bisher nicht ausreichend definiert. Faulstich bedient sich einer klaren und gut verständlichen Schriftsprache. Seine Argumentation folgt einem nachvollziehbaren, logischen Aufbau. So kritisiert er die Medien-Einführungen anderer Autoren und schlägt anschließend ein „eigenes“ Modell als mögliche Lösung vor. Den runden Abschluss des Textes bildet dann seine eigene Definition.
Falls Werner Faulstich mit seinem Aufsatz provozieren wollte, gelingt ihm dieses sehr gut. Vor allem der „Medientheoretiker“ schlechthin, Marshall McLuhan, steht im Fokus seiner Kritik und wird als Auslöser der herrschenden Verwirrung angeprangert. Damit zieht Faulstich in jedem Fall die Aufmerksamkeit auf die aktuellen Diskussionen rund um den Medienbegriff. Schade ist allerdings das Beispiele, die McLuhans „Unfähigkeit“ und mangelnden wissenschaftlichen Ansatz belegen könnten, vollständig fehlen. Unwissenschaftliches Arbeiten, das Faulstich anderen Autoren vorwirft, praktiziert er an dieser Stelle selbst und verliert daher einen Teil seiner Glaubwürdigkeit. Auch das anstandslose Übernehmen bereits entwickelter Modelle kollidiert mit den vorherigen durchweg kritischen Äußerungen des Autors. Obwohl es sich bei Werner Faulstich um einen renommierten Vertreter der Medienwissenschaft handelt, wirft dieser Text doch mehr Fragen auf als er konkret beantwortet. Als für sich alleinstehende Erläuterung des Medienbegriffs ist er daher nicht geeignet und nicht unbedingt weiterempfehlenswert. Kritisch zu sehen ist vor allem die abschließende Definition Faulstichs. Wirft er anderen Autoren nicht vor unpräzise und sprachlich schwammig zu sein? Ist seine Definition dagegen klar, scharf und leicht verständlich? Diese Frage muss jeder Leser für sich beantworten.
Diskussionspotenzial bietet mindestens der Begriff „gesellschaftliche Dominanz“, der nicht auf ein Einzelmedium, sondern nur auf einen Medientyp anwendbar ist.
Auch aktuell werden die Begriffe „Medien“, „Medienkompetenz“ und „Medienwissenschaft“ weiter diskutiert. Eine eindeutige Definition ist bisher nicht gelungen. Einen verständlichen Definitionsvorschlag von „Medienkompetenz“ kreierte Dieter Baacke bereits im Jahr 1999. Medienkompetenz kann “als die Fähigkeit, Medien und die dadurch vermittelten Inhalt den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend effektiv nutzen zu können“ (Baacke 1999, S.11) definiert werden.
2010 beschrieb Björn Maurer Medienkompetenz wie folgt:
„Aus medienpädagogischer Perspektive werden mit Medienkompetenz häufig Wissen bzw. Fähigkeiten und Fertigkeiten bezeichnet, die ein Individuum in unserer Medien- und Informationsgesellschaft zum mündigen und emanzipierten Leben benötigt.“ (Maurer 2010, S. 70)
Diese Interpretationen sind soweit klar sowie auf den Punkt formuliert und müssten damit genau den von Faulstich gewünschten Kriterien entsprechen. Interessant wäre vor allem seine Meinung zu Maurers Deutung, die acht Jahre nach Veröffentlichung seines Aufsatzes entstanden ist.
Höchstwahrscheinlich würde er sie wohl als „unlogisch, unverständlich, dysfunktional, unvollständig, unbegründet oder banal“ bezeichnen …
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Rezension zu Werner Faulstichs Aufsatz?
Die Rezension setzt sich kritisch mit Faulstichs Text „Begriffswirrwarr und Metaphernsalat“ auseinander, in dem er die mangelnde Definition des Medienbegriffs in der Wissenschaft beklagt.
Warum kritisiert Faulstich Marshall McLuhan?
Faulstich wirft McLuhan vor, durch einen zu weiten und unwissenschaftlichen Medienbegriff zur allgemeinen Verwirrung in der Medienwissenschaft beigetragen zu haben.
Wie definiert Werner Faulstich ein „Medium“?
Er definiert es als „institutionalisiertes System um einen organisierten Kommunikationskanal von spezifischem Leistungsvermögen mit gesellschaftlicher Dominanz“.
Welche Schwächen sieht die Rezension in Faulstichs eigener Argumentation?
Die Rezension kritisiert, dass Faulstich selbst Modelle ohne Quellenangabe übernimmt und seine Kritik an anderen oft nicht ausreichend wissenschaftlich belegt.
Welche alternativen Definitionen von Medienkompetenz werden genannt?
Es werden Definitionen von Dieter Baacke (Fähigkeit zur effektiven Nutzung nach eigenen Zielen) und Björn Maurer (Fähigkeiten für ein mündiges Leben in der Mediengesellschaft) angeführt.
- Arbeit zitieren
- Manuela Drews (Autor:in), 2012, Rezension: „Begriffswirrwarr und Metaphernsalat“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196074