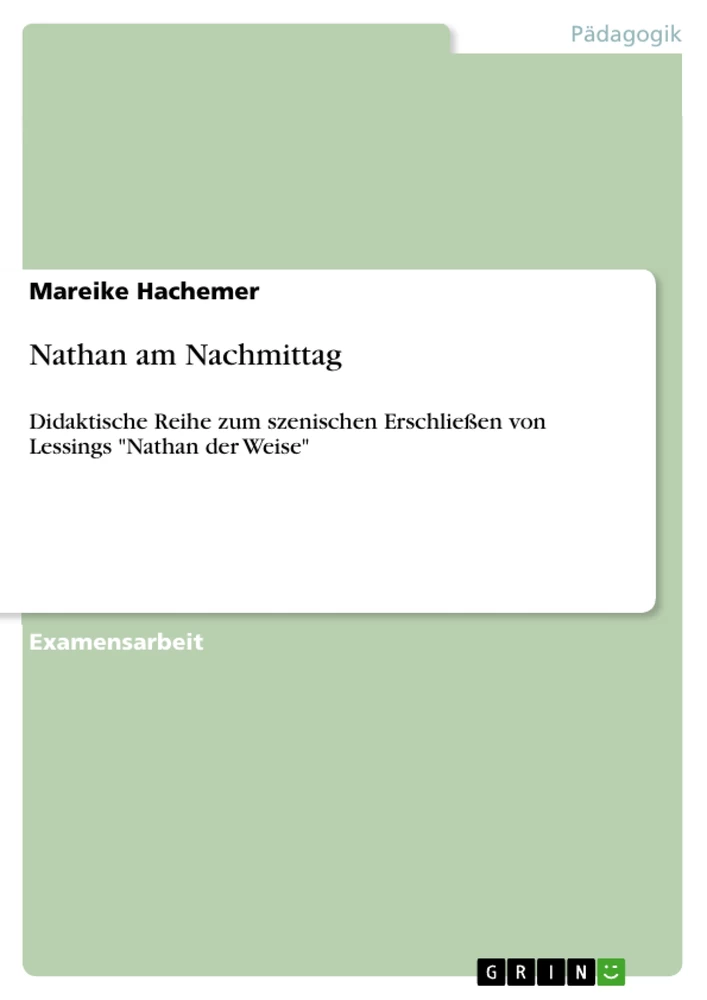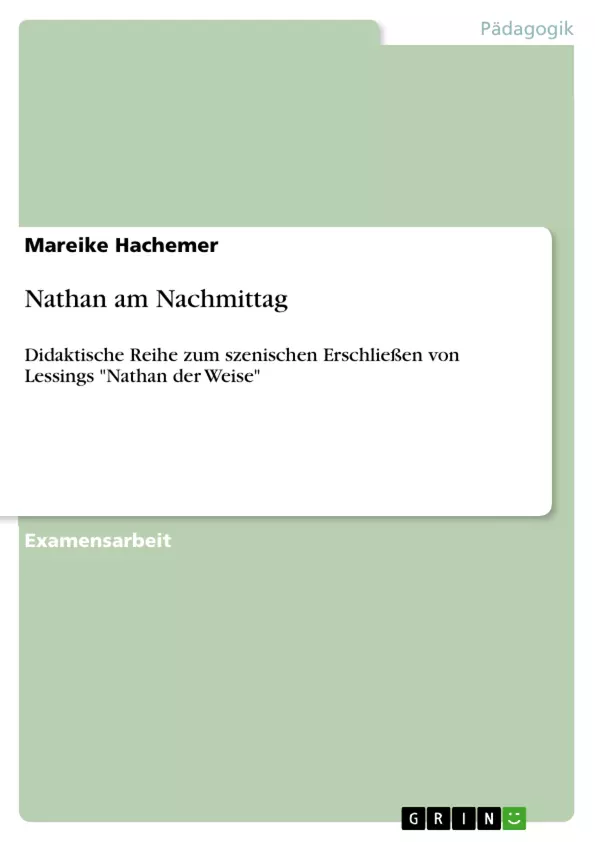„Wozu Literatur lesen?“ „Wozu über Literatur schreiben?“
„Das hat nichts mit mir zu tun!“
Diese Fragen und Sätze höre ich von Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe
häufig. Obwohl Literaturdidaktik und Lehrpläne eine Vielzahl von Gründen für den Literaturunterricht in der gymnasialen Oberstufe liefern und insbesondere die Nähe zum Entwicklungsstand der SuS hervorheben, können diese den Bezug häufig nicht nachvollziehen und erleben ihn als aufgesetzt und fadenscheinig. Gibt es nicht wichtigere Medien, mit denen man arbeiten könnte? Geht nicht Aktualität vor Historizität? Und wäre das Triviale, Alltägliche nicht näher an den Interessen der Lernenden?
Gleichzeitig hat der Ruf nach Leseförderung nach PISA in den vergangenen Jahren ein Höchstmaß erreicht. SuS sollen auch schwierige Texte durchdringen können und daran Freude haben. Denn das Erschließen eines Dramas bietet unzählige Chancen:
Den Erwerb historischer und philosophischer Kenntnisse, das Arbeiten mit Werken „unvermindert gültige[r] Kulturwertigkeit“, soziales und kooperatives Lernen, einen Spiegel der Wirklichkeit kennenzulernen, die Möglichkeit, Varianten dessen, was „wirklich“ ist, auszuprobieren, die Schöpfungskraft und Mündigkeit des Schreibenden zu erfahren, sowie die Perspektive, Selbsterkenntnis und Weltreflexion durch das Kennenlernen anderer Erfahrungs- und Erkenntnisdimensionen zu gewinnen. Andere (fiktive) Menschen können im Drama kennengelernt werden, andere Kulturen und Denkweisen. Immer bietet sich darin die Möglichkeit, das zu thematisieren, was auch in der eigenen Welt fraglich und verwirrend ist, mit der schützenden und erkenntnisbringenden Distanz, die das Heraustreten aus den eigenen Grenzen ermöglicht. Und ganz nebenbei bietet sich auch die Möglichkeit, die eigene Schreibfähigkeit zu verbessern, ebenfalls ein Bereich, den SuS häufig ablehnen.
Wenn Dramen all dies aufweisen, sollte es ein Anliegen des Deutschunterrichts sein, die Vorbehalte der SuS sanft und helfend aus dem Weg zu räumen. Vielleicht liegen sie ja darin begründet, dass SuS Lernende sind, „die die Fähigkeit, sich mit Literatur [zu] beschäftigen, erst noch erwerben müssen“. Diese Arbeit untersucht, inwiefern es möglich ist, durch die individuellen Schwerpunkte Schauspiel, Moderation und Textgestaltung, sowie das Schaffen der Zielperspektive eines Aufführungsnachmittags eine Steigerung der Lernbereitschaft zu erreichen und damit die Potenziale, die SuS und Text bieten, individuell fördernd auszuschöpfen.
Inhaltsverzeichnis
1 Erläuterung der allgemeinen Problemstellung
1.1 Pädagogische Problemstellung und überfachliche Kompetenzen
1.2 Darlegung der Fachkompetenzen in Bezug auf die Förderschwerpunkte
2 Didaktische Erläuterung auffachwissenschaftlicher Basis
2.1 Lesen und Rezipieren durch Handlung und Produktion
2.2 Schreiben und Überarbeiten
3 Darlegung der Fördermaßnahmen im Gk 11 1(
3.1 Vorbereitung der Reihe
3.2 Verlauf der Reihe
3.2.1 Zielorientierung
3.2.2 Binnendifferenziertes Erarbeitung und Partizipation in der Planung
3.2.3 Die Phasen der Reihe
3.2.3.1 Erste Phase: Rezeption
3.2.3.2 Zäsur: Theaterpädagogischer Besuch / Lernort Theater
3.2.3.3 Zweite Phase: Schreiben, Proben und Gestalten
3.3 Begründung der Auswahl des Themas und des Materials
3.4 Didaktische Analyse und Legitimation der Unterrichtsreihe
3.5 Methodische Analyse
3.6 Lernziele und Kompetenzen
4 Analyse und Reflexion einzelner Unterrichtsstunden
4.1 „Welches ist der wahre Glaube?" Doppelstunde vom 2. März 2011
4.2 „Vorbereitung der Aufführung" Doppelstunde vom 30. März
4.3 „Nathan am Nachmittag" Öffentliche Präsentation am 8. April
5 Differenzierte Evaluation
5.1 Darlegung und Begründung der Evaluationsmethoden
5.2 Evaluation
6 Konsequenzen für die Weiterarbeit
7 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Schüler oft Vorbehalte gegen klassische Literatur?
Viele Schüler empfinden Literatur als „fadenscheinig“ oder ohne Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt. Sie bevorzugen oft aktuelle Medien und hinterfragen den Nutzen historischer Texte für ihren Alltag.
Welchen Bildungswert hat das Lesen von Dramen im Deutschunterricht?
Dramen fördern historische und philosophische Kenntnisse, soziales Lernen und die Fähigkeit zur Perspektivübernahme. Sie bieten eine geschützte Distanz, um eigene Probleme und Weltbilder zu reflektieren.
Was verbirgt sich hinter dem Projekt „Nathan am Nachmittag“?
Es handelt sich um eine öffentliche Präsentation eines Grundkurses 11, bei der die Schüler durch Schauspiel, Moderation und Textgestaltung eine Steigerung ihrer Lernbereitschaft und Fachkompetenz erzielen.
Wie kann Theaterpädagogik den Literaturunterricht unterstützen?
Durch theaterpädagogische Besuche und praktisches Handeln (Proben, Gestalten) wird Literatur lebendig. Schüler wechseln von der rein passiven Rezeption zur aktiven Produktion.
Was bedeutet binnendifferenziertes Arbeiten in diesem Kontext?
Es bedeutet, dass Schüler individuell nach ihren Stärken gefördert werden – sei es im Bereich des Schreibens, des Schauspiels oder der Organisation der Aufführung.
Wie trägt das Projekt zur Leseförderung bei?
Indem Schüler schwierige Texte wie Lessings „Nathan der Weise“ nicht nur lesen, sondern durch Handlung durchdringen, entwickeln sie eine tiefere Freude am Erschließen von Literatur.
- Quote paper
- Mareike Hachemer (Author), 2011, Nathan am Nachmittag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196082