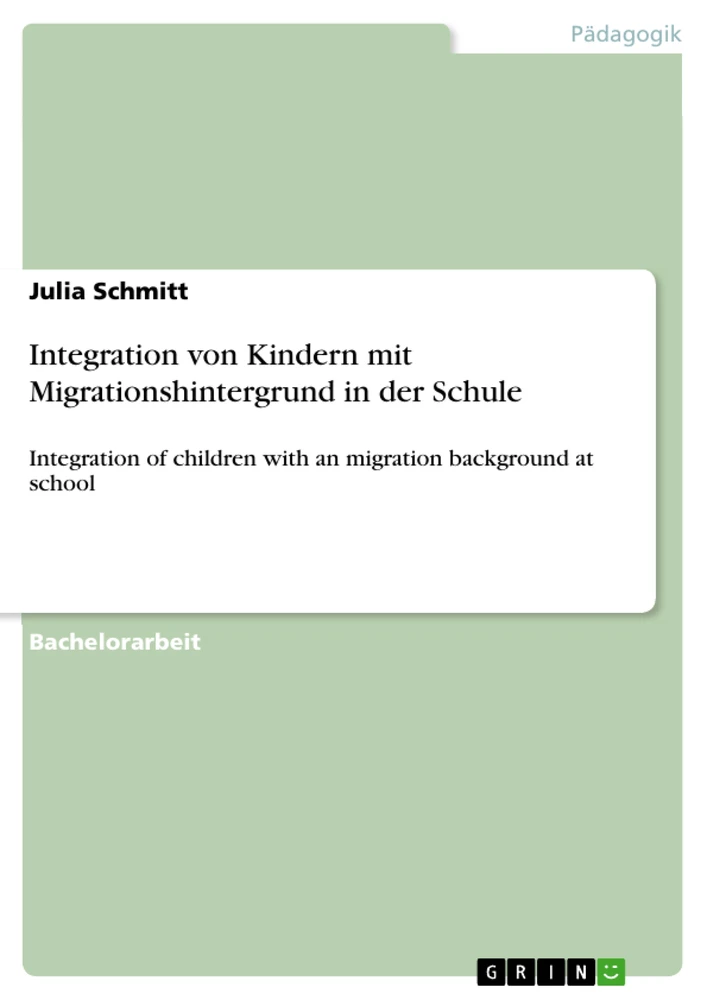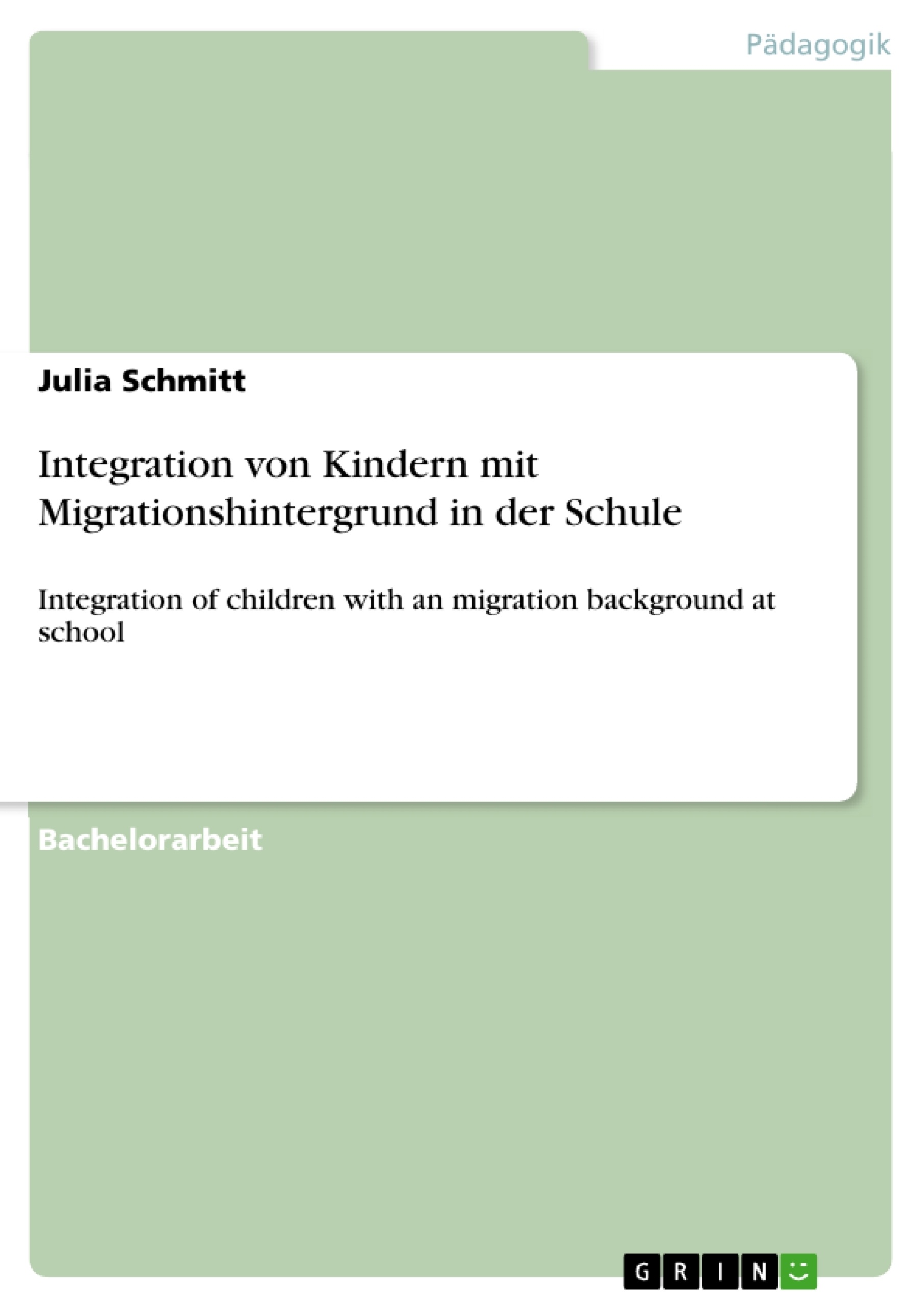Abstract
Die folgende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule“. Der Integrationsprozess wird vielschichtig diskutiert und stellt ein aktuelles Problem dar. Die Schule ist hierbei Verbindung zwischen Gesellschaft und Familie und hat die Aufgabe Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund erfolgreich in die Aufnahmegesellschaft mit einzugliedern.
In dieser Arbeit soll durch eine Studie ermittelt werden, inwieweit sich die befragten Kinder in der Schule integriert fühlen. Dazu wurden drei Schülerinnen mit türkischem Migrationshintergrund, ein Schüler mit italienischem Migrationshintergrund und eine Schülerin mit vietnamesischem Migrationshintergrund interviewt, die alle aus der zweiten bzw. dritten Generation von Migranten stammen. Diese Studie basiert auf den Grundsätzen des qualitativen Denkens und folgt dem Untersuchungsplan der Einzelfallanalyse. Erhoben wurden die Daten durch problemzentrierte Interviews, deren Fragen teilweise dem Index für Inklusion entnommen wurden.
Zu Beginn der Arbeit wird die Migration vorgestellt, welche die Wanderungsformen, die Migrationsbewegungen in Deutschland nach 1945 und eine Definition von Migrationshintergrund umfasst. Danach erfolgt eine Begriffsklärung von Integration, in der auch auf Erklärungsansätze und speziell die Integration von Kindern und Jugendlichen eingegangen wird. Darauf folgt dann ein Kapitel, in dem beschrieben wird, wie die Institution Schule mit Migration und Integration umgeht, um dann zum Index für Inklusion überzuleiten, der wie bereits kurz beschrieben, für die in dieser Arbeit durchgeführte Studie verwendet wurde. Anschließend wird aufgezeigt, wie die Studie erhoben, ausgeführt, aufbereitet und ausgewertet wurde, um dann die erlangten Ergebnisse mit dem Index für Inklusion zu vergleichen. Im Resümee werden noch einmal die wichtigsten Punkte der Befragung zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Migration
- Wanderungsformen
- Migrationsbewegungen in Deutschland
- Migrationshintergrund
- Integration
- Drei Erklärungsansätze für Integration
- Integration von Kindern und Jugendlichen
- Migration und Integration in der Schule
- Index für Inklusion
- Die durchgeführte Studie
- Die Theorie des qualitativen Denkens
- Untersuchungsplan der Studie
- Die qualitative Analyse
- Das Erhebungsverfahren
- Das Durchführungs- und Aufbereitungsverfahren
- Das Auswertungsverfahren
- Vergleich der Ergebnisse mit dem Index für Inklusion
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule, einem Thema, das in der heutigen Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Sie untersucht, inwieweit sich Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule integriert fühlen, und betrachtet die Rolle der Institution Schule bei der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.
- Migrationshintergrund und seine Auswirkungen auf die Integration von Kindern
- Die Rolle der Schule bei der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund
- Die Bedeutung von Inklusion und Teilhabe für die Integration
- Qualitative Forschung und die Einzelfallanalyse als Forschungsmethode
- Die Untersuchung der subjektiven Integrationserfahrungen von Kindern mit Migrationshintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule als aktuelles Problem dar und erläutert die Bedeutung des Themas in der heutigen Gesellschaft.
- Das Kapitel "Migration" beleuchtet verschiedene Wanderungsformen, die Migrationsbewegungen in Deutschland nach 1945 und die Definition von Migrationshintergrund.
- Im Kapitel "Integration" erfolgt eine Begriffsklärung und die Präsentation von drei Erklärungsansätzen für Integration. Es wird zudem auf die Integration von Kindern und Jugendlichen im Speziellen eingegangen.
- Das Kapitel "Migration und Integration in der Schule" beschreibt, wie die Institution Schule mit Migration und Integration umgeht.
- Das Kapitel "Index für Inklusion" stellt den für die in dieser Arbeit durchgeführte Studie verwendeten Index vor.
- Das Kapitel "Die durchgeführte Studie" erläutert die Theorie des qualitativen Denkens, den Untersuchungsplan der Studie und die qualitative Analyse. Dazu werden die verwendeten Erhebungs-, Durchführungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule, die Bedeutung von Inklusion, qualitative Forschung, Einzelfallanalyse, Migrationshintergrund, Integrationsprozesse, und subjektive Integrationserfahrungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Schule beim Integrationsprozess?
Die Schule fungiert als zentrale Verbindung zwischen Familie und Gesellschaft mit dem Auftrag, Kinder mit Migrationshintergrund erfolgreich in die Aufnahmegesellschaft einzugliedern.
Was ist der „Index für Inklusion“?
Dies ist ein Leitfaden, der Schulen dabei unterstützt, Barrieren für Lernen und Teilhabe abzubauen und eine inklusive Schulkultur für alle Kinder zu entwickeln.
Wie wurde die Studie zur Integration durchgeführt?
Es wurden problemzentrierte, qualitative Interviews mit fünf Schülern unterschiedlicher Herkunft (Türkei, Italien, Vietnam) durchgeführt, um deren subjektives Zugehörigkeitsgefühl zu ermitteln.
Was versteht man unter „Migrationshintergrund“ in dieser Arbeit?
Der Begriff umfasst Kinder der zweiten und dritten Generation, deren Eltern oder Großeltern nach Deutschland eingewandert sind, und beleuchtet deren spezifische Herausforderungen.
Welche Erklärungsansätze für Integration werden vorgestellt?
Die Arbeit diskutiert drei verschiedene wissenschaftliche Erklärungsansätze, die den Prozess der Eingliederung von Kindern und Jugendlichen theoretisch untermauern.
- Quote paper
- Julia Schmitt (Author), 2011, Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196087