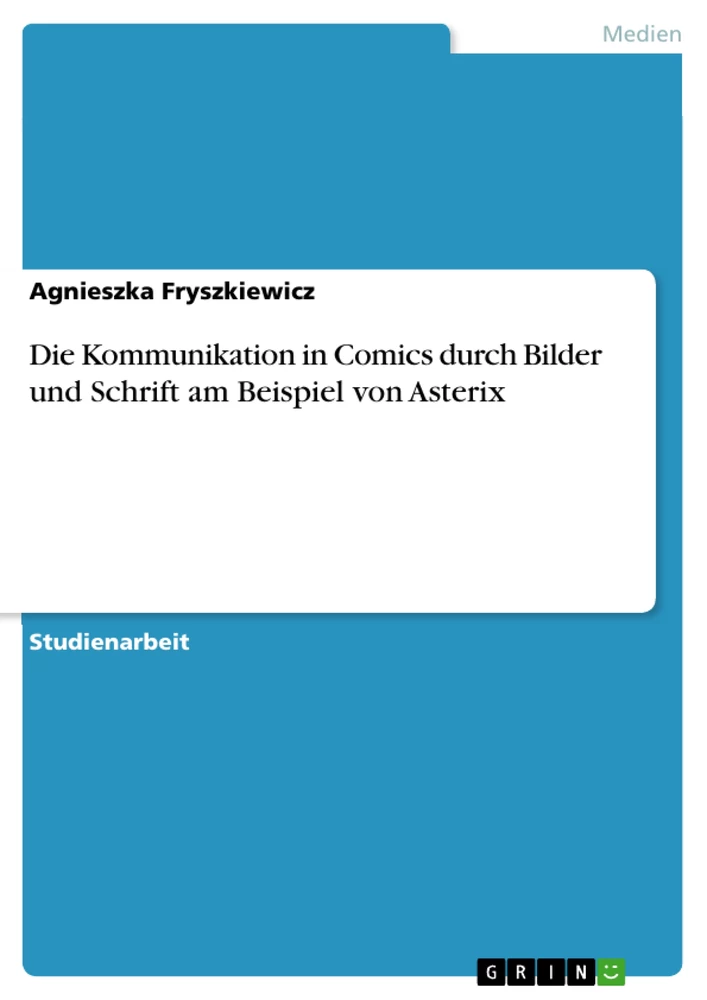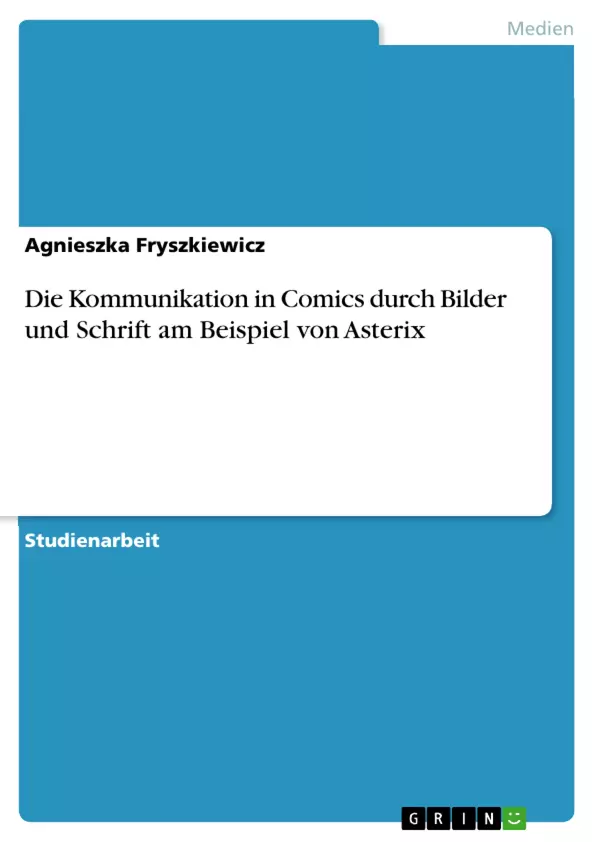Der Autor möchte im Rahmen dieser Arbeit aufzeigen, dass die Charakterisierung „minderwertig“ den Comics keinesfalls gerecht wird. Vielmehr gilt Comics lesen als eine eigene Kulturtechnik, die erlernt werden muss.
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Funktionsweise von Comics und wie Bild und Schrift zusammenspielen. Im Rahmen dieser Arbeit stützt sich der Autor vor allem auf das Werk „Comics richtig lesen“ von Scott McCloud und Jakob Dittmar mit seine wissenschaftlichen Beitrag zur Comicforschung „Comic-Analyse“. Beide gelten als gegenwärtige wichtige Kenner und Theoretiker des Mediums. Zur Analyse wurden Beispiele aus einem der einen der wichtigsten europäischen Comic-Klassiker: „Asterix“. Dieser historische Funny, erfunden von den beiden Franzosen Albert Uderzo und Rene Goscinny, erfreut sich noch heute großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Und sie erfüllt darüber hinaus noch einen ganz besonderen Lehrauftrag: Die zwölf Ausgaben in lateinischer Sprache werden heute in vielen Schulen als Lehrmittel eingesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte des Comics
- Comic als Medium – Begriffsdefinition
- Das Zeicheninventar des Comics
- Das Bild
- Der Text
- Die Symbole
- Das Panel
- Zusammenspiel von Bild- und Textebene
- Wie Comics erzählen
- Die Sequenzen von Bildern
- Das Indiz
- Die Induktion
- Der Zeitrahmen
- Die Bewegung
- Der Schall
- Die Emotionen und Konventionen
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktionsweise von Comics als eigenständiges Medium und beleuchtet das Zusammenspiel von Bild und Schrift. Sie widerlegt die oft gehörte Behauptung, Comics seien minderwertig, und präsentiert sie stattdessen als eigenständige Kulturtechnik. Die Analyse stützt sich auf die Werke von Scott McCloud und Jakob Dittmar und verwendet Beispiele aus Asterix.
- Die Geschichte und Entwicklung des Comics
- Comics als hybrides Medium: Das Zusammenspiel von Bild und Text
- Das Zeicheninventar des Comics: Bild, Text, Symbole, Panel
- Die Erzähltechnik in Comics
- Die kulturelle Bedeutung und Akzeptanz von Comics
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der einleitende Abschnitt thematisiert die oft unterschätzte wissenschaftliche Betrachtung von Comics. Er stellt die Frage nach der kulturellen Akzeptanz des Mediums und widerlegt die Annahme der Minderwertigkeit von Comics im Vergleich zu anderen Kunstformen wie Literatur oder Malerei. Die Arbeit argumentiert für Comics als eigenständige Kulturtechnik und kündigt die Analyse der Funktionsweise von Bild und Schrift in Comics an, wobei die Werke von McCloud und Dittmar sowie Beispiele aus Asterix als Grundlage dienen.
Geschichte des Comics: Dieses Kapitel untersucht die umstrittenen Ursprünge des Comics und verfolgt seine Entwicklung von frühen Formen wie Höhlenmalereien und Wandteppichen (beispielsweise dem Bayeux-Teppich) über Bilderbögen und die Werke von Wilhelm Busch und Rodolphe Töppfer bis hin zur Entstehung der ersten Comic-Strips in den USA Ende des 19. Jahrhunderts. Es beleuchtet die Popularität von Comics im Nachkriegsdeutschland und die Entwicklung einer deutschen Comic-Produktion, einschliesslich der Herausforderungen und Unterschiede in Ost und Westdeutschland.
Comic als Medium - Begriffsdefinition: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, eine allgemeingültige Definition von „Comic“ zu finden. Es diskutiert die verschiedenen Ansätze von bedeutenden Comic-Theoretikern wie Will Eisner und Scott McCloud, die Comics als sequentielle Kunst definieren, und betont den hybriden Charakter des Mediums als Kombination aus Literatur und Bildender Kunst. Das Kapitel unterstreicht den narrativen Aspekt und die spezifischen Lesarten, die Comics erfordern.
Das Zeicheninventar des Comics: Hier werden die grundlegenden Bestandteile eines Comics – Bild, Text und Symbol – sowie das Panel als zentrale Elemente des narrativen Aufbaus analysiert. Das Kapitel erläutert die Funktionsmechanismen dieser Elemente und betont deren Zusammenspiel für die Gesamtwirkung eines Comics. Es legt den Fokus auf die Bedeutung der Einheit und Harmonie dieser Bestandteile für die Qualität eines Comics.
Schlüsselwörter
Comics, Bildsprache, Schriftsprache, sequentielle Kunst, Comic-Analyse, Medium, Kulturtechnik, Bildgeschichte, Erzähltechnik, Wilhelm Busch, Scott McCloud, Jakob Dittmar, Asterix.
Häufig gestellte Fragen zum Comic-Handbuch
Was ist der Inhalt dieses Comic-Handbuchs?
Dieses Handbuch bietet einen umfassenden Überblick über Comics als eigenständiges Medium. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Zusammenspiels von Bild und Text in Comics und der Widerlegung der oft gehörten Behauptung, Comics seien minderwertig.
Welche Themen werden im Handbuch behandelt?
Das Handbuch behandelt folgende Themen: Geschichte des Comics, Definition des Mediums "Comic", das Zeicheninventar (Bild, Text, Symbole, Panel), das Zusammenspiel von Bild und Textebene, Erzähltechniken in Comics (Sequenzen, Indiz, Induktion, Zeitrahmen), Emotionen und Konventionen in Comics und die kulturelle Bedeutung von Comics.
Welche Methoden werden zur Analyse verwendet?
Die Analyse stützt sich auf die Werke von Scott McCloud und Jakob Dittmar und verwendet Beispiele aus Asterix. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zur Definition von Comics diskutiert und die Funktionsweise der einzelnen Elemente eines Comics analysiert.
Welche Kapitel umfasst das Handbuch?
Das Handbuch umfasst Kapitel zur Einleitung, Geschichte des Comics, Begriffsdefinition von Comics, dem Zeicheninventar des Comics, dem Zusammenspiel von Bild und Textebene, den Erzähltechniken in Comics, Emotionen und Konventionen sowie eine Schlussbemerkung.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Handbuch behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: Comics, Bildsprache, Schriftsprache, sequentielle Kunst, Comic-Analyse, Medium, Kulturtechnik, Bildgeschichte, Erzähltechnik, Wilhelm Busch, Scott McCloud, Jakob Dittmar, Asterix.
Wer sind die wichtigsten Bezugspunkte der Analyse?
Die Analyse bezieht sich maßgeblich auf die Arbeiten von Scott McCloud und Jakob Dittmar. Beispiele aus der Comicreihe Asterix dienen zur Illustration.
Was ist die zentrale These des Handbuchs?
Die zentrale These ist, dass Comics eine eigenständige Kulturtechnik darstellen und nicht als minderwertig im Vergleich zu anderen Kunstformen betrachtet werden sollten. Das Handbuch argumentiert für eine wissenschaftliche und differenzierte Betrachtung des Mediums.
Für wen ist dieses Handbuch gedacht?
Dieses Handbuch richtet sich an alle, die sich wissenschaftlich mit Comics auseinandersetzen möchten, sei es aus akademischem Interesse oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit. Es eignet sich für Studenten, Wissenschaftler und alle, die ein tieferes Verständnis für das Medium Comic erlangen wollen.
Wie wird die Geschichte des Comics dargestellt?
Die Darstellung der Comicgeschichte verfolgt die Entwicklung von frühen Formen wie Höhlenmalereien und Wandteppichen bis hin zur Entstehung der ersten Comic-Strips. Besonderes Augenmerk wird auf die Entwicklung in Deutschland, inklusive der Unterschiede zwischen Ost und West, gelegt.
Wie wird der Begriff "Comic" definiert?
Das Handbuch diskutiert verschiedene Definitionen von "Comic", insbesondere die Definition als sequentielle Kunst von Will Eisner und Scott McCloud. Es betont den hybriden Charakter des Mediums als Kombination aus Literatur und Bildender Kunst.
- Arbeit zitieren
- Agnieszka Fryszkiewicz (Autor:in), 2012, Die Kommunikation in Comics durch Bilder und Schrift am Beispiel von Asterix, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196090