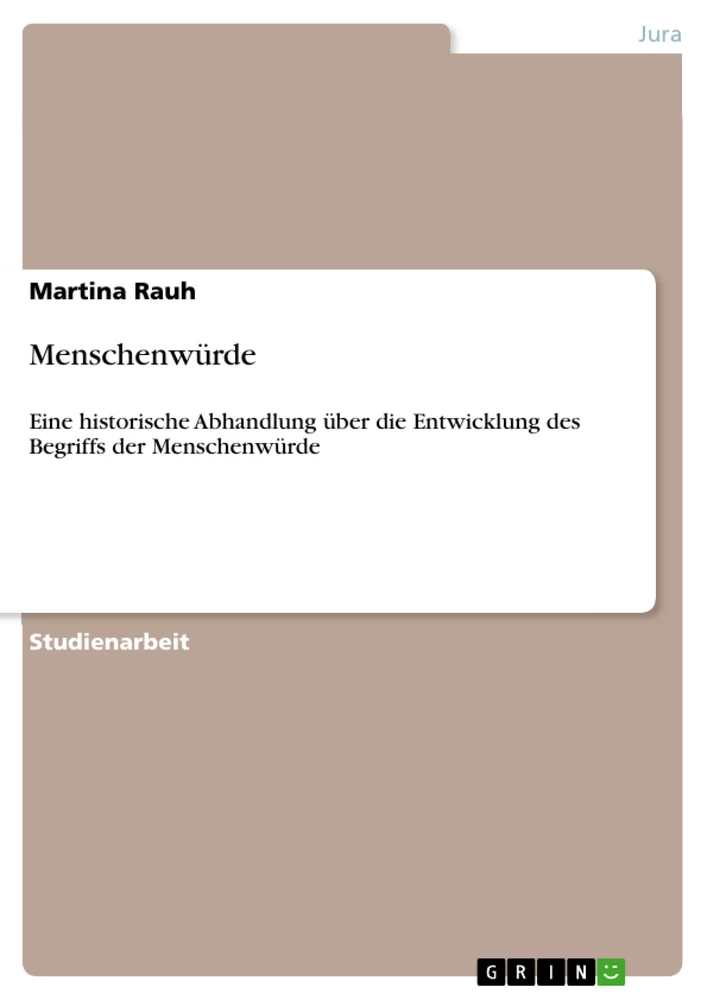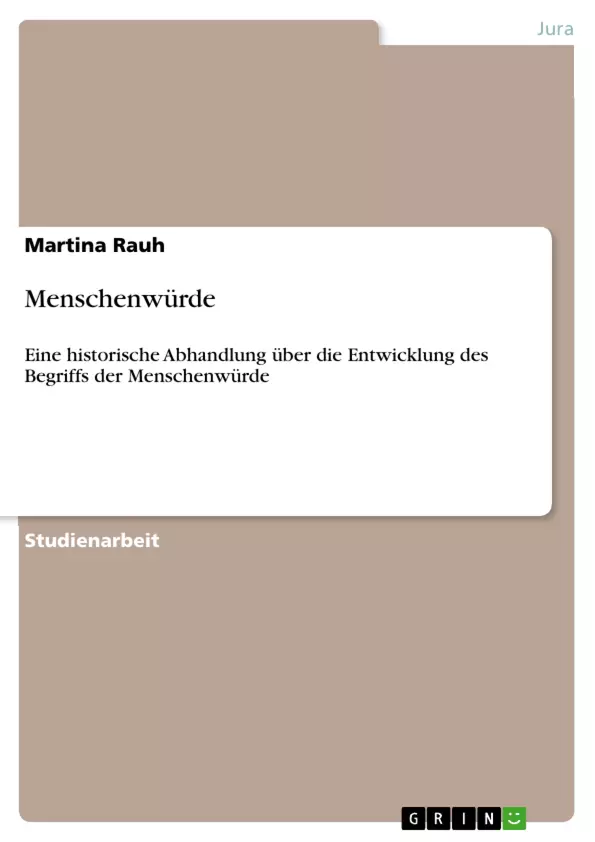Nach der eingehenden Betrachtung der ideengeschichtlichen und der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung der Menschenwürde bleibt festzuhalten, dass die Menschenwürde in der Tat unantastbar ist. Doch dies war nicht immer so. Die zahlreichen Verletzungen der Menschenwürde während der NS-Zeit haben erst aufgezeigt, wie wichtig es ist, die Menschenwürde zu achten und zu schützen. Dabei ist es dem deutschen Volk gelungen, aus den schweren Verbrechen der Vergangenheit zu lernen und dies auch in einem durchaus vorzeigefähigen Grundgesetz festzuhalten. Erst die deutsche Geschichte hat uns gelehrt, welchen Rangwert die Achtung Menschenwürde für ein dauerhaft friedliches Zusammenleben haben sollte.
Nicht nur in der Geschichte spielt die Würde des Menschen eine Rolle. Auch in der heutigen Zeit wird über den Begriff heftig diskutiert und er ist aktueller denn je. Dass die Würde des Menschen immer und zu jeder Zeit Beachtung findet, steht dabei außer Frage. Derzeit geht es vielmehr um den genauen Inhalt und die Reichweite der Würdegarantie. Bei der Festlegung der Regelsätze für Sozialhilfeempfänger geht es in den Debatten des Bundestages um den Preis der Menschenwürde. Dabei stellt sich die Frage, ob sich die Menschenwürde beziffern lässt und wenn ja wie viel sie dann überhaupt kostet. Auch in den modernen Forschungslaboren dreht es sich häufig um die Würdefähigkeit eines Embryonen. Ethische Bedenken werden bei der Diskussion um die embryonale Stammzellenforschung geäußert, dabei geraten die Forschungsinteressen in Widerstreit zur Menschenwürdegarantie.
Diese aktuellen Fragen ergeben sich erst aus der Fortentwickelung der Wissenschaft und aus der Weiterentwicklung des Menschen. Auch heute noch ist der Begriff der Menschenwürde ein dynamischer. Es kann und sollte immer mehr und besser erkannt werden, was dem Menschen auf Grund seiner unverlierbaren Grundwürde an weiterer Würde zusteht. Es ist ein Prozess, der zwar Etappen kennt, aber grundsätzlich nicht abgeschlossen werden kann, ebenso wenig wie die Entwicklung des Menschen selbst als ein gesellschaftlich-kulturelles Wesen.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Der Rechtsbegriff der Menschenwürde
1. Kulturgeschichte der Würde
a) Antike Philosophie
b) Christliche Anthropologie
c) Zeit der Aufklärung
2. Rechtsgeschichte der Menschenwürde in der Bundesrepublik Deutschland
a) Paulskirchenverfassung von 1849
b) Weimarer Verfassung von 1919
c) Zeit des Nationalsozialismus
III. Missbrauch der Würde des Menschen in der NS-Zeit
1. Rechtsanwendung als Gesetzgebungsersatz
a) Instrumentarien zur ideologischen Umwertung der Rechtsordnung
b) Die Möglichkeit zur Verletzung der Menschenwürde
aa) Unbestimmter Rechtsbegriff und Richterrecht
(a) Der unbestimmte Rechtsbegriff
(b) Unbestimmter Rechtsbegriff in Verbindung mit dem Richterrecht
bb) Missachtung der Verfassungsgrundsätze
cc) Ideologie als Inhalt des Rechts
2. Lehren aus der Rechtsperversion im Nationalsozialismus
3. Umsetzung der gewonnen Lehren
a) Überblick über die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat
b) Die bedeutendsten Unterschiede zwischen Weimarer Verfassung und Bonner Grundgesetz
c) Reaktionen auf die NS-Diktatur
d) Ergebnis: Aufnahme der Menschenwürde in die Bundesgrundrechte
IV. Menschenwürde als oberstes deutsches Verfassungsprinzip
1. Schutzgehalt der Menschenwürde
2. Systematische Stellung und dogmatische Funktion der Würde des Menschen...
a) Systematische Stellung
aa) Sonderstellung des Art. 1 GG
bb) Art. 1 GG als Grundnorm
cc) Verstärkte Geltungskraft der Grundrechte
d) Dogmatische Funktion
aa) Menschenwürde als Prinzip zur Grundrechtsinterpretation
bb) Menschenwürde als Wurzel von Rechtsprinzipien
e) Juristische Bewertung
V. Die Menschenwürde im europäischen Kontext
1. Menschenwürde als Grundwert
2. Menschenwürde als Grundrecht
VI. Resümee
Häufig gestellte Fragen
Ist die Menschenwürde im deutschen Grundgesetz wirklich unantastbar?
Ja, Artikel 1 des Grundgesetzes legt fest, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und sie zu achten und zu schützen Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist.
Warum wurde die Menschenwürde so prominent in das Grundgesetz aufgenommen?
Dies war eine direkte Reaktion auf die massiven Verbrechen und die systematische Missachtung der Würde während der Zeit des Nationalsozialismus.
Welche Rolle spielt die Menschenwürde in der modernen Forschung?
In der Bioethik wird heftig über die Würde von Embryonen und die Grenzen der Stammzellenforschung diskutiert, wobei Forschungsfreiheit gegen Würdegarantie abgewogen wird.
Kann die Menschenwürde finanziell beziffert werden?
Debatten um Sozialhilfesätze berühren oft die Frage, welches Existenzminimum notwendig ist, um ein Leben in Würde zu ermöglichen, ohne sie rein materiell zu definieren.
Wie hat sich der Begriff der Würde historisch entwickelt?
Die Wurzeln liegen in der antiken Philosophie, der christlichen Anthropologie und der Aufklärung, wobei sich der Fokus von einem Standesprivileg zum universellen Recht wandelte.
- Citar trabajo
- Martina Rauh (Autor), 2010, Menschenwürde, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196260