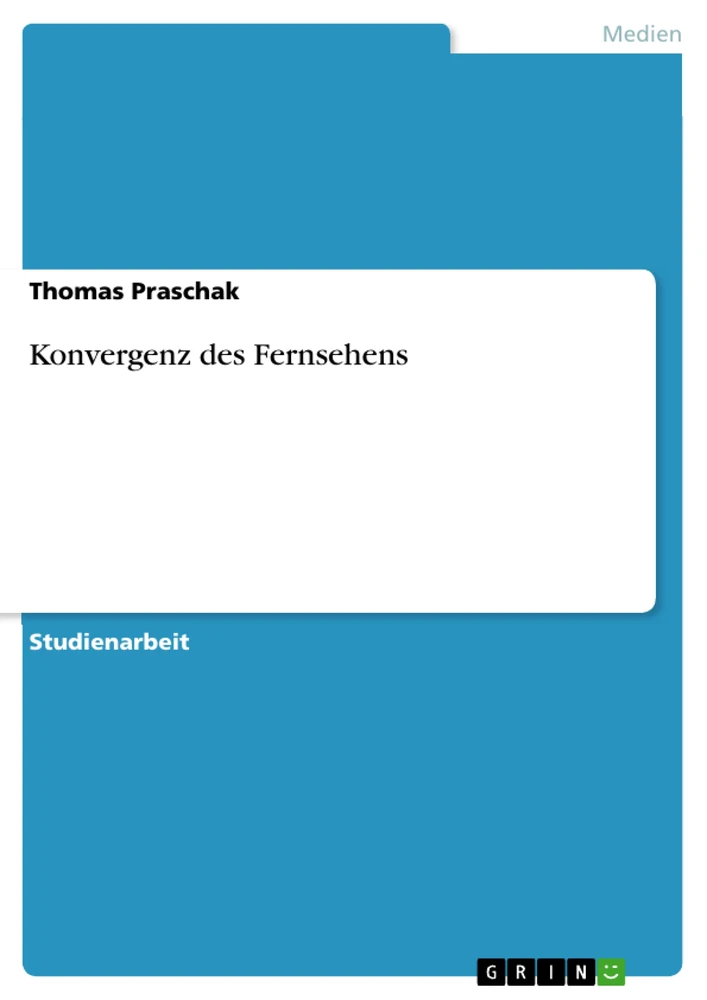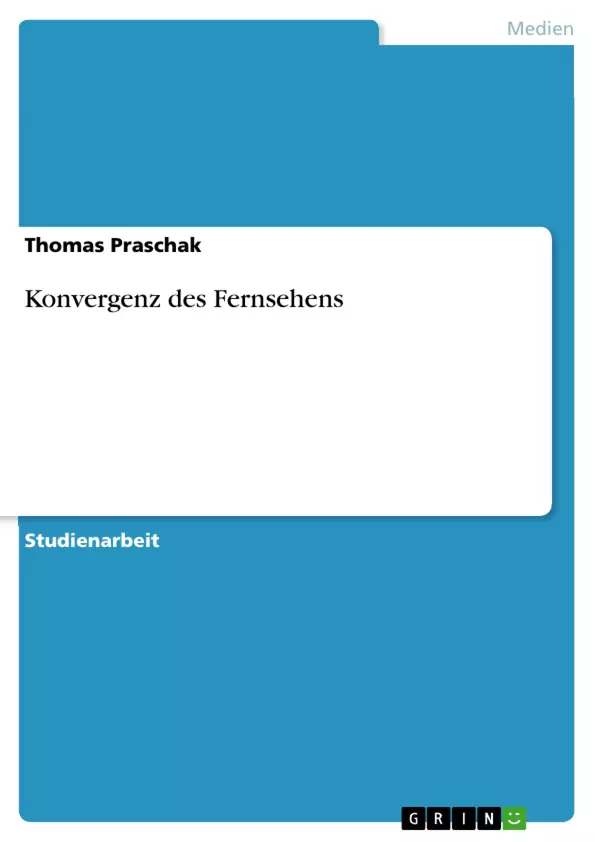Das Fernsehen ist das beliebteste Medium der Deutschen, durchschnittlich schaut jeder Bürger
drei Stunden und 49 Minuten am Tag fern (Stand 2011)1. Das die Menge an Zeit, die für den
Fernsehkonsum aufgewendet wird auch das Interesse der Wissenschaft weckt, ist nicht
verwunderlich. Doch dabei konzentriert man sich nicht nur auf rein quantitative Aspekte wie,
wie lange und oft wird ferngesehen oder welche Personengruppen welche Programme schauen
sondern auch detailliertere Sachverhalte, wie die Nutzungsmotive der Zuschauer.
Ich möchte mich daher in meiner Arbeit dem Gegenstand der Konvergenz widmen. Dieses
Thema bietet verschiedenste Herangehensweisen, sowohl qualitativer als auch quantitativer
Natur. Ich werde auf den nächsten Seiten versuchen, den Begriff der Konvergenz erst in
grundlegendem Maße und dann auf der Ebene des Fernsehens zu erläutern und darauf folgend
eine Einführung in die Konvergenzhypothese, welche von Schatz/ Immer und Marcinkowski
aufgestellt wurde, geben. Es wird überprüft, aus welcher Perspektive Konvergenz überhaupt
möglich ist und welche dieser Sichtweisen die ausschlaggebendste ist.
Die bereits erwähnte Hypothese zur Konvergenz im Fernsehen soll mir als Ausgangspunkt
dienen und ich werde untersuchen, in welchen Gebieten es empirisch belegbar zu Konvergenz
gekommen ist.
Beginnen möchte ich mit der Definition von Konvergenz, was Konvergenz im Zusammenhang
mit Fernsehen bedeutet und eine kurze historische Entwicklung der Forschung zu diesem Thema
aufzeigen. Danach will ich mich der Konvergenz aus drei Blickwinkeln nähern, dabei handelt es
sich einmal um die Konvergenz der Programmstruktur, darauf folgend die Sicht der Zuschauer
und zuletzt auf Basis von Rezeptionsurteilen. Ich werde die drei Perspektiven kritisch betrachten
und versuchen Schwachstellen der jeweiligen Herangehensweise aufzuzeigen.
Im zweiten Teil der Arbeit werde ich etwas genauer auf die Entwicklung der einzelnen
Programme eingehen und sie ebenfalls auf konvergente Entwicklungen hin untersuchen und
betrachten wie sich die Profile der Sender im Zeitverlauf verändert haben.
Hauptaugenmerk will ich dabei auf die Entwicklung der Spartenprofile von öffentlich/
rechtlichen und privaten Sendern in den letzten zehn Jahren legen.
Ich werde anschließend die gefundenen Ergebnisse interpretieren und sie in einem Fazit
zusammenfassen und eine Antwort darauf geben ob die zugrundeliegende Hypothese in den
untersuchten Bereichen zutrifft.
Inhaltsverzeichnis
- Überblick
- Definitionen von Konvergenz und die „Konvergenzhypothese“
- Konvergenz aus unterschiedlichen Blickwinkeln
- Konvergenz der Programmstruktur
- Konvergenz aus Zuschauersicht
- Konvergenz aus Rezeptionsurteilen
- Spartenprofile, Sendungsformen und Sendungsformen der Sparte
- Spartenprofile
- Sendungsformen
- Sendungsformen der Sparte
- Entwicklung der Spartenprofile von ARD/ ZDF/RTL/ Sat.1 und ProSieben
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Konvergenz im deutschen Fernsehen. Es wird untersucht, inwieweit sich die Programmstrukturen von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern im Zeitverlauf aneinander annähern. Dafür wird die „Konvergenzhypothese“ von Schatz/ Immer und Marcinkowski herangezogen, die besagt, dass der Wettbewerb zwischen den Sendern zu einer Annäherung ihrer Funktionen führt.
- Definition und historische Entwicklung der Konvergenzforschung
- Analyse der Konvergenz aus unterschiedlichen Perspektiven (Programmstruktur, Zuschauersicht, Rezeptionsurteile)
- Entwicklung der Spartenprofile von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern
- Empirische Überprüfung der Konvergenzhypothese
- Zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
- Überblick: Die Einleitung stellt das Thema Konvergenz im Fernsehen vor und beleuchtet die Relevanz des Forschungsfeldes. Es wird ein Überblick über den Forschungsstand gegeben und die Zielsetzung der Arbeit erläutert.
- Definitionen von Konvergenz und die „Konvergenzhypothese“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Konvergenz“ und stellt die „Konvergenzhypothese“ von Schatz/ Immer und Marcinkowski vor. Die Hypothese besagt, dass der Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern zu einer Annäherung ihrer Funktionen führt.
- Konvergenz aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Dieses Kapitel analysiert die Konvergenz aus drei unterschiedlichen Perspektiven: die Programmstruktur, die Sichtweise der Zuschauer und die Rezeptionsurteile. Es werden sowohl Argumente für als auch gegen konvergente Entwicklungen im dualen Rundfunksystem untersucht.
- Spartenprofile, Sendungsformen und Sendungsformen der Sparte: Dieses Kapitel geht näher auf die Entwicklung der einzelnen Programme ein und untersucht, ob es zu konvergenten Entwicklungen in den Spartenprofilen von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern gekommen ist.
- Entwicklung der Spartenprofile von ARD/ ZDF/RTL/ Sat.1 und ProSieben: In diesem Kapitel werden die Spartenprofile von fünf wichtigen Sendern in den letzten zehn Jahren untersucht. Es wird analysiert, wie sich die Profile im Zeitverlauf verändert haben und ob es zu konvergenten Entwicklungen gekommen ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Konvergenz, Medienkonvergenz, Programmstruktur, Fernsehforschung, duale Rundfunksystem, öffentlich-rechtliches Fernsehen, privates Fernsehen, Konvergenzhypothese, Spartenprofile, Sendungsformen, Rezeptionsurteile, Zuschauerverhalten, empirische Forschung, quantitative Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Konvergenzhypothese im Fernsehen?
Die von Schatz, Immer und Marcinkowski aufgestellte Hypothese besagt, dass der Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern zu einer Angleichung (Konvergenz) ihrer Funktionen und Programmstrukturen führt.
Aus welchen Perspektiven kann Medienkonvergenz betrachtet werden?
Konvergenz lässt sich aus der Sicht der Programmstruktur (Inhalte), der Zuschauerperspektive (Nutzungsmotive) und auf Basis von Rezeptionsurteilen (Bewertung durch das Publikum) analysieren.
Wie hoch ist die durchschnittliche tägliche Fernsehdauer in Deutschland?
Laut Daten von 2011 schauen die Deutschen durchschnittlich drei Stunden und 49 Minuten pro Tag fern.
Was sind Spartenprofile bei Fernsehsendern?
Spartenprofile beschreiben die inhaltliche Zusammensetzung eines Senders, zum Beispiel den Anteil an Information, Unterhaltung, Sport oder Kultur im Gesamtprogramm.
Haben sich private und öffentlich-rechtliche Sender in den letzten Jahren angenähert?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage empirisch anhand der Sender ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und ProSieben, um festzustellen, ob die Profile über die Zeit konvergieren.
- Quote paper
- Thomas Praschak (Author), 2012, Konvergenz des Fernsehens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196265