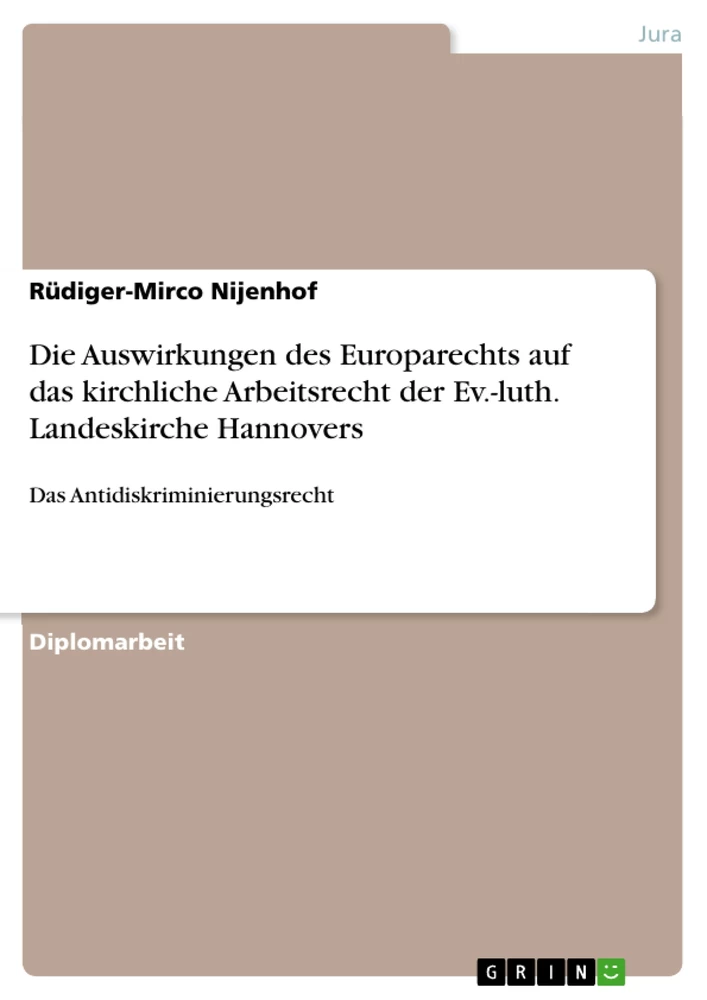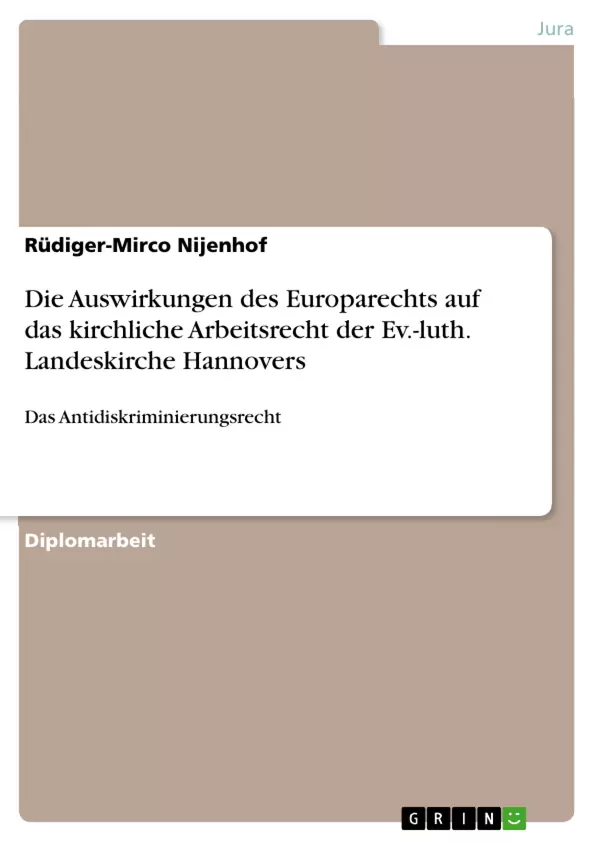Die EU erscheint den meisten Menschen weit vom Leben entfernt, dass dies nicht immer so ist, die Rechtssetzung durch die EU vielmehr direkt und unmittelbar das Leben jedes Einzelnen beeinflussen kann, zeigt sich gerade im Antidiskriminierungsrecht. Hier hat die EU in den letzten Jahren einige Richtlinien erlassen, die das Ziel haben, Ungleichbehandlungen aufgrund verschiedener Gründe zu bekämpfen. Etwas verspätet hat auch die Bundesrepublik vier dieser Richtlinien in nationales Recht umgesetzt und so das AGG erlassen.
Bereits, als die ersten Richtlinien in Kraft traten, beschäftigte sich die wissenschaftliche Literatur mit möglichen Auswirkungen auf kirchliche Arbeitsverhältnisse. Der EuGH allerdings hat es bisher vermieden im Bereich des Religionsrechts Recht zu sprechen.
Nach bisher geltendem Recht, hat die Kirche die verfassungsrechtlich garantierte Möglichkeit sich im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts, eigene kirchliche Gesetze zu geben und darin auch, nur dem eigenen Selbstverständnis verpflichtet, festzulegen, inwieweit eine bestimmte Konfession für ein bestimmtes Amt, eine bestimmte Funktion oder auch für eine bestimmte Tätigkeit notwendig ist, zudem auch, wie sich ein kirchlicher Mitarbeiter im Dienst, aber auch in seinem Privatleben zu verhalten hat.
Dabei ist zu bemerken, dass gerade das kirchliche Arbeitsrecht in den letzten Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen hat. Grund hierfür ist vor allem dass der Staat sich aus vielen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens zurückgezogen hat und noch zurückzieht und die Kirchen, auch aufgrund ihres Selbstverständnisses, in diese Lücken nachgerückt sind und sie ausfüllen. So waren noch 1960 nur etwa 320.000 Menschen im Umfeld der beiden großen Volkskirchen beschäftigt, während es jetzt mehr als 1,2 Mio. sind.
Hier kommt nun aber der Konflikt zwischen dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht und dem Europarecht zum Tragen. Während die Kirche ihr eigenes Engagement und ihre eigene Tätigkeit vor allem als religiöses Handeln begreift, ist sie zugleich auch Arbeitgeber und hat Arbeitnehmer. Arbeitnehmer, die sich nun auf die Gleichbehandlungsrichtlinien und das AGG berufen können.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Das deutsche Staatskirchenrecht
2.1. Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht
2.1.1. Die Träger des Selbstbestimmungsrecht
2.1.2. Der Inhalt des Selbstbestimmungsrechts
2.1.3. Die Schranken des Selbstbestimmungsrechts
2.1.4. Das Selbstbestimmungsrecht und die Grundrechtsbindung
2.2. Die Dienstgemeinschaft als prägendes Prinzip
3. Regelungen des kirchlichen Arbeitsrechts
3.1. Kirchliche Regelungen des Individualarbeitsrechts
3.1.1. Anstellungsvoraussetzungen
3.1.2. Die Loyalitätspflichten
3.1.3. Die Sanktionierung von Verstößen
3.2. Kirchliche Regelungen des kollektiven Arbeitsrechts
3.2.1. Die MAV-Mitgliedschaft
3.2.2. Die ADK-Mitgliedschaft
4. Europarecht
4.1. Regelungskompetenz der EU im kirchlichen Arbeitsrecht
4.1.1. Kompetenzbegründung
4.1.2. Kompetenzschranken
4.2. Anti-Diskriminierungsregelungen der EU im Arbeitsrecht
4.2.1. Primäres Gemeinschaftsrecht
4.2.2. Sekundäres Gemeinschaftsrecht
4.3. EG-Richtlinien und das nationale Recht
4.3.1. Die Richtlinienkonforme Auslegung
4.3.2. Anwendungsvorrang
5. Europarecht und das kirchliche Arbeitsrecht der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
5.1. Allgemeines
5.2. Sachlicher Anwendungsbereich
5.2.1. Richtlinienkonforme Auslegung des § 2 Abs. 4 AGG
5.2.2. Wortlautauslegung des § 2 Abs. 4 AGG
5.2.3. Ergebnis der Auslegung
5.2.4. Anwendungsvorrang der Richtlinie
5.3. Persönlicher Geltungsbereich
5.3.1. Privatrechtliche Arbeitsverhältnisse
5.3.2. Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse
5.3.3. Zusammenfassung des Geltungsbereichs
5.4. Diskriminierung aufgrund der Religion
5.4.1. Grundsatz des Verbots der religiösen Diskriminierung
5.4.2. Ausnahme vom Verbot der religiösen Diskriminierung
5.5. Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität
5.6. Andere Diskriminierungen
6. Abschließende Zusammenfassung und Perspektive
6.1. Zusammenfassung
6.1.1. Allgemein
6.1.2. Diskriminierung aufgrund der Religion
6.1.3. Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität
6.1.4. Andere Diskriminierungen
6.1.5. Offene Fragen zum Geltungsbereich des AGG
6.2. Perspektive
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das kirchliche Selbstbestimmungsrecht?
Es ist ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht der Kirchen, ihre eigenen Angelegenheiten (einschließlich Arbeitsrecht) selbst zu regeln.
Wie beeinflusst das Europarecht das kirchliche Arbeitsrecht?
EU-Richtlinien zum Antidiskriminierungsrecht (umgesetzt im AGG) setzen Schranken für kirchliche Loyalitätspflichten und Anstellungsvoraussetzungen.
Was bedeutet "Dienstgemeinschaft" im kirchlichen Kontext?
Es ist das prägende Prinzip, nach dem alle Mitarbeiter am kirchlichen Auftrag teilhaben, was besondere Loyalitätspflichten begründet.
Darf die Kirche Mitarbeiter wegen ihrer Religion benachteiligen?
Das AGG erlaubt Ausnahmen, wenn die Religionszugehörigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung für die spezifische Tätigkeit darstellt.
Gilt das AGG auch für sexuelle Identität in der Kirche?
Die Arbeit untersucht den Konflikt zwischen kirchlichen Moralvorstellungen und dem europarechtlichen Verbot der Diskriminierung aufgrund sexueller Identität.
- Quote paper
- Rüdiger-Mirco Nijenhof (Author), 2007, Die Auswirkungen des Europarechts auf das kirchliche Arbeitsrecht der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196266