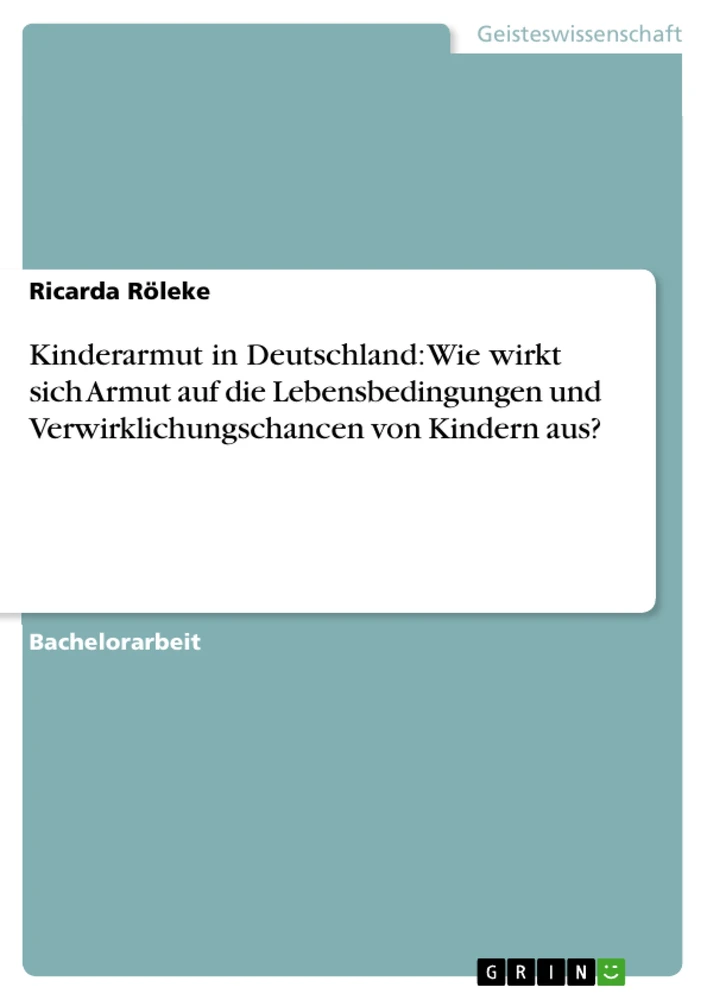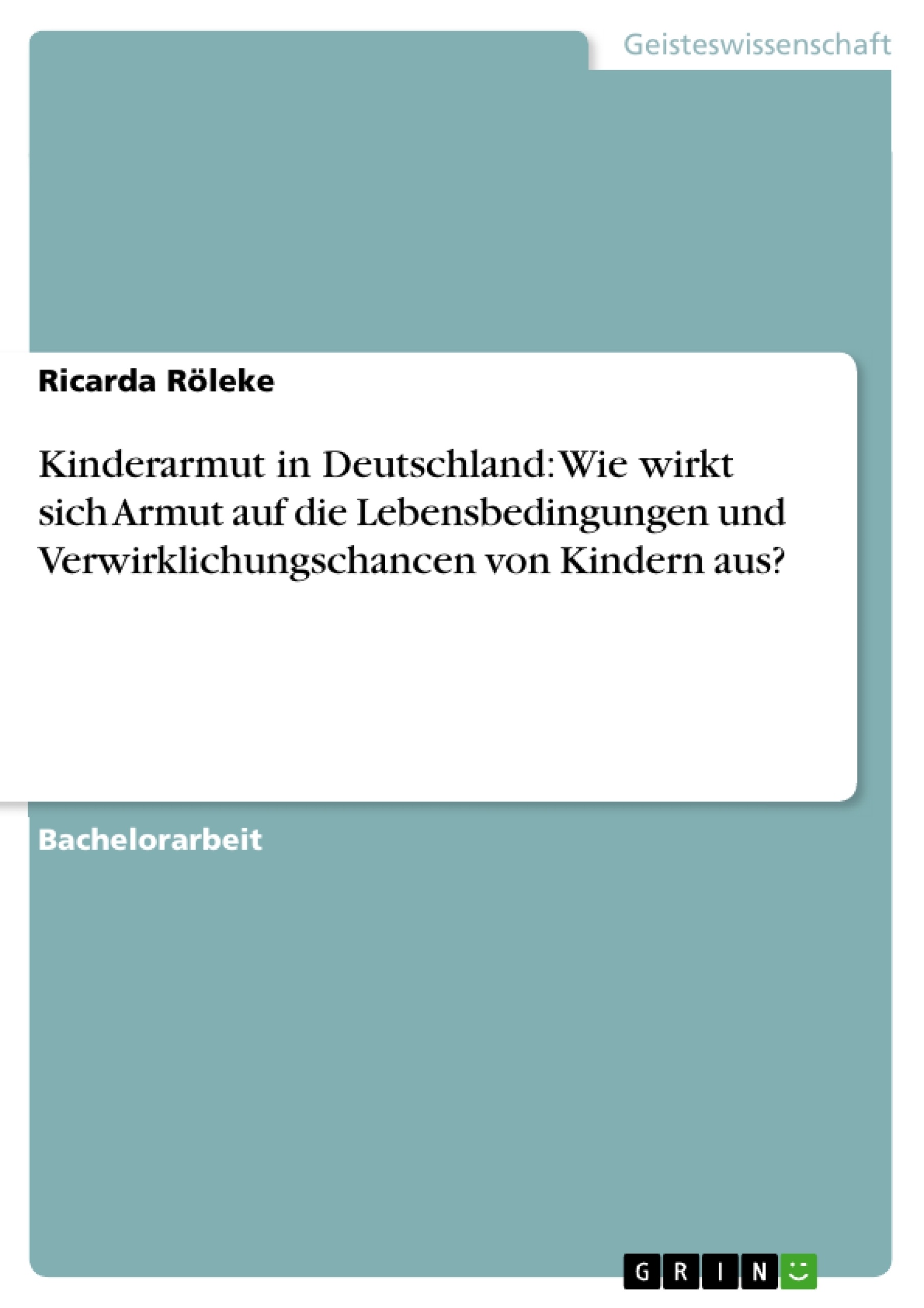Kinderarmut galt in Deutschland lange Zeit als unbedeutendes Randphänomen. Im Zuge des öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurses um Chancengerechtigkeit erschien in den letzten Jahren eine Reihe von Studien, die sich explizit mit der Thematik auseinandersetzen. Diese liefern ein umfassendes Bild der Auswirkungen von Armutslagen auf die Lebensbedingungen und Verwirklichungschancen von Kindern. Unklar bleibt jedoch inwieweit Armut sozial vererbt wird. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, inwieweit Kinderarmut in Deutschland einen reproduktiven Charakter besitzt. Ziel ist es aufzuzeigen, welche individuellen und institutionellen Mechanismen eine Vererbung von Lebenschancen begünstigen. Da die Forschung momentan über keinen allgemein anerkannten Armutsbegriff verfügt (vgl. dazu u.a. Beisenherz 2002, Butterwegge/Klundt/Belke-Zeng 2008, Leßmann 2006), werden zunächst die gängigsten Armutskonzepte erläutert, um dann auf die Besonderheiten der Definition und Messung von Armut bei Kindern einzugehen. Hieran schließt sich eine Erläuterung von Pierre Bourdieus Theorie der Reproduktion sozialer Lagen an. Zur Einführung in die aktuelle Lage folgt dann eine Kurzdarstellung der Situation armer Kinder in Deutschland. Eine ausschließliche Betrachtung der Einkommenssituation reicht hier nicht aus, da es sich bei Armut um ein multidimensionales Phänomen handelt, das in verschiedenste
Lebensbereiche hinein wirkt. Es werden daher die Ausprägungen und Folgen von Unterversorgungen in den zentralen Dimensionen materielle Versorgung, Bildung, Wohnen, Gesundheit, Freizeit und soziale Integration überblicksartig dargestellt. An diese Momentaufnahme der Armutssituation schließt sich in logischer Folge die Betrachtung langfristiger Wirkungsmechanismen an. Unter Rückgriff auf Bourdieus theoretisches Fundament werden hierbei spezifische Habitusformen und Ressourcenverhältnisse aufgezeigt, die eine Reproduktion von Armutslagen befördern könnten. Eine vollkommene Verlagerung der Ursachen von Armutskarrieren auf die individuelle Ebene würde dabei der Realität jedoch nicht gerecht werden. Vielmehr führt erst die Interaktion der Betroffenen mit gesellschaftlichen Institutionen, wie dem Bildungs- oder Sozialsystem, zur Entstehung von Bedingungen,
welche eine Verfestigung multipler Deprivationen hervorrufen können. Abschließend wird Bourdieus Ansatz daher durch empirische Erkenntnisse bezüglich der Einflussnahme staatlicher Sozialpolitik ergänzt.
Inhaltsverzeichnis
- I EINLEITUNG
- II ARMUT.
- II.I RESSOURCENANSATZ..
- II.II LEBENSLAGENANSATZ.
- II.III CAPABILITY-ANSATZ..
- II.IV ARMUT UND ARMUTSMESSUNG BEI KINDERN
- III DIE REPRODUKTION SOZIALER LAGEN NACH PIERRE BOURDIEU
- III.I HABITUS
- III.II KAPITAL
- III.III HABITUS UND KAPITAL IM SOZIALEN RAUM...
- IV KINDERARMUT IN DEUTSCHLAND
- IV.I URSACHEN VON ARMUTSLAGEN BEI KINDERN
- IV.II ARMUT UND LEBENSCHANCEN
- V ZUR REPRODUKTION VON ARMUTSLAGEN IN DEUTSCHLAND ........
- V.I KAPITAL
- V.II HABITUS
- V.III POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN.
- VI ARMUT UND LEBENSCHANCEN – EINE ABSCHLIEBENDE BETRACHTUNG .....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit Kinderarmut in Deutschland als spezifische Reproduktionsform sozialer Lagen nach Pierre Bourdieu verstanden werden kann. Das Ziel ist es, die individuellen und institutionellen Mechanismen aufzuzeigen, die eine Vererbung von Lebenschancen begünstigen.
- Armutskonzepte und deren Anwendung auf Kinderarmut
- Pierre Bourdieus Theorie der Reproduktion sozialer Lagen
- Ursachen und Folgen von Kinderarmut in Deutschland
- Zusammenhang zwischen Kapital, Habitus und der Reproduktion von Armutslagen
- Der Einfluss von staatlicher Sozialpolitik auf die Verfestigung von Armut
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Die Einleitung führt in das Thema der Kinderarmut in Deutschland ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit dar.
- Kapitel II: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Armutskonzepte und erläutert die Besonderheiten der Definition und Messung von Armut bei Kindern.
- Kapitel III: Die zentralen Begriffe Habitus, Kapital und sozialer Raum aus Pierre Bourdieus Theorie der Reproduktion sozialer Lagen werden definiert und in ihren Zusammenhängen dargestellt.
- Kapitel IV: Die Situation armer Kinder in Deutschland wird vorgestellt, wobei die Ausprägungen und Folgen von Unterversorgungen in zentralen Lebensbereichen wie materielle Versorgung, Bildung, Wohnen, Gesundheit, Freizeit und soziale Integration beleuchtet werden.
- Kapitel V: Unter Rückgriff auf Bourdieus Theorie werden spezifische Habitusformen und Ressourcenverhältnisse aufgezeigt, die eine Reproduktion von Armutslagen begünstigen könnten. Die Interaktion von Betroffenen mit gesellschaftlichen Institutionen wie dem Bildungs- oder Sozialsystem wird ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Reproduktion sozialer Lagen, Pierre Bourdieu, Habitus, Kapital, sozialer Raum, Lebenschancen, multidimensionale Armut, Unterversorgung, materielle Versorgung, Bildung, Wohnen, Gesundheit, Freizeit, soziale Integration, staatliche Sozialpolitik.
- Quote paper
- Ricarda Röleke (Author), 2009, Kinderarmut in Deutschland: Wie wirkt sich Armut auf die Lebensbedingungen und Verwirklichungschancen von Kindern aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196283