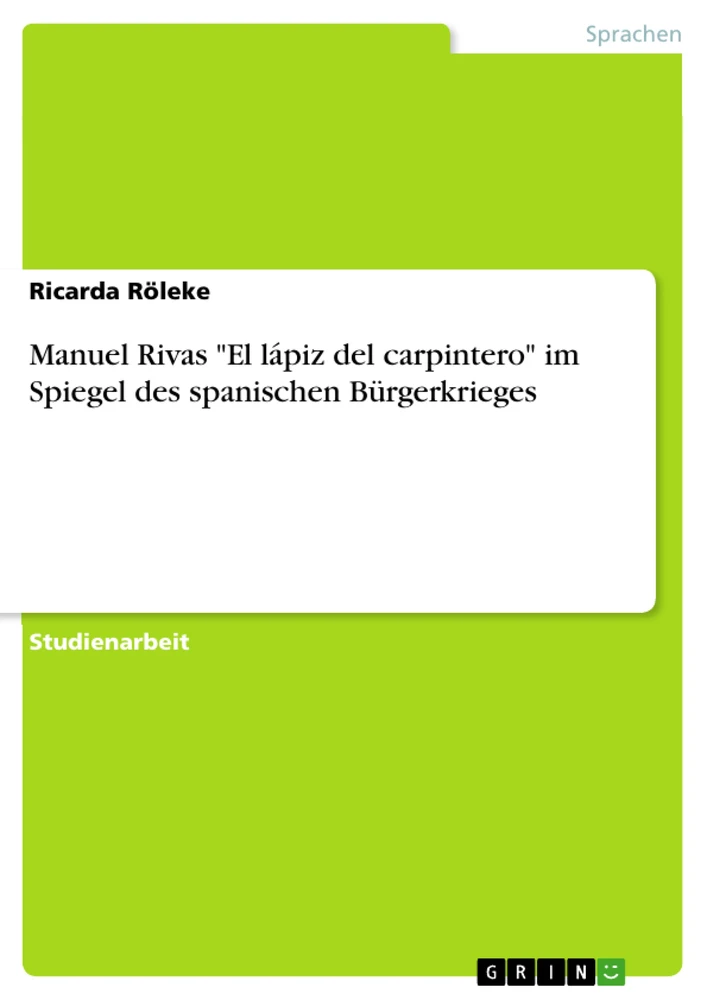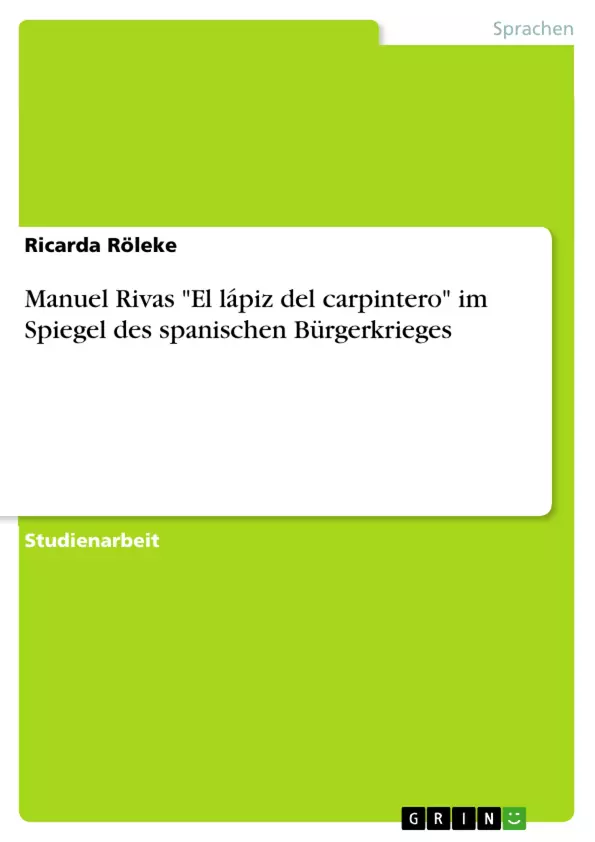Der spanische Bürgerkrieg gehört zu den Angelpunkten der spanischen Geschichte. Er hat nicht nur unauslöschliche Spuren in der Struktur und Gesellschaft des Landes hinterlassen, sondern inspiriert auch die Fachwelt schon seit mehreren Jahrzehnten. Kaum ein anderer Abschnitt der spanischen Geschichte ist von Historikern mit ähnlicher Intensität erforscht worden. Auch der literarischen Welt bieten die Geschehnisse von 1936 bis 1939 ein unerschöpfliches Arsenal von Geschichten für neue Erzählungen. Trotz dieser Flut an Literatur hat sich ein fruchtbarer Prozess der Vergangenheitsbewältigung in Spanien bis heute nicht entwickeln können. Gründe dafür sind sowohl die einseitige Erinnerungspolitik unter Franco, wie auch die Verdrängungspolitik während der Transición. Es ist daher leicht nachzuvollziehen, dass, gerade auf Seite der republikanischen Opfer, das Bedürfnis dem eigenen Schmerz Ausdruck zu verleihen gleichbleibend hoch ist. Heute fehlt es der Politik meist schlicht am nötigen Willen sich neben den Heldentaten des Krieges auch eingehend mit den unangenehmen Seiten der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Erst in den letzten Jahren lassen sich, mit Gesetzentwürfen wie dem Ley de la Memoria, erste zögerliche Schritte hin zu einer umfassenden Aufarbeitung des Geschehenen erkennen. Bleibt ein langfristiges Umdenken in Politik und Bevölkerung jedoch aus, so wird die Erinnerung an den Bürgerkrieg sukzessive mit der Zeitzeugengeneration aussterben und damit für immer verloren gehen. Da das gemeinsame Erinnern nicht zuletzt seit Pierre Nora und seiner Theorie der Lieux de Mémoires einen essenziellen Bestandteil der kollektiven Identität darstellt, würde sich dieser Verlust gravierend auf die gemeinsame Zukunft aller Spanier auswirken. Genau an diesem Punkt setzt Manuel Rivas mit seinem Roman El lápiz del carpintero an. Er stellt in ihm die verschiedenen Möglichkeiten dar, die persönlichen Erinnerungen der Zeitzeugen an folgende Generationen weiterzugeben. Gleichzeitig sucht er jedoch auch einen neuen Zugang zur Bürgerkriegsthematik an sich. Mit dem ehemaligen Gefängniswärter und franquistischen Mitläufer Herbal schafft er ganz bewusst Raum für die persönlichen Erinnerungen der einfachen Leute, um so die vorherrschende historische Meinung zu komplettieren. Die vorliegende Arbeit untersucht, welches Bild Rivas dabei vom Bürgerkrieg zeichnet und welchen Beitrag der Roman dadurch zum Prozess der Vergangenheits-bewältigung in Spanien leisten kann.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Inhaltlicher Abriss
- III Die Darstellung des Bürgerkrieges
- III.I Herbal und Daniel da Barca - Sieger und Besiegter? Täter und Opfer?
- III.II Das Gefängnis als menschenfeindlicher Ort
- III.III Die Rolle der Kirche
- IV El Lápiz del Carpintero im Spiegel des spanischen Vergangenheitsbewältigungsprozesses
- V Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Manuel Rivas' Roman "El lápiz del carpintero" und dessen Beitrag zum spanischen Vergangenheitsbewältigungsprozess. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Bürgerkriegs aus verschiedenen Perspektiven und der Weitergabe von Erinnerungen an nachfolgende Generationen. Die Analyse beleuchtet die literarischen Mittel, die Rivas einsetzt, um die Komplexität des Konflikts und seine anhaltenden Auswirkungen zu verdeutlichen.
- Die Darstellung des Spanischen Bürgerkriegs aus unterschiedlichen Perspektiven (Republikaner und Franquisten).
- Die Rolle der Erinnerung und des Erinnerns im Prozess der Vergangenheitsbewältigung.
- Die Übertragung von Trauma und Erfahrung über Generationen hinweg.
- Der Umgang mit Schuld und Verantwortung im Kontext des Bürgerkriegs.
- Die literarische Gestaltung von Geschichte und Erinnerung.
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung stellt den spanischen Bürgerkrieg als zentralen Punkt der spanischen Geschichte vor und betont die anhaltende Relevanz seiner Erforschung und literarischen Verarbeitung. Sie hebt die unzureichende Vergangenheitsbewältigung in Spanien hervor, die auf die einseitige Erinnerungspolitik unter Franco und den Pacto del Olvido zurückzuführen ist. Der Roman "El lápiz del carpintero" wird als ein Versuch präsentiert, die persönlichen Erinnerungen der Zeitzeugen an nachfolgende Generationen weiterzugeben und einen neuen Zugang zur Bürgerkriegsthematik zu finden. Der Fokus liegt auf der Erforschung des Bildes vom Bürgerkrieg, das Rivas zeichnet, und dem Beitrag des Romans zum Vergangenheitsbewältigungsprozess.
II Inhaltlicher Abriss: Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über die Handlung des Romans. Er beschreibt den Rahmen der Geschichte: ein Journalist, Carlos Sousa, der den sterbenden Republikaner Daniel da Barca interviewt, und eine zweite Handlung, in der der ehemalige franquistische Gefängniswärter Herbal seine Erinnerungen an den Bürgerkrieg und seine Beziehung zu Daniel da Barca teilt. Herbal wird als zentrale Erinnerungsinstanz des Romans vorgestellt, die den Bürgerkrieg aus der Perspektive eines franquistischen Mitläufers beleuchtet. Die Zusammenfassung betont den Versuch eines Generationendialogs in den 90er Jahren, der sowohl die republikanische als auch die franquistische Perspektive umfasst.
III Die Darstellung des Bürgerkrieges: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Bürgerkriegs im Roman aus verschiedenen Perspektiven. Es untersucht die komplexe Beziehung zwischen Herbal und Daniel da Barca, die Sieger und Besiegten, Täter und Opfer darstellt. Die Schilderungen des Gefängnisalltags in Santiago de Compostela zeigen die Brutalität des Regimes und die Solidarität unter den republikanischen Gefangenen. Die Rolle der Kirche als institutionelle Macht wird ebenfalls beleuchtet. Der Abschnitt vereint die verschiedenen Aspekte des Bürgerkriegs – die persönlichen Erfahrungen der Betroffenen, die politischen und gesellschaftlichen Folgen und den Einfluss der Kirche - zu einem umfassenden Bild des Konflikts.
Schlüsselwörter
Spanischer Bürgerkrieg, Erinnerung, Vergangenheitsbewältigung, Generationendialog, Trauma, Republikaner, Franquisten, Identität, El Lápiz del Carpintero, Manuel Rivas, Galizien.
Häufig gestellte Fragen zu "El Lápiz del Carpintero" - Manuel Rivas
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert Manuel Rivas' Roman "El lápiz del carpintero" und dessen Beitrag zum spanischen Vergangenheitsbewältigungsprozess. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Bürgerkriegs aus verschiedenen Perspektiven und der Weitergabe von Erinnerungen an nachfolgende Generationen. Untersucht werden die literarischen Mittel, mit denen Rivas die Komplexität des Konflikts und seine anhaltenden Auswirkungen verdeutlicht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Analyse beleuchtet die Darstellung des spanischen Bürgerkriegs aus unterschiedlichen Perspektiven (Republikaner und Franquisten), die Rolle der Erinnerung und des Erinnerns im Prozess der Vergangenheitsbewältigung, die Übertragung von Trauma und Erfahrung über Generationen, den Umgang mit Schuld und Verantwortung im Kontext des Bürgerkriegs und die literarische Gestaltung von Geschichte und Erinnerung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Die Einleitung stellt den spanischen Bürgerkrieg und die unzureichende Vergangenheitsbewältigung in Spanien vor und führt in den Roman "El lápiz del carpintero" ein. Der inhaltliche Abriss bietet einen Überblick über die Handlung des Romans, mit den beiden zentralen Figuren Carlos Sousa und Herbal. Das Kapitel "Die Darstellung des Bürgerkrieges" analysiert den Konflikt aus verschiedenen Perspektiven, beleuchtet die Beziehung zwischen Herbal und Daniel da Barca, den Gefängnisalltag und die Rolle der Kirche. Kapitel IV, "El Lápiz del Carpintero im Spiegel des spanischen Vergangenheitsbewältigungsprozesses", betrachtet den Roman im Kontext der spanischen Aufarbeitung der Vergangenheit. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen.
Welche Perspektiven werden im Roman und in der Analyse eingenommen?
Der Roman und die Analyse betrachten den spanischen Bürgerkrieg aus den Perspektiven von Republikanern und Franquisten. Besonders wichtig ist die Perspektive des ehemaligen franquistischen Gefängniswärters Herbal, der als zentrale Erinnerungsinstanz fungiert. Die Arbeit untersucht den Generationendialog und den Versuch, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Spanischer Bürgerkrieg, Erinnerung, Vergangenheitsbewältigung, Generationendialog, Trauma, Republikaner, Franquisten, Identität, El Lápiz del Carpintero, Manuel Rivas, Galizien.
Welche Rolle spielt die Kirche im Roman?
Die Rolle der Kirche als institutionelle Macht während des Bürgerkriegs wird im Roman und in der Analyse beleuchtet. Es wird untersucht, welchen Einfluss die Kirche auf die Ereignisse hatte und wie sie in der Erinnerungskultur repräsentiert wird.
Wie wird der Roman "El lápiz del carpintero" im Kontext der spanischen Vergangenheitsbewältigung gesehen?
Die Arbeit analysiert den Roman als Beitrag zum spanischen Vergangenheitsbewältigungsprozess. Sie untersucht, wie Rivas die persönlichen Erinnerungen der Zeitzeugen an nachfolgende Generationen weitergibt und einen neuen Zugang zur Bürgerkriegsthematik findet.
- Quote paper
- MSc Ricarda Röleke (Author), 2008, Manuel Rivas "El lápiz del carpintero" im Spiegel des spanischen Bürgerkrieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196291