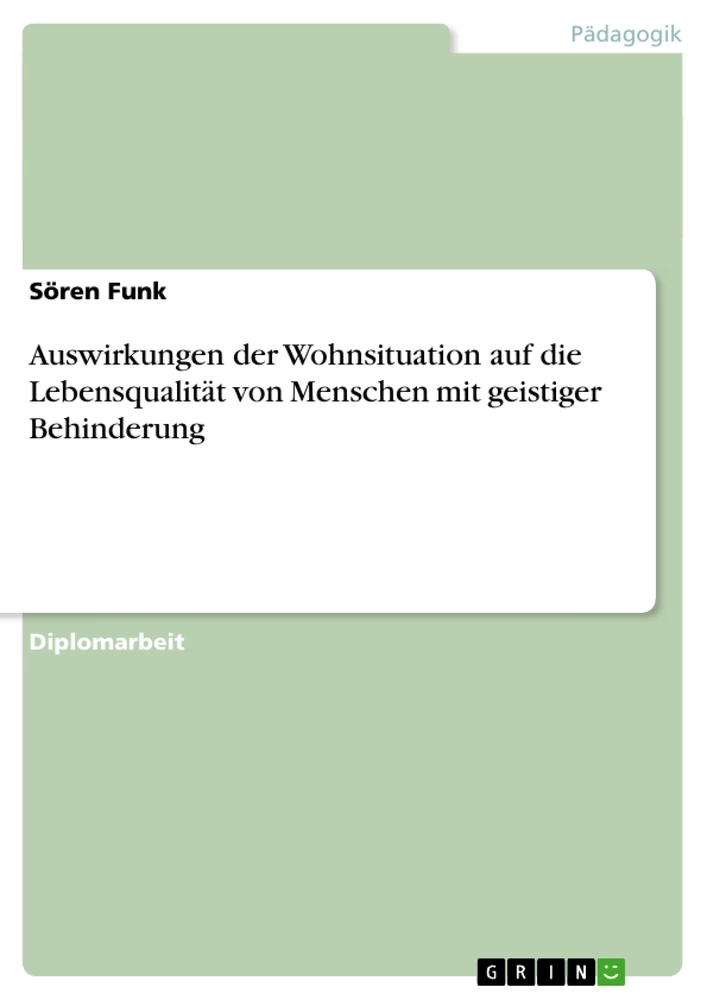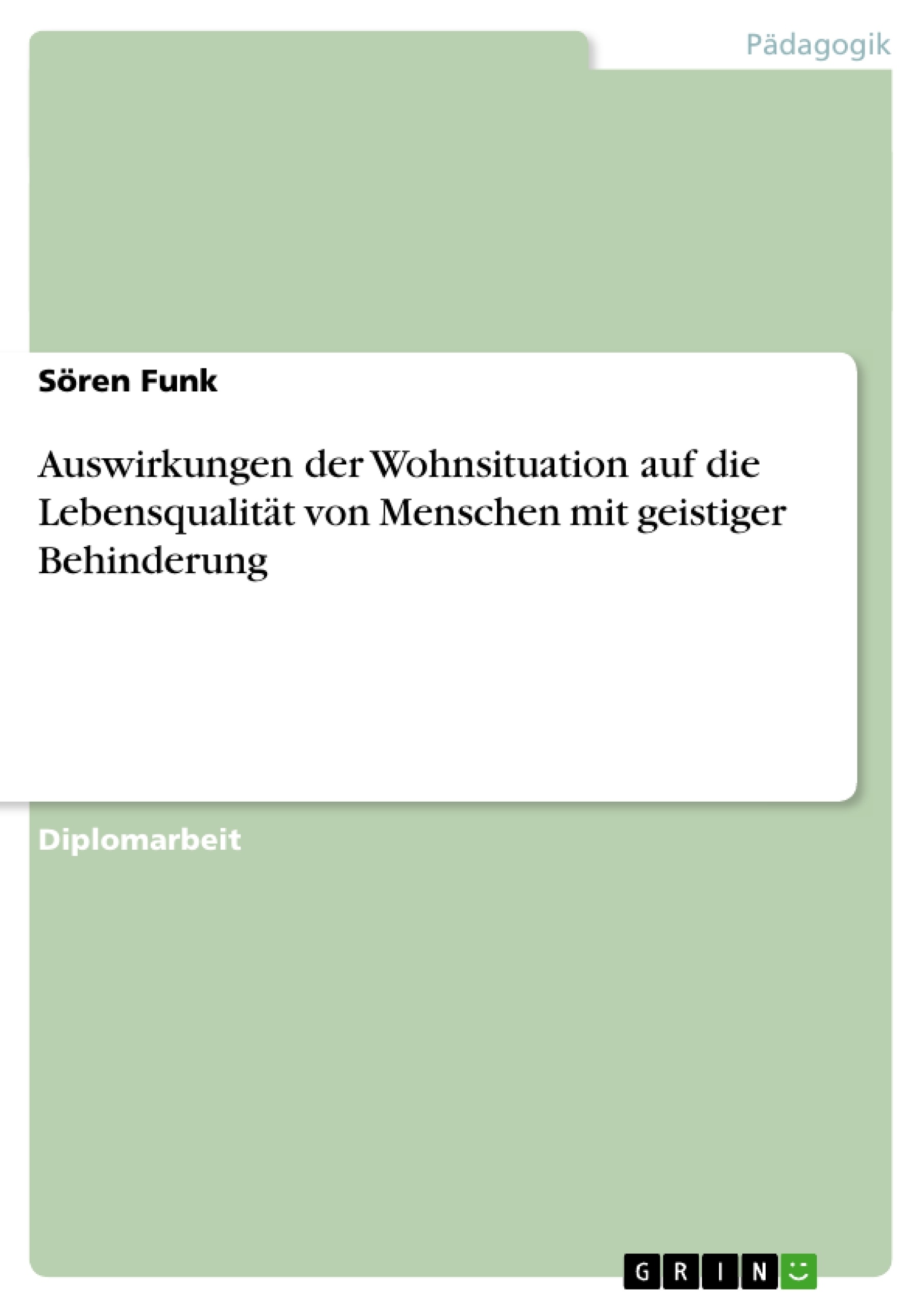Die Wohnsituation von Menschen mit geistiger Behinderung hat sich innerhalb der letzten 100 Jahre kontinuierlich verändert. Wurde die Betreuung bis Mitte des 19. Jahrhunderts ausschließlich von den Familien übernommen, entwickelten sich nach und nach große Behindertenzentren und psychiatrische Anstalten, die diesen Personenkreis aufnahmen. Als Folge des in den 60er Jahren in Skandinavien formulierten und praktizierten Normalisierungsprinzips, entstanden auch in Deutschland kleinere Wohneinrichtungen mit regionalem Bezug. Diese Tendenz fand durch die Integrationsbemühungen von Elterninitiativen in den 80er Jahren ihre Fortsetzung und machte es vor allem für relativ selbständige Bewohner 1 möglich, in gemeindeintegrierte Wohnformen umzuziehen, die mehr Raum für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung boten. Die sonder- bzw. heilpädagogischen Paradigmen Normalisierung, Integration und Selbstbestimmung waren bei der Entwicklung von Diensten und Angeboten im Bereich der Behindertenhilfe über viele Jahre handlungsleitend und haben wesentlich zu einer Humanisierung der Wohnbedingungen beigetragen. Die Verbesserung der Bedingungen brachte für das Leben geistig behinderter Menschen positive Auswirkungen mit sich. Seit Anfang der 90er Jahre hat sich neben den allgemein anerkannten Leitideen eine neue Richtlinie etabliert: das Paradigma der Lebensqualität. In der Diskussion um Entwürfe und Ziele sozialer Dienstleistungen ist der Begriff Lebensqualität mittlerweile von zentraler Bedeutung. Nicht zuletzt durch § 20 des Sozialgesetzbuches IX und die novellierten §§ 93 ff. Bundessozialhilfegesetz wird Lebensqualität im Prozess des Qualitätsmanagements als Zielgröße sonderpädagogischer Hilfe- und Unterstützungsqualität festgelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Bedeutung des Wohnens
- Wohnpsychologie: das ökologische Modell
- Wohnbedürfnisse
- Biologisch-physiologische Bedürfnisse
- Psychische Bedürfnisse
- Soziale Bedürfnisse
- Wohnbedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung
- Geistige Behinderung - Begriffsklärung und Personenkreis
- Semantische Unzulänglichkeit des Begriffs „geistige Behinderung“
- Schwierigkeit der Definition des Personenkreises
- Geistige Behinderung als Stigma
- Medizinischer Ansatz
- Psychologischer Ansatz
- Pädagogischer Ansatz
- Juristischer Ansatz
- Zusammenschau der Ansätze
- Leitideen und Prinzipien des Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung im historischen Wandel
- Anstaltsunterbringung - die Anfänge des institutionalisierten Wohnens
- Diskriminierung und Vernichtung - Sozialdarwinismus im 3. Reich
- Verwahrung in der Psychiatrie
- Enthospitalisierung - die Folgen der Psychiatrie-Enquête
- Normalisierung und Integration
- Entstehung des Normalisierungsprinzips
- Elemente des Normalisierungsprinzips
- Normaler Tagesablauf
- Normaler Wochenablauf
- Normaler Jahresablauf
- Normale Erfahrungen eines Lebenszyklus
- Normaler Respekt
- In einer zweigeschlechtlichen Welt leben
- Normaler Lebensstandard
- Normale Umweltbedingungen
- Integration als Mittel und Ziel von Normalisierung
- Missdeutungen des Normalisierungsprinzips
- Erweiterung des Normalisierungsprinzip durch Wolfensberger
- Aufnahme des Normalisierungsprinzips in Deutschland
- Selbstbestimmung
- Einfluss der Independent-Living-Bewegung
- Entwicklungen in Deutschland
- Personelle Erschwernisse
- Strukturelle Erschwernisse
- Gesetzliche Grundlagen des Selbstbestimmungsrechts
- Selbstbestimmung bei schwerer geistiger Behinderung
- Empowerment
- Zielperspektive Lebensqualität
- Annäherung an das Konstrukt Lebensqualität
- Lebensqualität als Gegenstand der Fachdiskussion
- Objektive Bedingungen und subjektives Wohlbefinden
- Konzepte von Lebensqualität
- Das Konzept von Seifert
- Objektive Prüfkriterien
- Kategorien des Wohlbefindens
- Hilfequalität und Qualitätsstandards
- Qualitätssicherung
- Nutzerkontrolle als wichtiger Bestandteil von Qualitätssicherung
- Verständnis von Lebensqualität in der vorliegenden Arbeit
- Auswirkungen verschiedener Wohnsituationen auf die Lebensqualität: Objektive Rahmenbedingungen und Einschätzung aus der Außenperspektive
- Wohnsituation 1: Wohnen im gruppengegliederten Wohnheim
- Rechtliche Grundlagen
- Beschreibung
- Einschätzung der Lebensqualität
- Wohnsituation 2: Wohnen in einer betreuten Wohngruppe innerhalb des Wohnheims
- Rechtliche Grundlagen
- Beschreibung
- Einschätzung der Lebensqualität
- Wohnsituation 3: Wohnen in einer betreuten Außenwohngruppe
- Rechtliche Grundlagen
- Beschreibung
- Einschätzung der Lebensqualität
- Wohnsituation 4: Ambulant-betreutes Einzelwohnen
- Rechtliche Grundlagen
- Beschreibung
- Einschätzung der Lebensqualität
- Wohnsituation 1: Wohnen im gruppengegliederten Wohnheim
- Qualitative Untersuchung der Lebensqualität in verschiedenen Wohnsituationen: Subjektive Bewertung aus der Nutzerperspektive
- Methodisches Vorgehen
- Untersuchungsinstrument
- Auswahl der Stichprobe
- Datenerhebung
- Aufbereitung und Analyse der Daten
- Auswertung der Interviews
- Zufriedenheit und Wohlbefinden auf der materiellen Ebene
- Zufriedenheit und Wohlbefinden auf der aktivitätsbezogenen Ebene
- Zufriedenheit und Wohlbefinden auf der sozialen Ebene
- Zufriedenheit und Wohlbefinden auf der interaktionalen Ebene
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Bewertung von Wohnsituation 1 durch Herrn M.
- Bewertung von Wohnsituation 2 durch Frau D.
- Bewertung von Wohnsituation 3 durch Herrn K.
- Bewertung von Wohnsituation 4 durch Frau S.
- Evaluation, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- Vorbemerkung
- Vergleich der Ergebnisse mit den Arbeitshypothesen
- Vergleich der außenperspektivischen Einschätzung mit den subjektiven Bewertungen
- Empfehlungen für die Praxis
- Methodisches Vorgehen
- Kritische Würdigung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Wohnsituation auf die Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung. Sie untersucht, wie sich verschiedene Wohnformen auf das subjektive Wohlbefinden und die Lebensqualität der Betroffenen auswirken.
- Der historische Wandel des Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung
- Die Bedeutung von Normalisierung, Integration und Selbstbestimmung für die Lebensqualität
- Das Konzept der Lebensqualität und seine Anwendung auf den Bereich der Behindertenhilfe
- Die Analyse unterschiedlicher Wohnsituationen und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität
- Die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der Lebensqualität durch Menschen mit geistiger Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung der Arbeit erläutert und den historischen Kontext der Wohnsituation von Menschen mit geistiger Behinderung beleuchtet. Anschließend werden die Bedeutung des Wohnens und die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung im Detail behandelt.
Die Kapitel 4 und 5 beleuchten die Entwicklung von Leitideen und Prinzipien des Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung, mit besonderem Fokus auf Normalisierung, Integration und Selbstbestimmung. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Konzept der Lebensqualität und dessen Bedeutung im Kontext der Behindertenhilfe.
In Kapitel 6 werden verschiedene Wohnsituationen analysiert und ihre Auswirkungen auf die Lebensqualität aus objektiver Sicht betrachtet. Kapitel 7 präsentiert eine qualitative Untersuchung, die die subjektiven Bewertungen der Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung in unterschiedlichen Wohnsituationen erfasst.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Lebensqualität, Wohnsituation, Normalisierung, Integration, Selbstbestimmung, Wohnheim, Außenwohngruppe, Ambulant-betreutes Wohnen, Subjektive Bewertung, Qualitative Forschung, Interview
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das Wohnen für Menschen mit Behinderung gewandelt?
Der Wandel vollzog sich von großen psychiatrischen Anstalten hin zu gemeindeintegrierten Wohnformen wie Wohngruppen oder ambulant betreutem Einzelwohnen.
Was ist das 'Normalisierungsprinzip'?
Es besagt, dass Menschen mit Behinderung ein Leben führen sollten, das so weit wie möglich den normalen Lebensbedingungen der Gesellschaft entspricht (Tagesablauf, Lebensstandard etc.).
Welche Wohnformen werden in der Arbeit verglichen?
Verglichen werden das gruppengegliederte Wohnheim, betreute Wohngruppen, Außenwohngruppen und das ambulant-betreute Einzelwohnen.
Wie wird Lebensqualität in diesem Kontext definiert?
Lebensqualität wird als Zusammenspiel von objektiven Rahmenbedingungen (z. B. Wohnraum) und subjektivem Wohlbefinden (Zufriedenheit) verstanden.
Was ist 'Empowerment' in der Behindertenhilfe?
Empowerment zielt darauf ab, Menschen mit Behinderung zu befähigen, ihre eigenen Interessen selbstbestimmt zu vertreten und Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen.
- Citar trabajo
- Sören Funk (Autor), 2002, Auswirkungen der Wohnsituation auf die Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19633