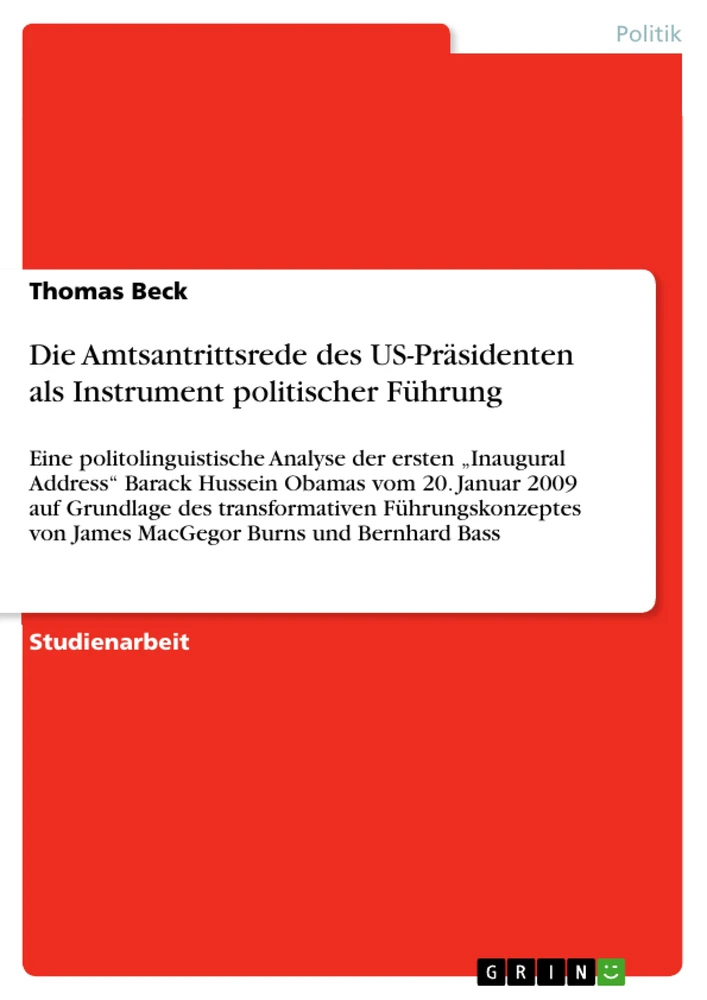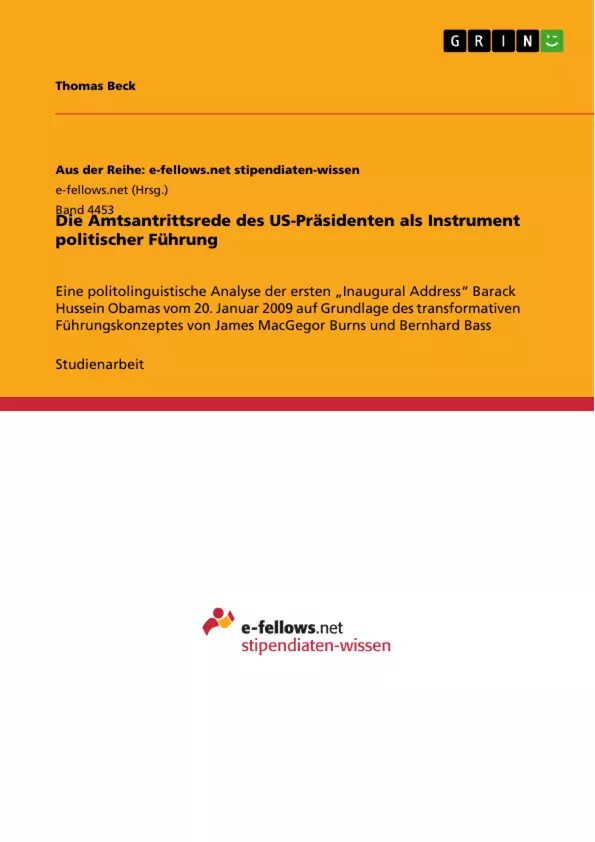Spätestens seit den großen Rednern der Antike gilt die öffentliche politische Artikulation als wichtiges, vielleicht sogar bedeutendstes Herrschafts- und Führungsinstrument. Die politische Rede ist dabei beides zugleich: eine kommunikative Brücke zwischen Rhetor und Rezipienten mit dem bloßen Ziel der Informationsweitergabe als auch persuasives Instrument politischer Steuerung. Der deutsche Publizistikwissenschaftler Emil Dovifat hat die ihr innewohnende instrumentelle Ambivalenz bereits 1937 prägnant mit folgenden Worten umschrieben: „Die Rede ist das schönste und wirksamste Mittel der Volksverführung. Oft missbraucht, ebensooft mißbildet, falsch angewandt und fehlgeformt, hat sie seit jeher viel Spott ertragen müssen. [...] Und doch ist sie und bleibt sie die stärkste Kraft, Glauben zu wecken, Überzeugungen zu erhärten, Niedergehendes zu erschlagen, Aufgehendes hochzubringen und die Massen aus alten Denkpfaden herüberzureißen in die Straßen neuer Hoffnungen.“
Beflügelt von der Hoffnungshysterie seiner Anhängerschaft und scheinbar getragen vom Geist der Geschichte nutze auch Barack Obama seine politische Rhetorik wiederholt um seinen Führungsanspruch zu untermauern. Gerade seine erste Amtsantrittsrede vom 20 Januar 2009 war es, die in diesem Kontext einen bedeutsamen Grundstein legte. In nur 18 Minuten gelang es dem nunmehr 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten die Herzen seiner Landsleute und der Weltbevölkerung zu öffnen und das deformierte Selbstbewusstsein der zutiefst zerrütteten Nation für eine Weile wieder neu aufzurichten. Mit seinen beiden Kernbotschaften „Hope“ und „Change“ versprach er die Krise zu meistern und die USA unter seiner Egide wieder zu neuer Stärke zu führen - Deutlicher und reichweitenstärker hätte ein amerikanischer Präsident seine Befähigung zur Führung des Landes nicht artikulieren können.
Es mag deshalb nicht verwundern, dass gerade im interdisziplinären Forschungsbereich der Politolinguistik ein besonderes Interesse auf der enormen Bedeutung eben dieser einzigartigen amerikanischen Redegattung im Zusammenhang mit dem politischen Führungsanspruch des US-Präsidentenamtes liegt. In meiner Hausarbeit möchte ich mich deshalb zunächst darum bemühen den Begriff der politischen Führung und dessen zentrale Aspekte näherungsweise zu definieren und anschließend auf die Bedeutung und Funktionen der Amtsantrittsrede in diesem Zusammenhang eingehen. Auf der theoretischen Grundlage des Konzeptes der transformativen Führung sollen im
Inhaltsverzeichnis
- PROLOG.
- PRÄSIDENTIELLER FÜHRUNGSANSPRUCH UND RHETORISCHE WIRKUNGSMACHT.
- BEGRIFF, ASPEKTE UND FUNKTIONEN DER POLITISCHEN FÜHRUNG
- SYSTEMISCH BEGRÜNDETE FÜHRUNGSAFFINITÄT PRÄSIDENTIELLER ANTRITTSRHETORIK
- DAS KONZEPT DER TRANSFORMATIVEN FÜHRUNG......
- NEW LEADERSHIP APPROACH ALS PARADIGMENWECHSEL IN DER FÜHRUNGSFORSCHUNG.
- TRANSFORMATIVE, TRANSFORMATIONALE, TRANSAKTIONALE UND CHARISMATISCHE FÜHRUNG.
- VIER I'S ALS SÄULEN DES TRANSFORMATIONALEN FÜHRUNGSSTILS
- FÜHRUNGSBEGÜNSTIGENDE KONTEXTFAKTOREN.
- ELEMENTE UND INSTRUMENTE POLITISCHER FÜHRUNG IN DER AMTSANTRITTSREDE
- KRITERIUM DER IDEALICED INFLUENCE
- KRITERIUM DER INSPIRED MOTIVATION
- KRITERIUM DER INTELLECTUAL STIMULATION
- KRITERIUM DER INDIVIDUAL CONSIDERATION.
- EPILOG.............
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die erste Amtsantrittsrede Barack Obamas im Lichte des transformativen Führungskonzeptes von James MacGregor Burns und Bernhard Bass. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern Obamas Rede als Instrument politischer Führung wirkte und welche sprachlichen Elemente und rhetorischen Mittel zum Einsatz kamen, um die Herzen der Bürger und der Weltbevölkerung zu gewinnen.
- Begriff und Funktion der politischen Führung
- Die Bedeutung der Amtsantrittsrede als Mittel politischer Führung
- Das Konzept der transformativen Führung nach Burns und Bass
- Analyse der sprachlichen Elemente und rhetorischen Mittel in Obamas Rede
- Bedeutung des Kontextes und der performativen Dimension der Rede
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine allgemeine Einführung in die Bedeutung der politischen Rede als Führungsinstrument. Hier wird insbesondere auf die instrumentelle Ambivalenz der Rede eingegangen, die sowohl zur Informationsweitergabe als auch zur politischen Steuerung dienen kann. Die Arbeit zeigt, wie Barack Obama seine rhetorischen Fähigkeiten nutzte, um seinen Führungsanspruch zu untermauern, insbesondere in seiner ersten Amtsantrittsrede.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Begriff der politischen Führung, wobei sowohl sozialpsychologische Definitionen als auch die Bedeutung von Führung in einem politischen Kontext beleuchtet werden. Es wird deutlich, dass Führung in einer sozialen Beziehung stattfindet und zielorientiert ist. Außerdem wird die Rolle des Führers als „soziales Agens“ und die Bedeutung der Führungsbeziehung, die durch eine soziale Asymmetrie gekennzeichnet ist, analysiert.
Im dritten Kapitel wird das Konzept der transformativen Führung ausführlich behandelt. Der „New Leadership Approach“ wird als Paradigmenwechsel in der Führungsforschung vorgestellt, und die verschiedenen Arten der transformativen Führung werden abgegrenzt, darunter transformative, transformationale, transaktionale und charismatische Führung. Zudem werden die vier Säulen des transformationalen Führungsstils nach Bass und Avolio vorgestellt, die als zentrale Elemente des Führungsprozesses dienen.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der Elemente und Instrumente der politischen Führung in der Amtsantrittsrede Obamas. Die vier Säulen des transformationalen Führungsstils werden als Kriterien herangezogen, um die Rede auf ihre Wirkungskraft und ihre Fähigkeit zu analysieren, die Zuhörer zu inspirieren und zu motivieren.
Schlüsselwörter
Politische Führung, Rhetorik, Amtsantrittsrede, transformativer Führungsstil, Barack Obama, Idealiced Influence, Inspired Motivation, Intellectual Stimulation, Individual Consideration, persuasive Kommunikation, politische Steuerung, rhetorische Wirkungskraft, amerikanische Politik
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet Barack Obamas erste Amtsantrittsrede aus?
Sie nutzte die Kernbotschaften „Hope“ und „Change“, um ein zerrüttetes Nationalgefühl wieder aufzurichten und Obamas Führungsanspruch rhetorisch zu untermauern.
Was ist das Konzept der transformativen Führung?
Transformative Führung setzt darauf, die Werte und Ziele der Geführten zu verändern und sie durch Visionen und Inspiration zu motivieren, anstatt nur Belohnungen auszutauschen.
Welche Rolle spielt Rhetorik als Führungsinstrument?
Die politische Rede dient als kommunikative Brücke, um Glauben zu wecken, Überzeugungen zu härten und Massen für neue politische Ziele zu gewinnen.
Was sind die „Vier I's“ des transformationalen Führungsstils?
Dazu gehören Idealized Influence (Vorbildfunktion), Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation und Individual Consideration (individuelle Beachtung).
Wie hängen Kontext und Führungserfolg zusammen?
Besondere Krisenzeiten oder gesellschaftliche Umbrüche bieten einen begünstigenden Kontext, in dem charismatische und transformative Redner besonders wirkmächtig sein können.
- Quote paper
- Thomas Beck (Author), 2011, Die Amtsantrittsrede des US-Präsidenten als Instrument politischer Führung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196353