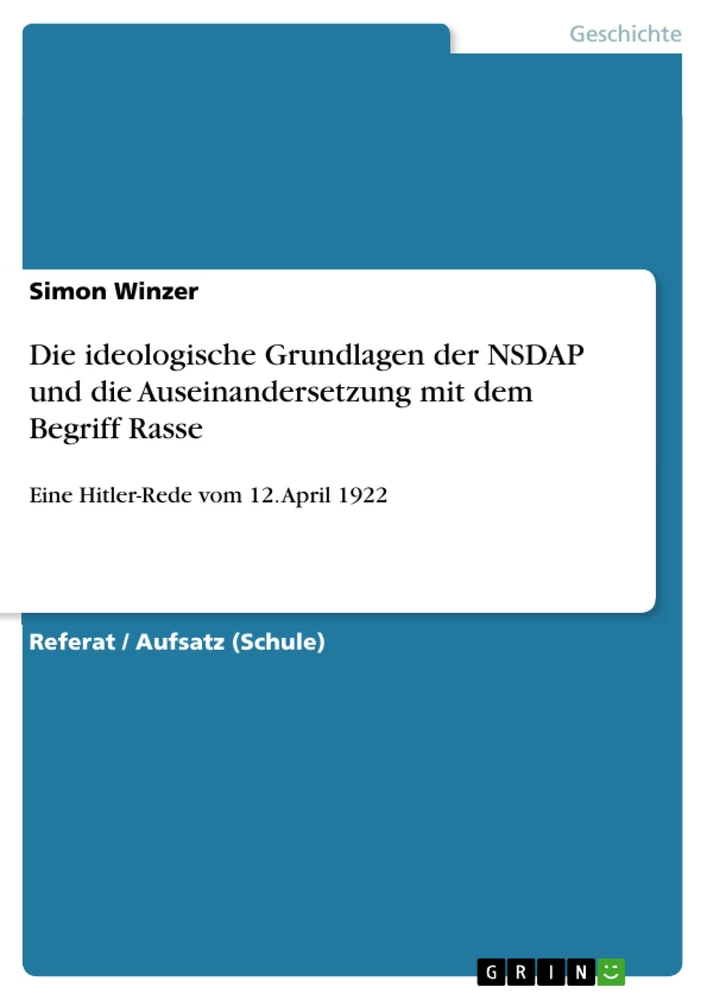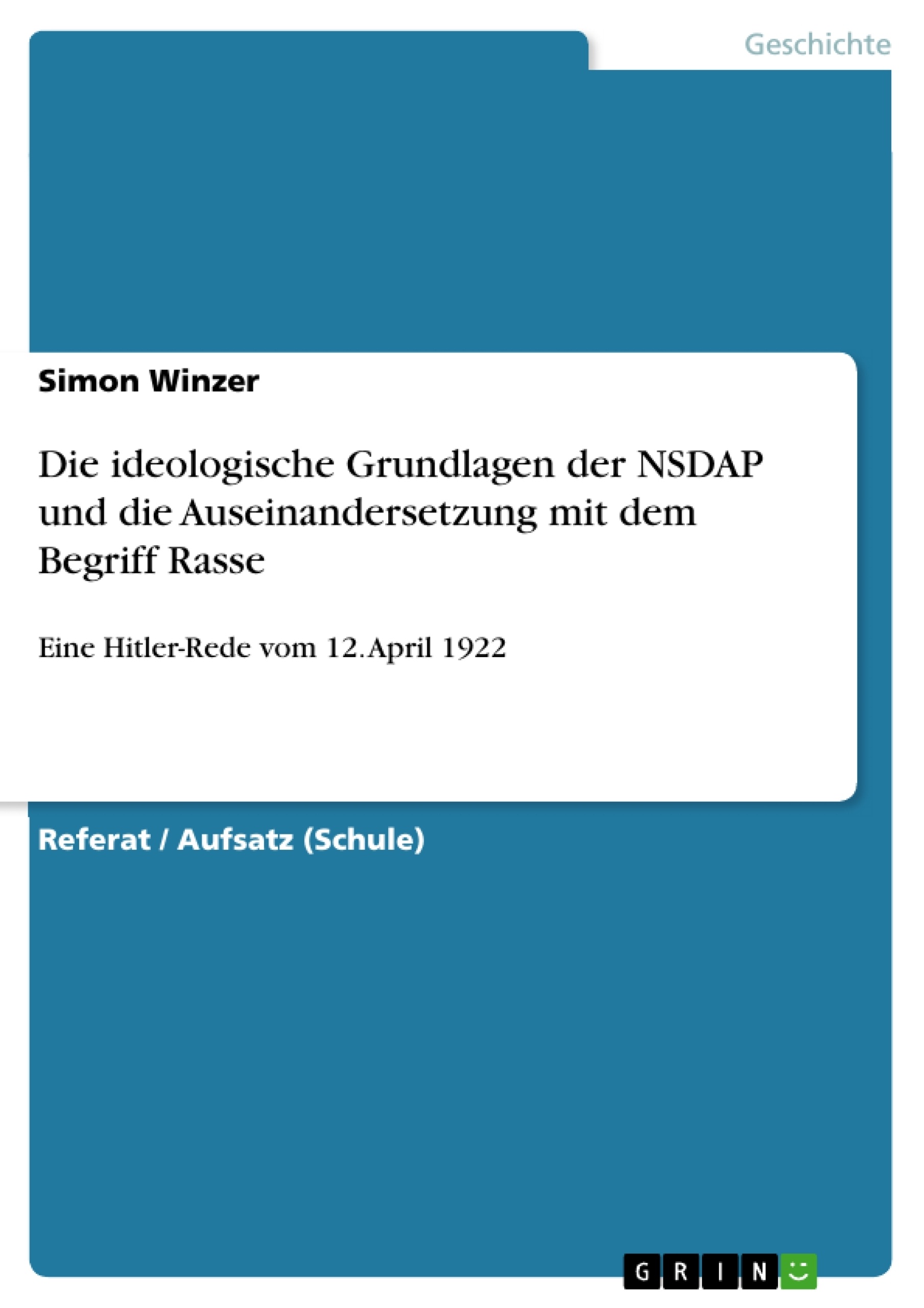Diese Arbeit handelt von den ideologischen Grundlagen der NSDAP, die Adolf Hitler in
einer Rede am 12. April 1922 auf einem Parteitag in München seinen Anhängern
präsentierte. Zunächst kommt es zu einer Analyse der Quelle, später charakterisiert der
Text die nationalsozialistische Ideologie und setzt sich kritisch mit dem Begriff „Rasse
auseinander.
Einleitung
Diese Arbeit handelt von den ideologischen Grundlagen der NSDAP, die Adolf Hitler in einer Rede am 12. April 1922 auf einem Parteitag in München seinen Anhängern präsentierte. Zunächst kommt es zu einer Analyse der Quelle, später charakterisiert der Text die nationalsozialistische Ideologie und setzt sich kritisch mit dem Begriff „Rasse auseinander.
Literaturverzeichnis
Eberhard Klöss: Reden des Führers. Politik und Propaganda Adolf Hitlers 1922 - 1945, München 1967, S. 39-41
Die nationalsozialistischen Grundlagen der NSDAP
Bei der vorliegenden Primärquelle „Allgemeine ideologische Grundlagen der NSDAP: Hitler-Rede vom 12. April 1922“, zusammengefasst durch Eberhard Klöss im Jahr 1967, handelt es sich um eine politische Rede Adolf Hitlers. Dieser wurde am 20. April 1889 geboren und kämpfte im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Reich mit. Mehrfach abgelehnt von verschiedenen Kunstakademien, entwickelte er eine nationalsozialistische Ideologie und gründete die NSDAP.
Ort der Rede ist München, wo er sie am 22. April 1922 auf einem Parteitag der NSDAP hielt. Zweifelsfrei handelt es sich hierbei um einen Vortrag der politischen Gattung, der die ideologische Haltung der NSDAP zum Thema hat.
Da Hitler vor einer Partei auftrat, wird der Adressat auch die NSDAP beziehungsweise die Mitglieder dieser Partei gewesen sein. Weil die Organisation Hitlers 1922 kaum bekannt war, ist der Adressatenkreis wohl nicht die breite Bevölkerungsschicht.
Auch wenn das Hauptthema der Rede die Ideologie der NSDAP ist, hat Hitler der Rede bereits in mehrere Abschnitte eingeteilt.
Im ersten Abschnitt leitet Hitler seiner Präsentation der Ideologie ein. Er sehe einen Wettkampf zwischen Ariern und Juden, bei dem man den Juden zuvor kommen müsse. Diese Erkenntnis sei die Grundlage der noch jungen Bewegung, der er Erfolge zutraue (vgl. Z. 1-5).
Im zweiten Teil erklärt der spätere Diktator die Begriffe „'national' und 'sozial'“ (Z. 6) und behauptet, der Jude stelle diese adäquaten Begriffe gegensätzlich dar (vgl. Z. 6-9). Nationalsozialismus in einem Wort bedeute, für sein Volk zu handeln und hierfür auch zu sterben (vgl. Z. 10-16). Des Weiteren befasst sich Hitler im dritten Abschnitt mit Klassen. Diese könne man mit Kasten vergleichen, die der Rasse gleichkämen. Allerdings sei dieses System in Deutschland nicht umsetzbar, da in der Weimarer Republik alle Leute gleich seien, was in Ländern wie Ägypten oder Indien nicht der Fall gewesen sei.
Jedoch müsse es berufliche Stände geben, die gemeinsam für einen Ausgleich der Wirtschaft, aber nicht gegeneinander kämpfen sollen (vgl. Z. 18-29).
Im folgenden Abschnitt kommt Hitler auf seine Definition von Arbeit zu sprechen. So gebe es einen Unterschied zwischen arbeitenden und nicht arbeitenden Leuten, wobei die erstgenannten das „Edelvolk“ (Z. 35) seien. Die Arbeit solle nach Möglichkeit ein Gemeinwohl bilden und dass Rassen verschiedene Tendenzen nach außen zeigten (vgl. Z. 30-43). Schließlich schimpft Hitler, aufbauend auf die Tendenzen der verschiedenen Rassen, wieder auf die jüdische Bevölkerung. Demnach beute ein Jude andere Völker aus und sei nicht in der Lage, ein gemeinschaftliches Gefühl zu entwickeln. Zudem sei ihm dieses Verhalten von der Natur aufgetragen worden und er könne das nicht ablegen (vgl. Z. 44-51).
Zum Schluss der Rede beschäftigt sich Adolf Hitler mit der Frage der Macht. Demnach müsse ein Nationalsozialist gleichzeitig ein bekennender Nationalist sein um Macht bilden zu können. Hierfür bedürfe es laut Hitler Kraft, mit der man in Kombination mit starken Willen auch mit wenigen Menschen etwas bewegen könne (vgl. Z. 58-65). Schlussendlich schließt Hitler mit den Worten ab, dass man neben der Wahrheit auch einen starken Willen benötige, um diese Wahrheit zu verbreiten (vgl. Z. 66 ff.).
In der Rede lässt sich eindeutig die Position Hitlers als Antisemit erkennen, was sich inhaltlich, als auch stilistisch belegen lässt. So benutzt Hitler einige Antithesen, so auch sein erster Satz.
„Entweder Sieg der arischen Seite oder ihre Vernichtung und Sieg des Juden.“ (Z. 1). Durch diese Antithese versucht Hitler zu verdeutlichen, dass sich die christliche Bevölkerung und die Juden im Allgemeinen gegenüberstehen. Damit möchte er sie absondern und bei den Mitgliedern der NSDAP Hass auf sie schüren. Zudem finden auch Wortwiederholungen häufig Gebraucht in der Rede von Hitler. „[...] gleiches Blut […] gleiche Augen […], gleiche Sprache“ (Z. 21 f.) Durch das Adjektiv „gleiche“ möchte Hitler die Gemeinsamkeiten der in seinen Augen deutschen Bevölkerung hervorheben, schließt gleichzeitig auch wieder Menschen anderer Herkunft aus. Gleichzeitig unterdrückt er aber auch wieder Personen, indem er sehr häufig Wiederholungen der Wörter „Rasse“ oder „Gemeinschaft“ verwendet, denn damit drückt er aus, dass die jüdische Bevölkerung in seinem Gefühl von Gemeinschaft keinen Platz findet.
Des Weiteren benutzt Hitler aber auch Metaphern, wie die „blutigernste Erkenntnis“ (Z. 2), die den eröffneten Kampf zwischen Christen und Juden verdeutlichen soll. So lässt sich ohne Zweifel belegen, dass Adolf Hitler eine antisemitische Position vertritt.
Nun charakterisiere ich unter Einbezug des historischen Kontextes die Ideologie der Nationalsozialisten.
Die Rede Hitlers stammt aus dem Jahr 1922. In dieser Zeit befand sich die NSDAP in den Anfängen und hielt sich überwiegend im bayrischen Raum auf. In der damaligen Zeit, das Kaiserreich war gerade erst seit vier Jahren besiegt und der Kaiser abgedankt, gab es zahlreiche politische Strömungen. Zum einen wurden 1919 zwei Republiken ausgerufen. Einmal von Philipp Scheidemann, einem Sozialdemokraten, eine demokratische Republik, als auch von sozialistischen Vertreter eine kommunistische Räterepublik. Es gab zahlreiche Duelle zwischen den ganz vielen verschiedenen Parteien und jede Partei wollte der Weimarer Republik das richtige. Aber auch der Kapp-Lüdwitz-Putsch scheiterte zu Beginn der 1920er-Jahre und es gab ein „Hin-und-Her“ zwischen den Soldaten. Ein anderer Knackpunkt war der Versailler- Vertrag und die Revisionspolitik von Stresemann. Verschiedenen Verträge und die Besetzung des Rheinlandes verschlechterten die Situation in der jungen Republik, der ersten auf deutschem Boden.
Die Nationalsozialisten verstanden sich als sozial und national und gaben an, antiparlamentarisch, antiliberal, antikommunistisch, antikapitalistisch und antisemitisch zu sein.
„Er [der Jude] arbeite unproduktiv als Benützer und Genießer anderer Leute Arbeit“ (Z. 46 f.).
Im Laufe des Mittelalters war es so, dass immer jüdische Personen die Schuld an Katastrophen erhielten. Zudem wurde ihnen untersagt, körperliche Berufe auszuüben, sodass nur noch der Handel und der Geldverleih über blieben, der dem Christen religiös untersagt war.
Das gleiche Problem gab es nun auch in Weimar, weil es der Wirtschaft aufgrund der Kriegsniederlage und der Inflation im April alles andere als gut ging. Die Nationalsozialisten schoben dieses Problem den Juden in die Schuhe, wie es im Mittelalter auch schon passierte und unterstellten ihnen jetzt, sie hätten nie ehrenhaft gearbeitet, obwohl sie im Mittelalter nicht anders konnten.
„Bei uns aber in Deutschland, […] da kann es keine Klassen geben“ (Z. 21 ff.).
Das Zeil der Nationalisten war es, eine klassenlose Gesellschaft zu erschaffen, bei der jeder arbeitenden deutsche Bürger gleichberechtigt ist. Durch die Unterteilung Hitlers zwischen Ureinwohnern und Ariern in Indien scheint dieser keine Juden und Minderheiten mehr in Deutschland einzuplanen und denkt an ein Deutschland nur für Deutsche, so wie es auch sein ideologischer Standpunkt ist.
Außerdem fällt einem beim Lesen auf, dass bei Berufsbezeichnungen und anderen Titeln, bei denen es männliche und weibliche Formen gibt, nur die männliche Form Verwendung findet. Das ist auf den ideologischen Standpunkt der Nationalsozialisten zurückzuführen, dass die Frau einzig und alleine zum Gebären von „reinrassigen Ariern“ zuständig ist, um neue deutsche Kinder zum Einsatz für den Nationalsozialismus großzuziehen.
Doch auch auf die Kommunisten, einen politischen Feind Hitlers, nimmt dieser Bezug. „Den Juden erst ist es gelungen, durch die Umfälschung des sozialen Gedanken zum Marxismus [...]“ (Z. 6 f.).
Auch der Marxismus/Kommunismus fand in Deutschland erst nach dem Sturz des Kaisertums Einzug, obwohl ein paar Mitglieder der SPD im 19. Jahrhundert bereits auf den Marxismus abzielten und sich darauf beriefen. Im Gegenzug zu Sozialdemokratie riefen die Kommunisten 1918 allerdings eine Räterepublik aus. Seit jeher standen sich Nationalisten und Kommunisten feindlich gegenüber. Jetzt beschuldigt Hitler die Juden, Freunde des Marxismus zu sein, was Antisemitismus und Antikommunismus beweist. „Ist endlich eine Wahrheit erkannt, dann ist sie doch so lange wertlos, solange nicht der unbändige Wille dazu kommt, diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen.“ (Z. 66 ff.).
[...]
- Citation du texte
- Simon Winzer (Auteur), 2011, Die ideologische Grundlagen der NSDAP und die Auseinandersetzung mit dem Begriff Rasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196392