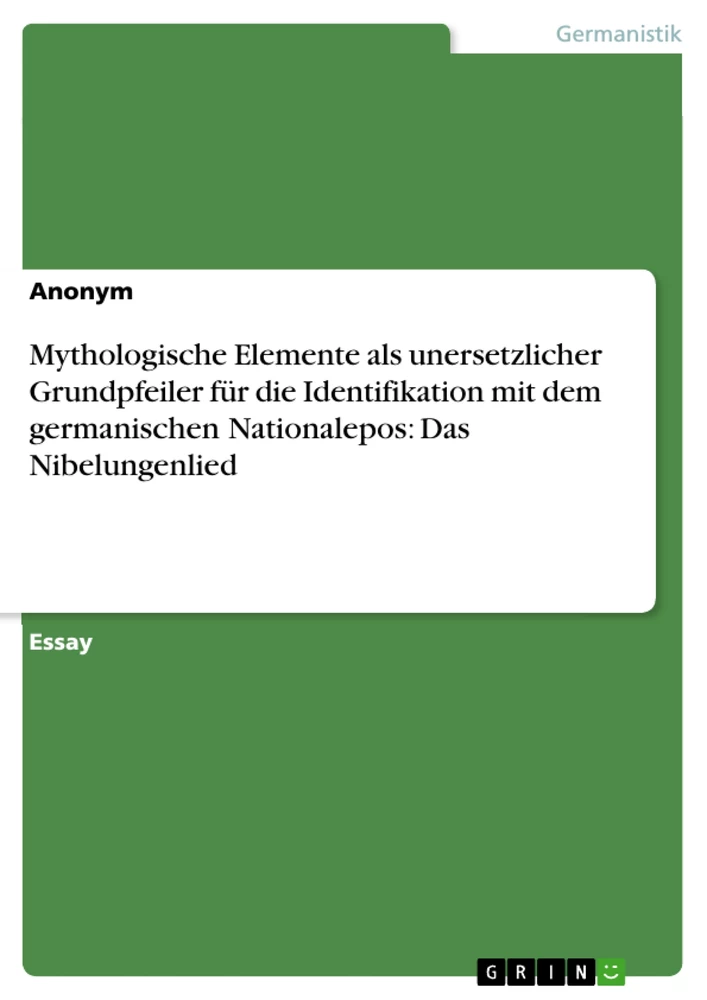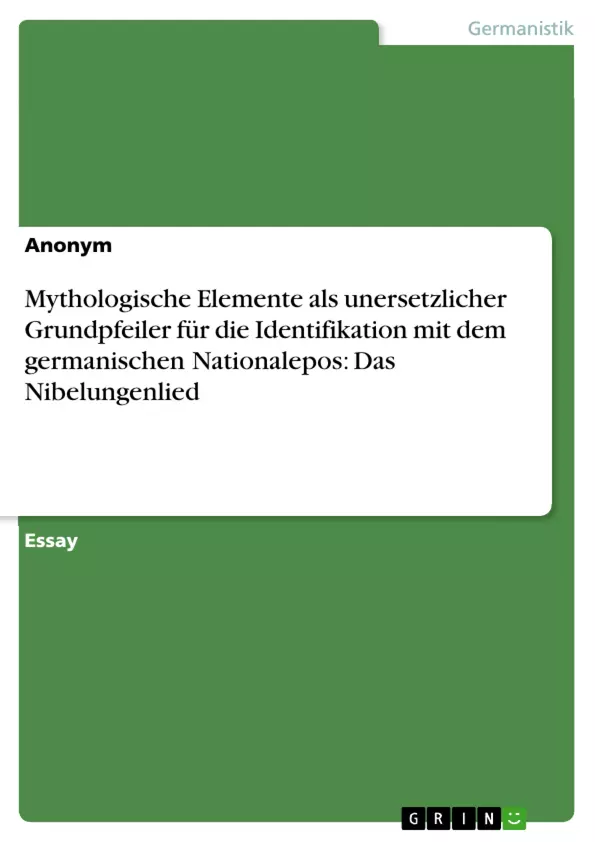Es handelt sich bei dem Nibelungenlied um das umstrittene Nationalepos der
Deutschen, was den Anschein einer starken Identifikation mit einem Volk und somit
auch einen Teil dessen Kulturgeschichte suggeriert.
Das Heldenepos wurde zunächst mündlich überliefert und um ca. 1200 von einem
unbekannten Autor schriftlich fixiert.
Über 35 nachweisbare Handschriften und Handschriftfragmente erzählen die Geschichte
Kriemhilds, wobei zunächst ihre erste Ehe mit Siegfried und dessen Tod und
anschließend ihre Rache im Mittelpunkt stehen.
Historisch lassen sich einige Anknüpfungspunkte, wie beispielsweise der Untergang des
Burgundenreiches durch den Heermeister Aetius bei Worms, belegen.
Doch neben der historischen Basis zieren viele Ausschmückungen und fantastische
Elemente dieses alte Werk, die folgend thematisiert werden sollen.
Der Schwerpunkt dieses Essays wird auf dem ersten Teil des Nibelungenliedes bis hin
zu Siegfrieds Tod liegen und sich hauptsächlich mit den mythologischen Elementen,
deren Definition und Analyse, in Hinblick auf mögliche Identifikationsmuster,
beziehen. Warum lassen diese fantastischen Elemente eine Identifikation überhaupt zu
und warum machen sie diese Geschichte so reizvoll?
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Analyse der mythologischen Elemente
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Es handelt sich bei dem Nibelungenlied um das umstrittene Nationalepos der Deutschen, was den Anschein einer starken Identifikation mit einem Volk und somit auch einen Teil dessen Kulturgeschichte suggeriert.
Das Heldenepos wurde zunächst mündlich überliefert und um ca. 1200 von einem unbekannten Autor schriftlich fixiert.
Über 35 nachweisbare Handschriften und Handschriftfragmente erzählen die Geschichte Kriemhilds, wobei zunächst ihre erste Ehe mit Siegfried und dessen Tod und anschließend ihre Rache im Mittelpunkt stehen.
Historisch lassen sich einige Anknüpfungspunkte, wie beispielsweise der Untergang des Burgundenreiches durch den Heermeister Aetius bei Worms, belegen. Doch neben der historischen Basis zieren viele Ausschmückungen und fantastische Elemente dieses alte Werk, die folgend thematisiert werden sollen. Der Schwerpunkt dieses Essays wird auf dem ersten Teil des Nibelungenliedes bis hin zu Siegfrieds Tod liegen und sich hauptsächlich mit den mythologischen Elementen, deren Definition und Analyse, in Hinblick auf mögliche Identifikationsmuster, beziehen. Warum lassen diese fantastischen Elemente eine Identifikation überhaupt zu und warum machen sie diese Geschichte so reizvoll?
Analyse der mythologischen Elemente
Das Nibelungenlied bietet eine große Anzahl an mythologischen Elementen, weshalb hier lediglich einige exemplarisch herausgegriffene Aspekte eine Stichprobe bieten sollen.
Zunächst wäre das Schwert, namens Balmung, zu erwähnen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten1
Waffen, die mit Namen versehen sind, weisen oft eine starke Verbundenheit zu ihrem Träger auf und gelangen oft auf schicksalhafte Weise an ihre Besitzer. Prüfungen, bei denen sich der Held als würdig erweisen muss und die Bedeutung des namenhaften Gegenstands gesteigert wird, erscheinen hierbei unumgänglich.
In der dritten Aventiure des Nibelungenlieds erhält Siegfried u.a. durch Balmung übermenschliche Kräfte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Kampfkraft, die fernab der Realität liegt oder einfach übertrieben ausgeschmückt, lässt Siegfried als besonders großen Kämpfer erstrahlen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es weckt Interesse und Bewunderung bei dem Leser oder andernfalls kritisches Hinterfragen.
Das mythologische Element der Tarnkappe, welches mehrfach einfließt, ermöglicht neue Spannungsbögen und sichert die Aufmerksamkeit des Lesers. Die Tarnkappe des Alberichs gibt durch ein fantastisches Element Denkanstöße für Situationen, die in der realen Welt liegen.
Auch Wesen, wie den hier auftauchenden Zwergenkönig Alberich, tragen ihren Teil zu der Geschichte bei. Andersartige Wesen wecken seit jeher Interesse und gelegentlich auch Angst bei den Menschen. Interesse, als herbeigesehnte Alternative zur Realität und Neuentdeckung der Welt sowohl Angst als Scheu vor dem Unbekannten, einer möglichen Gefahr. Ein Zwerg könnte hier metaphorisch gesprochen natürlich auch einfach nur für einen kleinwüchsigen Menschen stehen, was zur damaligen Zeit nicht unüblich war.
Ein weiteres mythisches Wesen bildet der Drache. Ein gefürchtetes Ungeheuer von immenser Größe, in dessen Blut Siegfried, mit dem Beinamen Drachentöter, gebadet haben und so zur Unverwundbarkeit gelangt sein soll. Was kann mehr Bewunderung und Ehrfurcht beim Volk auslösen als jemand, dessen Ruf derart vorauseilt und selbst eine Schreckensgestalt wie einen Drachen besiegt?
Die Figuren, werden allein durch ihre beiläufig erwähnten Eigenschaften und Beinamen, charakterisiert und erhalten so ein Image, welches vom Autor bestimmt wird.
Beispielhaft lässt sich an Siegfried sehen, dass ihn viele Beinamen schmücken und alle gleichsam positiv konnotieren. So findet man ihn beispielsweise neben zahlreichen anderen Bezeichnungen als „Sivrit der helet guot“ (Nibelungenlied 2008, S. 108, 322) oder auch als „der starche Sivrit“ (Nibelungenlied 2008, S. 128, 386). Ebenso zeichnen sich einzelne Verse ab, die das klischeehafte Bild eines Helden, der äußerst ansehnlich und stark ist, ventilieren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Bild des unantastbaren Helden wird immer wieder aufgegriffen und thematisiert. Dem Leser wird keine Möglichkeit gegeben, Tapferkeit und Stärke Siegfrieds nur in Frage zu stellen.
Kriemhild wird als übernatürlich schön dargestellt, was ihre Kostbarkeit direkt bei ihrer Figurenvorstellung darlegt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Prinzessinnenbild, dem Helden ebenbürtig.
Ganz anders als das überirdische Schöne der Kriemhild, die amazonengleichen Verhaltensauffälligkeiten Brünhilds, ehe sie sich Gunther hingibt. Ihre übernatürlichen Kräfte, die durch ihrem Gürtel Verstärkung erlangen schienen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ließen Gunther derart unterliegen, dass es ihn beinahe das Leben kostete:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als Gunthers Freund kam der zuvor als unbesiegbar geschilderte Siegfried hinzu, der jedoch zunächst ebenfalls der Macht dieser Frau erliegt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es wirkt anfänglich absurd, dass eine Frau einem starken Manne bzw. Kämpfer wie Gunther, körperlich unterlegen sei, vor allem in Bezug auf den Kampf mit Siegfried im Anschluss, der zuvor Drachen bekämpfte und unbesiegbar schien,
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
doch hier unterliegt er, zumindest anfangs, einer Frau, die ihre Jungfräulichkeit schützt und dadurch über ihr real erscheinendes Kraftrepertoire hinauswächst.
Schicksal und Vorsehung definieren den Handlungsstrang des Nibelungenliedes. Der Autor nimmt durch Nebensätze wie „daz wart im sider leit“ (Nibelungenlied 2008, S. 224, 689) das Geschehen teilweise vorweg und macht aus dem Helden eine tragische Figur. Auch einzelne Passagen verdeutlichen den schicksalhaften Charakter:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hagen kennt Siegfried zwar nicht, und doch lässt sich sagen, unter Kenntnis des weiteren Verlaufs der Geschichte, dass das Schicksal Siegfried zu dem Manne geführt hat, der ihm einen Speer in den Rücken jagen wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In diesem kurzen Vorgriff lässt sich der weitere Handelsablauf auch erahnen als sei alles von Anfang an darauf ausgelegt, was den Schicksalsbegriff verstärkt.
Sowohl die Träume Kriemhilds in der ersten Aventiure als auch die Deutungen durch dessen Mutter, sind Teil des mythologischen Charakters des Nibelungenliedes, da sie Weissagungen bilden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt das Nibelungenlied als deutsches Nationalepos?
Es suggeriert eine starke Identifikation mit der deutschen Kulturgeschichte und dem Heldenmythos, obwohl seine Entstehung und Deutung historisch oft umstritten waren.
Welche mythologischen Elemente sind zentral für Siegfrieds Figur?
Zentral sind das Schwert Balmung, die Tarnkappe, der Kampf gegen den Drachen und das Bad in dessen Blut, das Siegfried unverwundbar machte (bis auf die Lindenblatt-Stelle).
Was symbolisiert die Tarnkappe im Nibelungenlied?
Die Tarnkappe ermöglicht Unsichtbarkeit und verleiht dem Träger übermenschliche Kräfte. Sie dient als fantastisches Element, um komplexe Spannungsbögen und Täuschungsmanöver in der Handlung zu ermöglichen.
Wie werden Kriemhild und Brünhild mythologisch charakterisiert?
Kriemhild wird als überirdisch schön dargestellt, während Brünhild über amazonengleiche, übernatürliche Kräfte verfügt, die sie erst verliert, als sie ihre Jungfräulichkeit an Gunther verliert.
Welche Rolle spielen Schicksal und Vorsehung im Epos?
Das Geschehen wird oft durch Weissagungen (z. B. Kriemhilds Falkentraum) vorweggenommen. Der Autor nutzt Vorgriffe, um den schicksalhaften und tragischen Charakter der Heldenreise zu unterstreichen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Mythologische Elemente als unersetzlicher Grundpfeiler für die Identifikation mit dem germanischen Nationalepos: Das Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196408