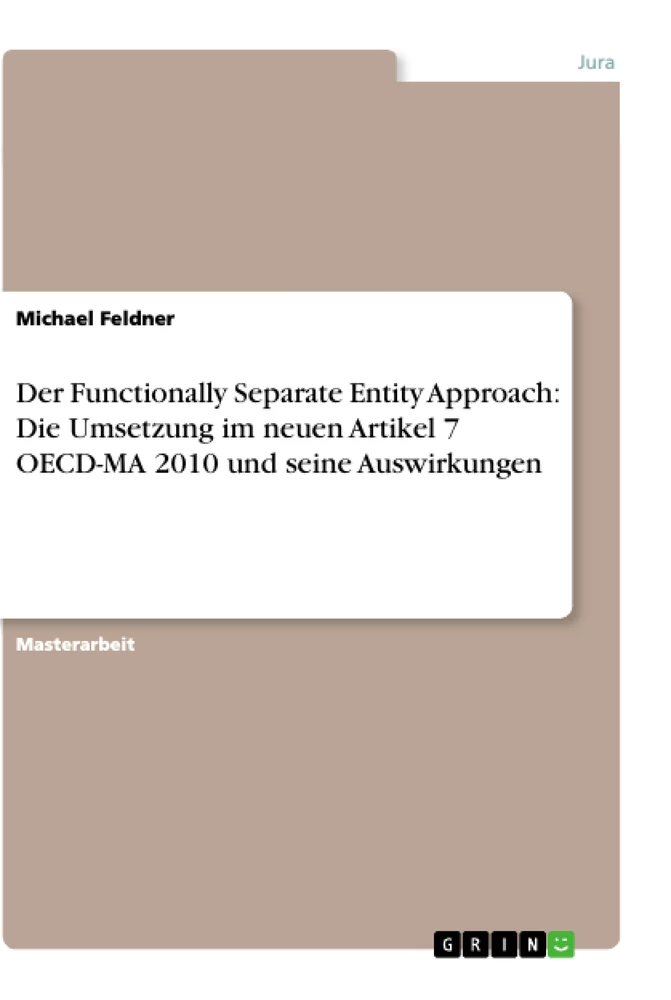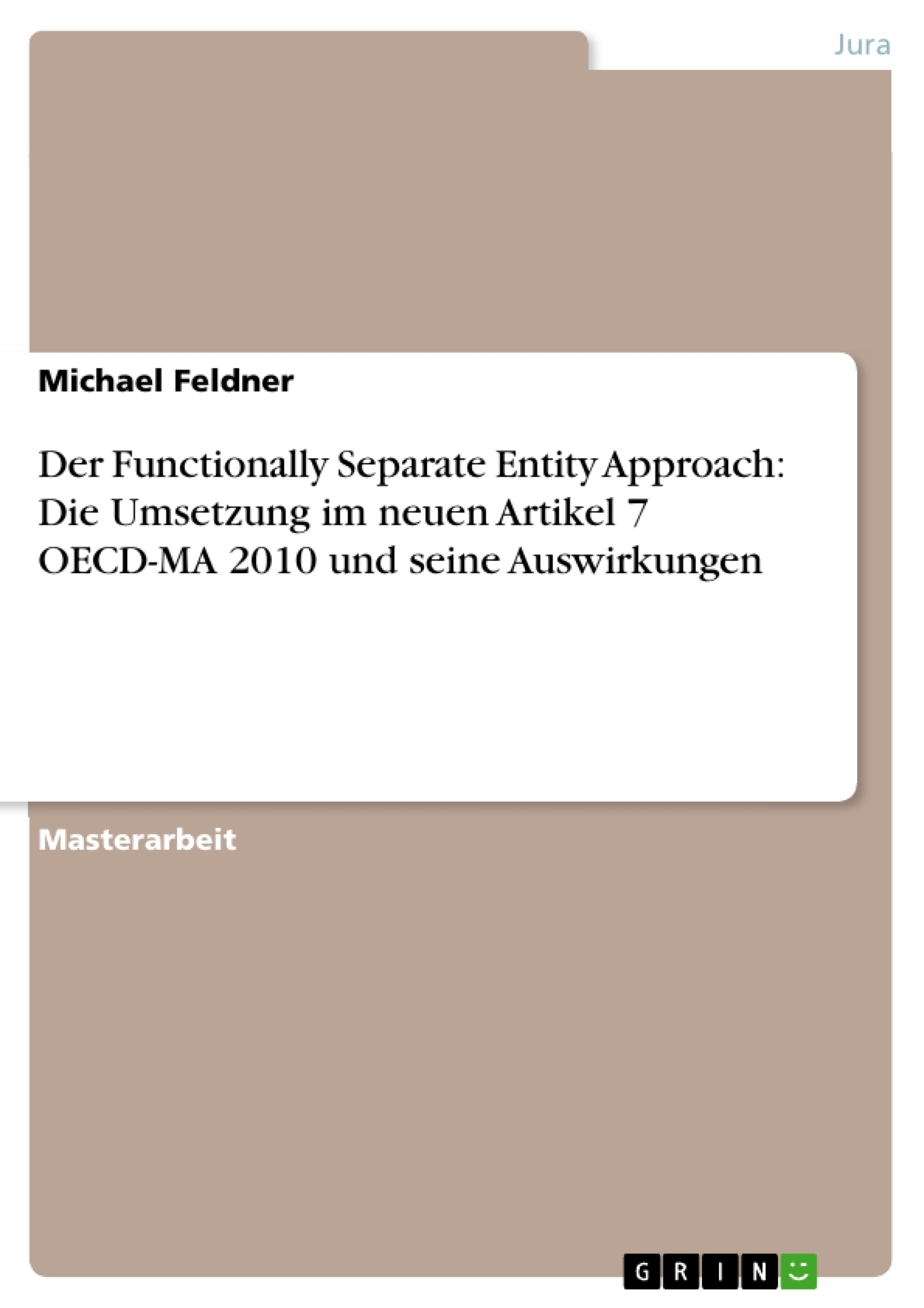Das Vorhandensein einer Betriebsstätte ist in Deutschland in vielerlei Hinsicht der Anknüpfungspunkt für das Bejahen der beschränkten Steuerpflicht. Verwiesen sei hier in erster Linie auf § 49 Abs. 1 Nr. 2 lit. a Alt. 1 EStG, der das Vorliegen inländischer Einkünfte aus Gewerbebetrieb an eine im Inland unterhaltene Betriebsstätte knüpft. In Verbindung mit § 1 Abs. 4 EStG wird dadurch die beschränkte Einkommensteuerpflicht und in Verbindung mit den §§ 2 Nr. 1, 8 Abs. 1 Satz 1 KStG die beschränkte Körperschaftsteuerpflicht bejaht. Unterhält ein ausländisches Unternehmen eine Betriebsstätte in Deutschland, wird es demzufolge in Deutschland beschränkt steuerpflichtig (sog. Inbound-Fall). Beschränkt steuerpflichtig heißt, dass das Unternehmen den Teil seiner Einkünfte in Deutschland versteuern muss, der auf die inländische Betriebsstätte entfällt.
Auch für den umgekehrten Fall, dass ein deutsches Unternehmen eine Betriebsstätte in einem anderen Staat unterhält (sog. Outbound-Fall), spielt die Betriebsstätte bei der deutschen Besteuerung eine nicht unerhebliche Rolle. Beispielsweise ist für die Ermittlung des Gewerbeertrags gemäß § 9 Nr. 3 GewStG der Gewinn um den Teil zu kürzen, „der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfällt.“ Analog zu § 49 Abs. 1 Nr. 2 lit. a Alt. 1 EStG handelt es sich gemäß § 34d Nr. 2 lit. a Alt. 1 EStG bei ausländischen Einkünften aus Gewerbebetrieb um Einkünfte einer „in einem ausländischen Staat belegene[n]“ Betriebsstätte.
Egal welchen der beiden Fälle man betrachtet, sobald ein Unternehmen in mindestens zwei Staaten tätig wird, kommt man um den Begriff der Betriebsstätte nicht mehr herum. Dies gilt sowohl für das nationale deutsche Steuerrecht, wie auch für das jeweils andere nationale Steuerrecht.
Auch in den Fällen, in denen ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) abgeschlossen wurde, regelt der Art. 7 OECD-MA die Verteilung von Unternehmensgewinnen am Merkmal der Betriebsstätte (sog. Betriebsstättenprinzip). Es geht letztlich immer um die Frage, welcher Teil der Einkünfte des Unternehmens, ist welcher Betriebsstätte zuzurechnen. Die OECD hat dabei den Art. 7 im Entwurf ihres Musterabkommens im Jahr 2010 einer gründlichen Neuerung unterzogen. Diese Neuerung bildet den Anlass für diese Arbeit. Sie sollen im Folgenden dargestellt und näher untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Der Begriff der Betriebsstätte
- I. Allgemeine Definition
- 1. Definition nach nationalem Recht
- 2. Definition nach Doppelbesteuerungsabkommen
- 3. Vorrang welcher Definition?
- II. Sonderformen von Betriebsstätten
- 1. Vertreterbetriebsstätte
- 2. Bau- oder Montagebetriebsstätte
- 3. Dienstleistungsbetriebsstätte
- C. Vorüberlegungen zur Einkünfteabgrenzung bei Betriebsstätten
- I. Unterscheidung der Einkünfteabgrenzung von der Einkünfteermittlung
- II. Das Ansässigkeits- und Betriebsstättenprinzip
- III. Personengesellschaften
- D. Die Einkünfteabgrenzung bei ausländischen Betriebsstätten
- I. Die Methoden zur Einkünfteabgrenzung bei Betriebsstätten
- 1. Die direkte Methode
- 2. Die indirekte Methode
- 3. Die gemischte Methode
- II. Die Neuerungen der OECD
- III. Die Einkünfteabgrenzung im Einzelnen
- IV. Die Folgen der „neuen“ gegenüber den „alten“ Grundsätzen
- V. Verluste bei ausländischen Betriebsstätten
- E. Die Auswirkungen auf das deutsche Steuerrecht
- F. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die neuen OECD-Grundsätze zur Einkünfteabgrenzung bei der Besteuerung ausländischer Betriebsstätten und deren Auswirkungen auf das deutsche Steuerrecht. Ziel ist es, die Neuerungen zu analysieren und deren Implikationen für die deutsche Steuerpraxis zu bewerten.
- Der Begriff der Betriebsstätte nach nationalem Recht und internationalen Abkommen
- Methoden der Einkünfteabgrenzung (direkte, indirekte, gemischte Methode)
- Die Neuerungen der OECD-Grundsätze und ihre Auswirkungen auf die Funktionsanalyse
- Die Bewertung von Innentransaktionen zwischen Betriebsstätte und Mutterunternehmen
- Die Auswirkungen der neuen Grundsätze auf das deutsche Steuerrecht
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Dieses Kapitel dient als Einleitung in die Thematik der Masterarbeit. Es beschreibt den Kontext der Arbeit, die Relevanz des Themas und gibt einen Überblick über den Aufbau und die Struktur der Arbeit. Es skizziert die zentralen Fragestellungen und benennt die Methodik der Untersuchung.
B. Der Begriff der Betriebsstätte: Dieser Abschnitt definiert den zentralen Begriff "Betriebsstätte" sowohl im nationalen deutschen Recht als auch im Kontext von Doppelbesteuerungsabkommen. Er analysiert die unterschiedlichen Definitionen und deren potenziellen Konflikte, untersucht den Vorrang der jeweiligen Definition und beleuchtet schließlich Sonderformen von Betriebsstätten wie Vertreter-, Bau- und Montage- sowie Dienstleistungsbetriebsstätten mit ihren jeweiligen spezifischen Merkmalen und steuerlichen Konsequenzen. Die Abgrenzungskriterien werden detailliert dargestellt und anhand von Beispielen illustriert.
C. Vorüberlegungen zur Einkünfteabgrenzung bei Betriebsstätten: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Einkünfteabgrenzung bei Betriebsstätten. Es unterscheidet zwischen Einkünfteabgrenzung und Einkünfteermittlung und erläutert das Ansässigkeits- und Betriebsstättenprinzip als zentrale Prinzipien der internationalen Besteuerung. Der Abschnitt zu Personengesellschaften beleuchtet die Besonderheiten der Einkünfteabgrenzung in diesem Kontext.
D. Die Einkünfteabgrenzung bei ausländischen Betriebsstätten: Das Herzstück der Arbeit. Es beschreibt verschiedene Methoden der Einkünfteabgrenzung (direkte, indirekte, gemischte Methode) und analysiert detailliert die Neuerungen der OECD-Grundsätze. Die Funktionsanalyse wird im Detail erläutert, inklusive der Zuordnung von Funktionen, Risiken, Wirtschaftsgütern (Anlage- und Umlaufvermögen, immaterielle Wirtschaftsgüter), Dienstleistungen und Finanzmitteln. Die Identifizierung von Innentransaktionen und deren Bewertung spielen eine entscheidende Rolle. Der Vergleich der "alten" und "neuen" Grundsätze wird ausführlich dargestellt. Schließlich werden Verluste bei ausländischen Betriebsstätten thematisiert.
E. Die Auswirkungen auf das deutsche Steuerrecht: Dieses Kapitel analysiert die konkreten Auswirkungen der neuen OECD-Grundsätze auf das deutsche Steuerrecht. Es untersucht die Anpassungsnotwendigkeiten und potenziellen Herausforderungen für die deutsche Steuerpraxis. Die Interaktion mit bestehenden deutschen Rechtsvorschriften wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
OECD-Grundsätze, Einkünfteabgrenzung, Betriebsstätte, Doppelbesteuerungsabkommen, Funktionsanalyse, Innentransaktionen, deutsches Steuerrecht, internationale Besteuerung, Risikoallokation, Wirtschaftsgüter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Einkünfteabgrenzung bei ausländischen Betriebsstätten
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit analysiert die neuen OECD-Grundsätze zur Einkünfteabgrenzung bei der Besteuerung ausländischer Betriebsstätten und deren Auswirkungen auf das deutsche Steuerrecht. Das Ziel ist die Bewertung der Neuerungen und deren Implikationen für die deutsche Steuerpraxis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff der Betriebsstätte nach nationalem Recht und internationalen Abkommen, verschiedene Methoden der Einkünfteabgrenzung (direkte, indirekte, gemischte Methode), die Neuerungen der OECD-Grundsätze und deren Auswirkungen auf die Funktionsanalyse, die Bewertung von Innentransaktionen zwischen Betriebsstätte und Mutterunternehmen sowie die Auswirkungen der neuen Grundsätze auf das deutsche Steuerrecht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung, Der Begriff der Betriebsstätte (inkl. Sonderformen), Vorüberlegungen zur Einkünfteabgrenzung bei Betriebsstätten, Die Einkünfteabgrenzung bei ausländischen Betriebsstätten (inkl. OECD-Neuerungen und Methodenvergleich), Die Auswirkungen auf das deutsche Steuerrecht und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas.
Was versteht die Arbeit unter "Betriebsstätte"?
Die Arbeit definiert den Begriff "Betriebsstätte" sowohl nach nationalem deutschem Recht als auch im Kontext von Doppelbesteuerungsabkommen. Sie analysiert unterschiedliche Definitionen und deren potenzielle Konflikte und beleuchtet Sonderformen wie Vertreter-, Bau- und Montage- sowie Dienstleistungsbetriebsstätten.
Welche Methoden der Einkünfteabgrenzung werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die direkte, indirekte und gemischte Methode der Einkünfteabgrenzung und analysiert detailliert, wie diese Methoden im Kontext der neuen OECD-Grundsätze angewendet werden. Die Funktionsanalyse, inklusive der Zuordnung von Funktionen, Risiken und Wirtschaftsgütern, spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Rolle spielen die OECD-Grundsätze?
Die neuen OECD-Grundsätze bilden den Kern der Arbeit. Die Arbeit analysiert diese Grundsätze detailliert und bewertet deren Auswirkungen auf die Funktionsanalyse, die Bewertung von Innentransaktionen und die Einkünfteabgrenzung im Allgemeinen.
Wie werden Innentransaktionen behandelt?
Die Arbeit legt großen Wert auf die Identifizierung und Bewertung von Innentransaktionen zwischen Betriebsstätte und Mutterunternehmen. Die korrekte Zuordnung von Funktionen, Risiken und Wirtschaftsgütern ist entscheidend für die korrekte Einkünfteabgrenzung.
Welche Auswirkungen haben die neuen Grundsätze auf das deutsche Steuerrecht?
Die Arbeit untersucht die konkreten Auswirkungen der neuen OECD-Grundsätze auf das deutsche Steuerrecht, die notwendigen Anpassungen und potenziellen Herausforderungen für die deutsche Steuerpraxis. Die Interaktion mit bestehenden deutschen Rechtsvorschriften wird beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: OECD-Grundsätze, Einkünfteabgrenzung, Betriebsstätte, Doppelbesteuerungsabkommen, Funktionsanalyse, Innentransaktionen, deutsches Steuerrecht, internationale Besteuerung, Risikoallokation, Wirtschaftsgüter.
- Arbeit zitieren
- Michael Feldner (Autor:in), 2012, Der Functionally Separate Entity Approach: Die Umsetzung im neuen Artikel 7 OECD-MA 2010 und seine Auswirkungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196448