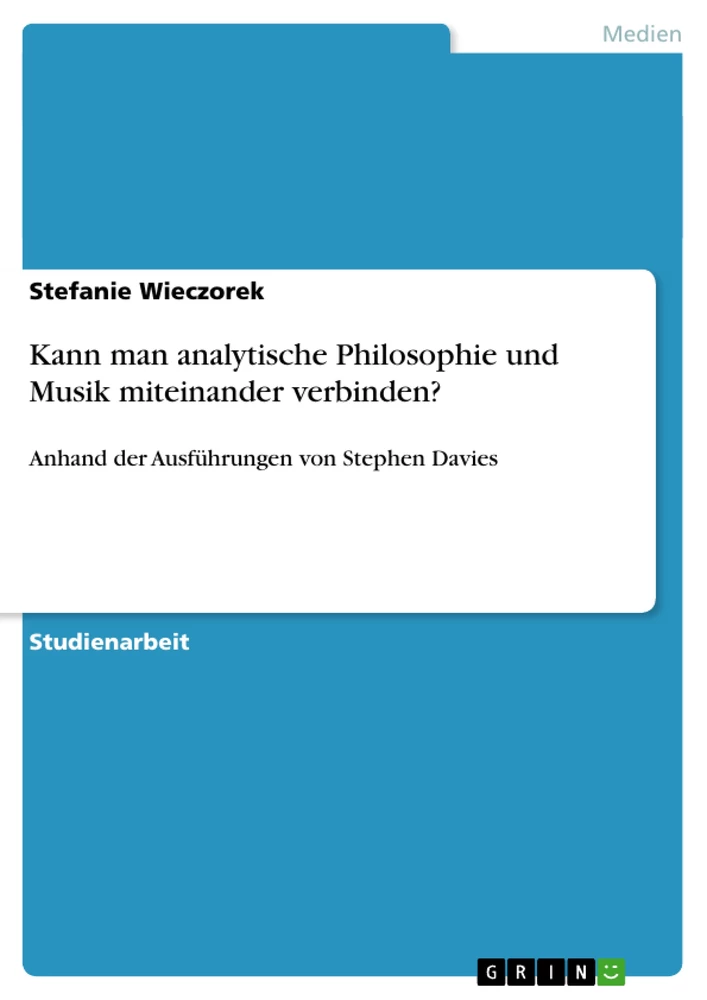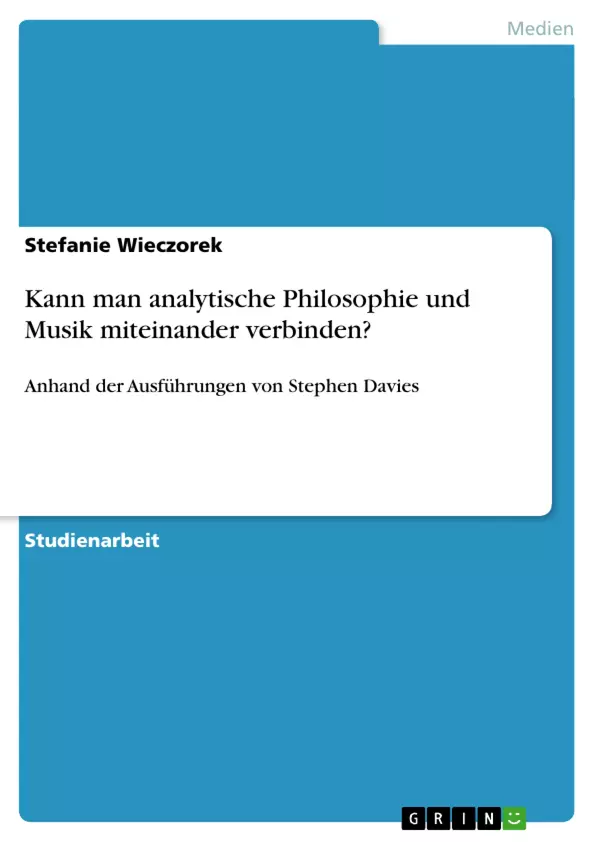Anhand der Ausführungen Stephen Davies', der in seinem Aufsatz „Musikalisches Verstehen“ die Arten des Verstehens, die man von kompetenten Hörern, Musikern, Musikwissenschaftlern und Komponisten erwartet1, untersucht, werde ich mich mit den verschiedenen Arten des Musikverständnisses der Musikhörer, der Musikaufführenden und der Komponisten auseinandersetzen. Ich werde mich hierbei besonders mit der Frage, ob man analytische Philosophie und Musik miteinander Verbinden kann, beschäftigen. Vorerst werde ich allerdings eine kleine Einführung in die analytische Philosophie geben, um dann im Verlauf meiner Ausführungen darauf zurückgreifen zu können. Daraufhin werde ich mich nacheinander mit den drei Gruppen der Musikkonsumierenden befassen und dabei auf zwei Gruppen eingehen, den geschulten und den unkundigen Hörern bzw. Komponisten. Anschließend folgt ein Fazit und der Beweis, dass man Musik und analytische Philosophie miteinander verbinden kann. 1 Stephen Davies, Musikalisches Verstehen, in: Alexander Becker und Matthias Vogel (Hg.), Musikalischer Sinn. Beiträge zu einer Philosophie der Musik, Frankfurt/Main 2007, S. 25-75, hier S. 25.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Einführung in die analytische Philosophie
3. Die Gruppen der Musikkonsumierenden
- Die Musikhörenden
- Die Musikaufführenden
- Die Komponisten
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Anhand der Ausführungen Stephen Davies', der in seinem Aufsatz „Musikalisches Verstehen“ die Arten des Verstehens, die man von kompetenten Hörern, Musikern, Musikwissenschaftlern und Komponisten erwartet1, untersucht, werde ich mich mit den verschiedenen Arten des Musikverständnisses der Musikhörer, der Musikaufführenden und der Komponisten auseinandersetzen. Ich werde mich hierbei besonders mit der Frage, ob man analytische Philosophie und Musik miteinander Verbinden kann, beschäftigen. Vorerst werde ich allerdings eine kleine Einführung in die analytische Philosophie geben, um dann im Verlauf meiner Ausführungen darauf zurückgreifen zu können. Daraufhin werde ich mich nacheinander mit den drei Gruppen der Musikkonsumierenden befassen und dabei auf zwei Gruppen eingehen, den geschulten und den unkundigen Hörern bzw. Komponisten. Anschließend folgt ein Fazit und der Beweis, dass man Musik und analytische Philosophie miteinander verbinden kann.
Einführung in die analytische Philosophie
Die analytische Philosophie ist seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine der international einflussreichsten philosophischen Bewegungen. Laut Ansgar Beckermann besteht sie „[...] in dem Versuch 'Scheinprobleme' zu lösen, die sich aus einem mangelnden Verständnis der Logik der Sprache ergeben.“2 Sie soll zu einem besseren Verstehen der Wissenschaften beitragen und vor Fehlern, wie dem falschen Verständnis der Sprache, bewahren. Dabei erwiesen sich die Sprachanalyse und die Sprachkritik als eine effiziente Methode der philosophischen Argumentation. Die Sprache als eine adäquate Ausdrucksform von Gedanken rückt somit in das Zentrum des Interesses, die Analyse der Sprache verheißt Aufschluss zu geben über die Gedanken.
Merkmale der analytischen Philosophie sind unter anderem:
„Der Versuch, den Inhalt einer These so präzise wie irgend möglich herauszuarbeiten, und sei es um den Preis der Penetranz oder gar der Langeweile.“3
Außerdem wird versucht begriffliche Implikationen und argumentative Zusammenhänge so klar wie möglich herauszuarbeiten. Ein weiteres Merkmal ist die Annahme, dass es nur einen großen philosophischen Diskurs gibt, was zu einer Öffnung gegenüber sämtlichen philosophischen Disziplinen und Fragestellungen führt.
Bevor man jedoch eine philosophische Frage zu beantworten versucht, muss die Bedeutung der Frage geklärt sein. Es wird zum Beispiel gefragt, was mit einer bestimmten Annahme gemeint ist oder welche verschiedenen Lesarten sie zulässt. Die Argumente der analytischen Philosophie sind nicht zu einer bestimmten Zeit, Kultur oder zu einem philosophischen System relativ, sie sind vielmehr ein systematischer Versuch, rationale Antworten auf philosophische Sachfragen zu erarbeiten.
Das Ziel ist es also, philosophische Probleme möglichst eindeutig und präzise zu formulieren und sie anschließend durch logische, begriffliche oder umgangssprachliche Analyse einer Lösung zuzuführen bzw. nachzuweisen, dass nur philosophische „Scheinprobleme“ existieren oder sprachliche Missverständnisse vorliegen. Der Philosoph sollte dabei als Therapeut wirken, indem er die erkrankte Sprache, durch einen Vergleich mit dem normalen Sprachgebrauch, heilt.
Abrundend ist zu sagen, dass analytische Philosophen versuchen, scheinbar komplizierte und unverständliche Sachverhalte für jedermann zugänglich zu machen, indem sie eine klare und vereinfachte Sprache anwenden. Für sie liegt das größte Problem des Nichtverstehens komplexer philosophischer Zusammenhänge in der Verworrenheit der Sprache. Deshalb versuchen sie unlösbare philosophische Fragen in den normalen Sprachgebrauch zu übertragen und somit einer Lösung näher zu kommen.
Die Gruppen der Musikkonsumierenden
Jeder Mensch versteht Musik anders, jeder besitzt eine individuelle Art mit der er sich Musik nähert, wie er sie aufnimmt und verarbeitet. Es gibt zwischen jeder Art von Musikkonsumierenden Unterschiede und andere Formen der Herangehensweise. Beispielsweise gibt es Musikhörende, die sich nur berieseln lassen und andere sind aktive Zuhörer, welche versuchen den Aufbau der Musik und die Interpretation der Aufführenden nachzuvollziehen. Beide Gruppen sind Hörer und doch unterscheidet sie etwas Grundlegendes, ihr Verständnis der Musik. Wahrscheinlich sind Zuhörende, die sich die Musik nur anhören, ohne darüber wirklich nachzudenken, eher Musik ungeschulte Menschen, oder geschulte Hörer möchten einfach mal abschalten. Jedoch wird ein geschulter Hörer dafür niemals in ein Konzert gehen, sondern lieber zu Hause einer Aufnahme lauschen. Geht ein geschulter Hörer in ein Konzert möchte er etwas für sich mitnehmen, er möchte eine neue Interpretation hören und sein Gehör weiterschulen, indem er zum Beispiel versucht zwischen Nebengeräuschen, die nicht zum eigentlichen Werk gehören, und der tatsächlichen Musik zu unterscheiden.4 Außerdem ist er gewillt seine Kenntnisse über den Aufbau der Musik bestätigt zu wissen und, wenn nötig, seine Mithörenden über gewisse musikalische Sachverhalte aufzuklären. Dabei könnte jedoch ein Problem auftreten: Nicht alle Musikhörenden sind geschulte Hörer und es könnte passieren, dass ein geschulter neben einem unkundigen Hörer sitzt und dieser nicht versteht, was man ihm erklären möchte. Der kundige Hörer würde einige auffällige Akkorde oder unerwartete Modulationen ansprechen und der ungeschulte Hörer wäre diesen Ausführungen schutzlos ausgeliefert, er kennt diese Begriffe nicht und kann somit auch nicht nachvollziehen von welchen Passagen im Stück gesprochen wird. Trotzdem ist es möglich, dass er das Werk an sich sehr ansprechend fand und es gerne noch einmal hören würde. Die musikalische Ausbildung ist nicht ausschlaggebend für das Verständnis von Musik, es spielt sich lediglich auf einer anderen Ebene ab. Es ist nicht nötig, dass man genau sagen kann ob ein Stück eine Exposition, Durchführung, Reprise und Coda enthält, jedenfalls nicht solange man der Musik zum Vergnügen und zur emotionalen Übertragung lauscht. Vielleicht können geschulte Hörer nicht verstehen, warum man sich ein Konzert setzt ohne die nötigen Vorkenntnisse über das Werk, den Komponisten, das Orchester und den Dirigenten zu haben. Sie können sich nicht vorstellen, wie man ohne jegliche Vorbildung Genuss beim Hören der Musik empfinden und befriedigt aus dem Konzert herausgehen kann, ohne im Geiste das Werk analysiert zu haben. Musikalisch gebildeten Hörern ist es eine Freude, wenn sie nach jedem Hören mit einer neuen Erkenntnis über die Zusammenhänge der einzelnen Teile oder Sätze des Stückes nach Hause gehen können. Aber auch unkundige Hörer können zufrieden sein, wenn sie ein Konzert mit dem Gefühl verlassen, dass sie etwas Neues kennengelernt haben und sich über dieses mit anderen Hörern austauschen. Das unterschiedliche Verständnis von Musik der verschiedenen Hörergruppen führt ausschließlich zu einer anderen Art und Weise über Musik zu sprechen. Ein kundiger Hörer versucht seine Gefühle beim Hören der Musik auf musikalische Mittel, wie Wiederholungen, ungewöhnliche Instrumentierung oder auffällige Akkorde, zurückzuführen, wobei er den Fachwortschatz verwendet. Ein ungeschulter Hörer hingegen wird seine Emotionen genauso beschreiben, wie er sie empfunden hat, er beherrscht zwar keine Fachworte, jedoch kann er seine Gefühle beschreiben und sagen, dass er das Stück schön fand aufgrund von bestimmten musikalischen Mitteln, die er zwar nicht benennen, aber beschreiben kann. Auf diese Art ist gewährleistet, dass ihn jeder versteht, geschulte wie ungeschulte Hörer, wohingegen ein kundiger Hörer nur von Gleichgesinnten verstanden wird, da seine Sprache zu kompliziert und speziell ist.
Eine weitere Gruppe Musikkonsumierender sind die Musikaufführenden.
[...]
1 Stephen Davies, Musikalisches Verstehen, in: Alexander Becker und Matthias Vogel (Hg.), Musikalischer Sinn. Beiträge zu einer Philosophie der Musik, Frankfurt/Main 2007, S. 25-75, hier S. 25.
2 Ansgar Beckermann, Grundbegriffe der analytischen Philosophie. Mit einer Einleitung von Ansgar Beckermann, [1.], Stuttgart 2004 , S. 3.
3 Ebd, S. 7.
4 Davies, Musikalisches Verstehen, S. 25.
Häufig gestellte Fragen
Was ist analytische Philosophie?
Die analytische Philosophie ist eine Bewegung, die versucht, philosophische Probleme durch die präzise Analyse der Sprache und der Logik zu lösen und "Scheinprobleme" zu entlarven.
Wie hängen analytische Philosophie und Musik zusammen?
Die Arbeit zeigt, dass man Musik durch begriffliche Klärung und die Analyse des musikalischen Verstehens philosophisch untersuchen kann, um präzise Antworten auf ästhetische Fragen zu finden.
Was unterscheidet den geschulten vom unkundigen Musikhörer?
Geschulte Hörer nutzen oft Fachvokabular und analysieren Strukturen (z.B. Modulationen), während unkundige Hörer ihre Emotionen direkt beschreiben, ohne musikalische Mittel technisch benennen zu können.
Ist musikalische Vorbildung für den Genuss von Musik notwendig?
Nein, die Arbeit argumentiert, dass auch ungeschulte Hörer tiefen Genuss empfinden können; das Verständnis findet lediglich auf einer anderen sprachlichen und kognitiven Ebene statt.
Welche Rolle spielt die Sprache im musikalischen Diskurs?
Analytische Philosophen sehen in der Verworrenheit der Sprache ein Hindernis für das Verständnis. Eine klare Sprache hilft dabei, komplexe musikalische Sachverhalte für jedermann zugänglich zu machen.
Wer ist Stephen Davies im Kontext dieser Arbeit?
Stephen Davies ist ein Philosoph, dessen Aufsatz "Musikalisches Verstehen" als Grundlage dient, um die verschiedenen Arten des Verstehens bei Hörern, Musikern und Komponisten zu untersuchen.
- Citation du texte
- Stefanie Wieczorek (Auteur), 2008, Kann man analytische Philosophie und Musik miteinander verbinden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196458