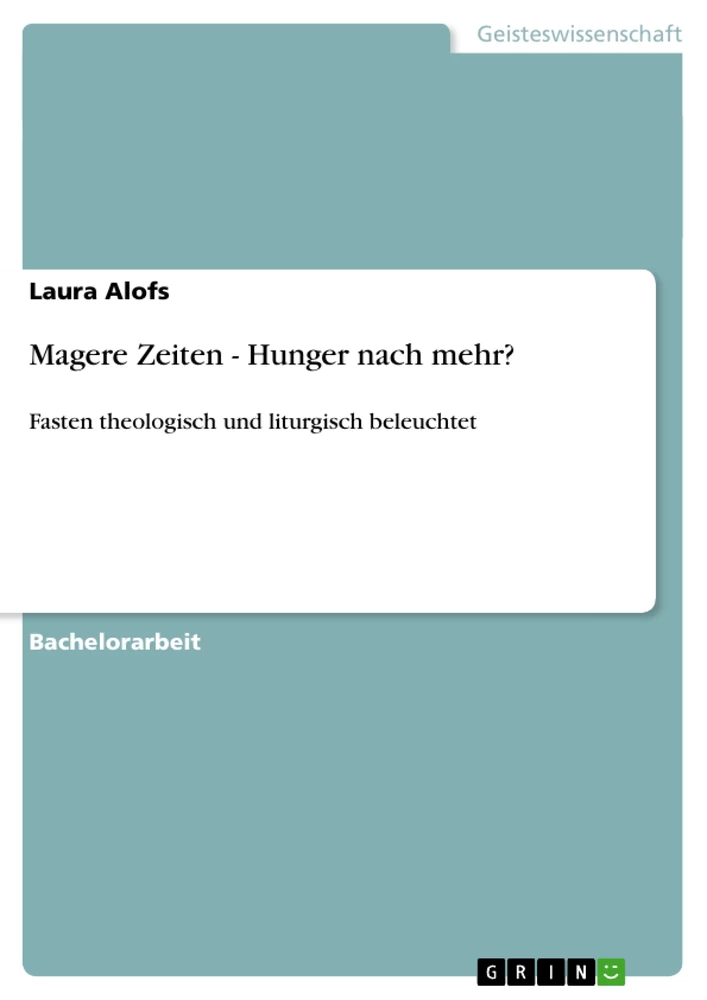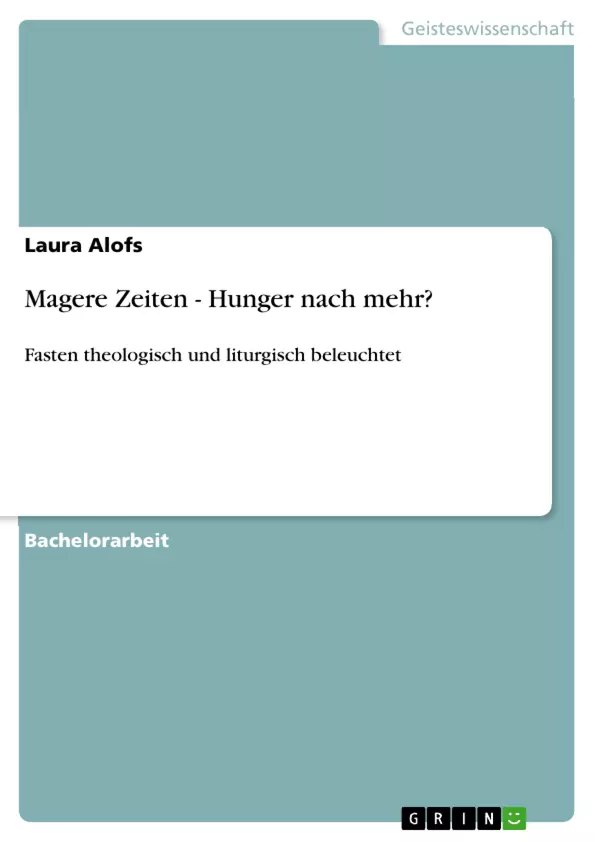Fasten – ein Thema, welches uns heute im Alltag immer wieder begegnet, mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Wollen wir Gewicht reduzieren oder uns besinnen? Beachten wir die Fastenzeiten aus religiöser Überzeugung oder stellen sie eine lästige ‚Pflichtübung‘ dar? Und wenn wir fasten, tun wir dies dann bewusst? Kann ein freiwilliger Verzicht tatsächlich eine Bereicherung bedeuten, wie dies Pastor Hinrich Westphal ausführt (s.o.). Kann eine Fastenzeit mich und meine Lebenseinstellung tatsächlich verändern?
Was bedeutet Fasten? Hiermit werde ich mich in der vorliegenden Arbeit beschäftigen. Beginnend mit drei einleitenden Abschnitten werde ich danach auf die historische Entwicklung des Phänomens eingehen. Es folgt ein Abgrenzungs- und Eingrenzungsversuch mit Hilfe verschiedener Religionen. Anschließend werde ich die heutige Situation sowohl was Liturgie als auch den nichtkirchlichen Alltag angeht, betrachten; der Schwerpunkt des nichtkirchlichen Teils liegt dabei auf der Frage nach Sehnsucht. Ein kurzer Blick auf verschiedene Bräuche und deren Entwicklung bietet ebenfalls eine Alltagsperspektive, bevor im abschließenden Fazit nochmals die eingangs aufgeworfenen Fragen bedacht werden.
Diese Arbeit kann lediglich ein Schlaglicht auf die Thematik werfen, viele Punkte sind exemplarisch zu verstehen und erheben keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit. Besonders wichtig erscheint mir die Bedeutsamkeit für den heutigen Alltag eines gläubigen Menschen, hierauf wird immer wieder der Fokus liegen. Der Gedanke einer grundsätzlichen Sehnsucht im Leben jedes Menschen ist dabei zu betrachten, vielleicht findet dieses Bedürfnis im Phänomen des Fastens eine Antwort?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kurze Hinführung
- 2.1 Philosophisch
- 2.2 Pädagogisch
- 2.3 Lexikalisch
- 3. Historische Hintergründe
- 3.1 Drei historische Beispiele
- 3.1.1 Blick in die Benediktusregeln
- 3.1.2 Gedanken Hildegard von Bingens
- 3.1.3 Otto Buchinger und das Heilfasten
- 4. Abgrenzung durch Vergleich
- 4.1 Evangelische Kirche – „7 Wochen ohne“
- 4.2 Fastenpraxis in der römisch-katholischen Kirche
- 4.3 Die Fastenfrage im Judentum
- 4.3.1 Parallelen und Unterschiede zum Christentum
- 4.4 Islamische Fastenzeit – der Ramadan
- 4.4.1 Parallelen und Unterschiede zum Christentum
- 4.5 Fasten in den Orthodoxen Kirchen
- 4.5.1 Parallelen und Unterschiede zwischen „Ost und West“
- 5. Römisch-katholische Fastenliturgie
- 5.1 Aschermittwoch
- 5.2 Erster Fastensonntag
- 5.3 Zweiter Fastensonntag
- 5.4 Dritter Fastensonntag
- 5.5 Vierter Fastensonntag
- 5.6 Fünfter Fastensonntag
- 5.7 Allgemeines und Zusammenfassung
- 6. Schlaglicht Theologische Gegenwart
- 7. Von St. Martin bis Karneval – Ein Ausflug ins (christliche) Brauchtum
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Phänomen des Fastens aus theologischer und liturgischer Perspektive. Ziel ist es, das Fasten in seiner Vielschichtigkeit zu beleuchten und seine Bedeutung für den heutigen Alltag gläubiger Menschen zu ergründen. Die Arbeit geht dabei der Frage nach, ob und wie Fasten eine Bereicherung des Lebens darstellen kann.
- Theologische und liturgische Aspekte des Fastens
- Historische Entwicklung des Fastens in verschiedenen Religionen
- Vergleich verschiedener Fastenpraktiken (katholisch, evangelisch, jüdisch, islamisch, orthodox)
- Fasten im Kontext des heutigen Alltags und der Sehnsucht nach Sinn
- Pädagogische Relevanz des Themas Fasten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Fasten ein und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung des Fastens im heutigen Alltag. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und betont den exemplarischen Charakter der Ausführungen. Der Fokus liegt auf der Relevanz des Fastens für gläubige Menschen und der möglichen Antwort, die das Fasten auf eine grundsätzliche Sehnsucht im Leben geben kann.
2. Kurze Hinführung: Dieses Kapitel bietet drei verschiedene Zugänge zum Thema Fasten: einen philosophischen, pädagogischen und lexikalischen. Der philosophische Ansatz befasst sich mit der Frage nach dem Verständnis von Fragen und Antworten, der pädagogische Ansatz betrachtet die Relevanz des Themas für den Religionsunterricht, und der lexikalische Ansatz (nicht im Auszug enthalten) würde vermutlich eine Definition und Erklärung des Begriffs "Fasten" liefern.
3. Historische Hintergründe: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Fastens anhand dreier Beispiele: der Benediktusregel, der Spiritualität Hildegard von Bingens und dem Heilfasten nach Otto Buchinger. Es untersucht die unterschiedlichen Motive und Praktiken des Fastens in diesen historischen Kontexten und zeigt die Entwicklung und Wandlung des Fastens über die Jahrhunderte.
4. Abgrenzung durch Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Fastenpraxis in verschiedenen Religionen (evangelisch, römisch-katholisch, jüdisch, islamisch, orthodox). Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Traditionen hinsichtlich der Motive, Riten und Bedeutung des Fastens herausgearbeitet. Der Vergleich soll die spezifische Position des katholischen Fastens verdeutlichen.
5. Römisch-katholische Fastenliturgie: Dieses Kapitel analysiert die liturgischen Elemente der römisch-katholischen Fastenzeit, indem es einzelne Sonntage im Detail beschreibt. Es beleuchtet die theologische Bedeutung der jeweiligen Liturgie und ihre Rolle im Rahmen der gesamten Fastenzeit. Die Zusammenfassung des Kapitels fasst die zentralen liturgischen Aspekte zusammen und betont ihre Bedeutung für das religiöse Leben.
6. Schlaglicht Theologische Gegenwart: (Inhalt nicht im Auszug enthalten)
7. Von St. Martin bis Karneval – Ein Ausflug ins (christliche) Brauchtum: (Inhalt nicht im Auszug enthalten)
Schlüsselwörter
Fasten, Liturgie, Theologie, Religion, Geschichte, Vergleichende Religionswissenschaft, Katholische Kirche, Sehnsucht, Alltag, Pädagogik, Benediktusregel, Hildegard von Bingen, Otto Buchinger, Ramadan.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Fasten – Liturgische und theologische Perspektiven
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Phänomen des Fastens aus theologischer und liturgischer Sicht. Sie beleuchtet die Vielschichtigkeit des Fastens und seine Bedeutung im heutigen Alltag gläubiger Menschen, insbesondere die Frage, ob und wie Fasten eine Bereicherung des Lebens darstellen kann.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt theologische und liturgische Aspekte des Fastens, seine historische Entwicklung in verschiedenen Religionen, einen Vergleich verschiedener Fastenpraktiken (katholisch, evangelisch, jüdisch, islamisch, orthodox), den Kontext des Fastens im heutigen Alltag und die pädagogische Relevanz des Themas.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und einer kurzen Hinführung, die philosophische, pädagogische und lexikalische Aspekte beleuchtet. Es folgt ein Kapitel zu den historischen Hintergründen des Fastens mit Beispielen aus der Benediktusregel, Hildegard von Bingens Werk und dem Heilfasten nach Otto Buchinger. Ein weiterer Abschnitt vergleicht die Fastenpraxis in verschiedenen Religionen. Ein Kapitel widmet sich der römisch-katholischen Fastenliturgie, gefolgt von Kapiteln zur theologischen Gegenwart und zum christlichen Brauchtum (St. Martin bis Karneval). Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche historischen Beispiele werden im Kontext des Fastens betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Benediktusregel, die Spiritualität Hildegard von Bingens und das Heilfasten nach Otto Buchinger als historische Beispiele für unterschiedliche Motive und Praktiken des Fastens.
Welche Religionen werden im Vergleich ihrer Fastenpraktiken behandelt?
Die Arbeit vergleicht die Fastenpraxis der evangelischen, römisch-katholischen, jüdischen, islamischen und orthodoxen Kirchen, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Motiven, Riten und Bedeutung herausgearbeitet werden.
Wie wird die römisch-katholische Fastenliturgie behandelt?
Die römisch-katholische Fastenliturgie wird detailliert analysiert, indem einzelne Sonntage der Fastenzeit beschrieben und ihre theologische Bedeutung im Kontext der gesamten Fastenzeit beleuchtet wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fasten, Liturgie, Theologie, Religion, Geschichte, Vergleichende Religionswissenschaft, Katholische Kirche, Sehnsucht, Alltag, Pädagogik, Benediktusregel, Hildegard von Bingen, Otto Buchinger, Ramadan.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, das Fasten in seiner Vielschichtigkeit zu beleuchten und seine Bedeutung für den heutigen Alltag gläubiger Menschen zu ergründen. Es soll untersucht werden, ob und wie Fasten eine Bereicherung des Lebens darstellen kann.
- Quote paper
- Laura Alofs (Author), 2012, Magere Zeiten - Hunger nach mehr?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196511