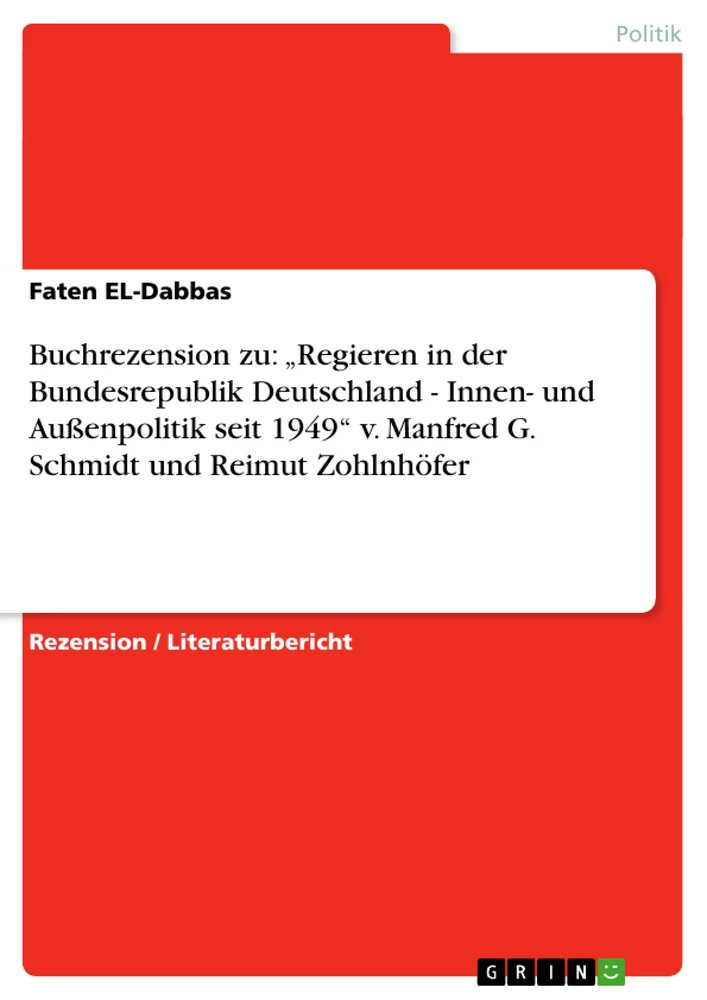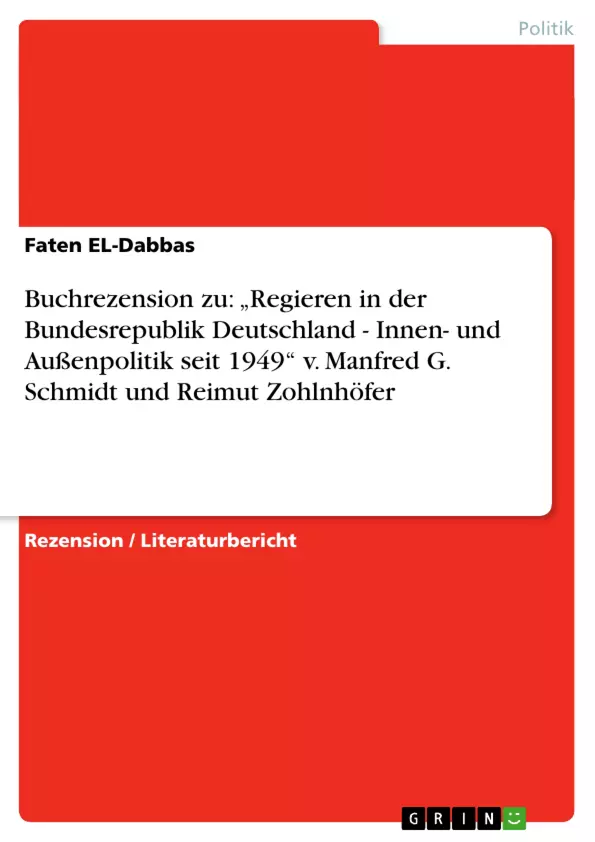Selten hat ein Einführungswerk in das politische System Deutschlands eine politikfeldspezifische Policy-Analyse gewählt. Der vorliegende Band „Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 1949“ von den Politikwissenschaftlern Manfred G. Schmidt und Reimut Zohlnhöfer hebt sich aber gerade dadurch von gängigen Einführungswerken ab.
Der Titel verspricht die Brücke zwischen Innen- und Außenpolitik zu schlagen und deutet auf eine historische Betrachtungsweise hin. Doch auf den 523 Seiten gelingt den Professoren an der Universität Heidelberg in Zusammenarbeit mit anderen Politikwissenschaftlern ein Werk, das mehr als nur auf der diachronen Ebene überzeugt. Indem es Zusammenhänge zwischen den Inhalten und Ergebnissen der Politik und zwischen den Institutionen und Abläufen seit 1949 untersucht (Schmidt/ Zohlnhöfer 2006, S.9), wechselt es die Perspektiven.
Den Leser erwartet in vier Kapiteln ein Überblick über die wichtigsten Politikfelder in Deutschland. Eingerahmt werden diese von einem Vorwort, das die Rahmenbedingungen der politischen Willensbildung und Entscheidungsprozesse analysiert, und einem
Abschlusskapitel, in dem nach 55 Jahren deutscher Regierungspolitik Bilanz gezogen wird.
Selten hat ein Einführungswerk in das politische System Deutschlands eine politikfeldspezifische Policy-Analyse gewählt. Der vorliegende Band „Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 1949“ von den Politikwissenschaftlern Manfred G. Schmidt und Reimut Zohlnhöfer hebt sich aber gerade dadurch von gängigen Einführungswerken ab.
Der Titel verspricht die Brücke zwischen Innen- und Außenpolitik zu schlagen und deutet auf eine historische Betrachtungsweise hin. Doch auf den 523 Seiten gelingt den Professoren an der Universität Heidelberg in Zusammenarbeit mit anderen Politikwissenschaftlern ein Werk, das mehr als nur auf der diachronen Ebene überzeugt. Indem es Zusammenhänge zwischen den Inhalten und Ergebnissen der Politik und zwischen den Institutionen und Abläufen seit 1949 untersucht (Schmidt/ Zohlnhöfer 2006, S.9), wechselt es die Perspektiven.
Den Leser erwartet in vier Kapiteln ein Überblick über die wichtigsten Politikfelder in Deutschland. Eingerahmt werden diese von einem Vorwort, das die Rahmenbedingungen der politischen Willensbildung und Entscheidungsprozesse analysiert, und einem Abschlusskapitel, in dem nach 55 Jahren deutscher Regierungspolitik Bilanz gezogen wird.
Das erste Kapitel führt uns in die „ Klassischen Politikfelder “ ein, worunter die Herausgeber zunächst die Verfassungspolitik fassen. Es wird untersucht, wie oft die deutsche Verfassung im Zeitverlauf geändert wurde und welche Institutionen und Faktoren einen Einfluss darauf hatten. Im Ergebnis wurde das Grundgesetz von 1949 bis 2004 51 Mal geändert, was auf einen erheblichen Wandel deutet. Doch ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt, dass diese Änderungsrate international nicht extrem hoch ist, sodass das Grundgesetz insgesamt ein zuverlässiges und stabiles Spielregelwerk darstellt.
Weiterhin werden die Staatsfinanzen als klassisches Politikfeld eingestuft. Als finanzielle Ressource eines Staates bilden sie den Kern der Staatstätigkeit. Es werden die Staatseinnahmen und -ausgaben beleuchtet und die Ergebnisse erneut international mit den OECD-Ländern verglichen. Es wird auf die Staatsverschuldung als Option zur Finanzierung der Staatstätigkeit eingegangen. Besonders widmet sich der Autor den Finanzbeziehungen zwischen den drei Ebenen Bund, Länder und Gemeinden.
Unter dem nächsten Punkt „Innere Sicherheit und der Wandel von Staatlichkeit“ verbirgt sich ein Bereich, der von einem starken Wandlungsdruck gekennzeichnet ist. Anhand der drei Faktoren Europäisierungsprozess, Verlust der Polizei über das Monopol der Sicherheit und internationaler Terrorismus wird dieser Wandel erklärt. So hatte der internationale Terrorismus zur Folge, dass der Bund stärkere Kompetenzen erhalten sollte, was u.a. auch zur Gründung eines Terrorismus-Abwehrzentrums führte. Die innere Sicherheit soll letztlich an die Europäisierung, Internationalisierung und Globalisierung angepasst werden, aber gleichzeitig im Einklang mit dem Rechtsstaats- und Demokratiegrundsatz stehen. Zuletzt findet die Migrations- und Staatsangehörigkeitspolitik ihren Platz unter den klassischen Politikfeldern. Deutschland ist innerhalb der OECD-Länder eines der Hauptzielländer für Migranten und das wichtigste Aufnahmeland in der Union. Dennoch ist nach den drei Einwanderungswellen (Gastarbeiter ab 1955, deren Familien ab 1973 und die Gruppe der Asylbewerber ab 1978) der politische Umgang mit den Migranten problematisch. Das Selbstverständnis Deutschlands als Nichteinwanderungsland spiegelt sich u.a. in dem erst sehr spät verabschiedeten Zuwanderungsgesetz von 2004 wieder. Der Autor macht deutlich, dass die Parteien und Koalitionen mangels überparteilichen Konsenses sehr viel zum Handlungsdefizit in der Migrationspolitik beitrugen.
Das zweite Kapitel widmet sich den „ Sozialstaatlichen Politikfeldern “. Es bildet das umfangreichste Kapitel und deckt darin die Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, Arbeits- und Beschäftigungspolitik, Wohnungspolitik, Bildungs- und Kulturpolitik sowie die Gleichstellungspolitik ab. Obwohl Deutschland für die Sozialpolitik im Vergleich zu anderen Politikfeldern am meisten Geld ausgibt, erklärt der Autor sie zu einem „Sanierungsfall“ (Schmidt/ Zohlnhöfer 2006, S. 154). Ein Kennzeichen der deutschen Politik ist das Vorhandensein zweier großer Volks- und Sozialstaatsparteien CDU/CSU und SPD, die die politischen Entwicklungen nachhaltig durch ihre Konkurrenz prägten. Der Autor erklärt sowohl alle bisherigen Regierungen als auch die Oppositionsparteien für den Zustand der Sozialpolitik für mitverantwortlich.
Im Anschluss werden aus konflikttheoretischer Perspektive die Entwicklungen in der Gesundheitspolitik untersucht. Bis 1975 war dieses Politikfeld vom Lobbyismus geprägt ohne dass ein konsensorientierter Ausbau des Gesundheitssystems stattfinden konnte. Nach der Wende strebte die Große Koalition Verhandlungen an mit dem primären Ziel der Finanzierbarkeit, sodass unter Einfluss des Europäischen Integrationsprozesses die Bedeutung der Finanzierbarkeit und die der Qualität zu Lasten der Wachstumsziele zunahmen.
„Von Vollbeschäftigung in Arbeitslosigkeit“ lautet der Titel des nächsten Unterkapitels zur Arbeitsmarktpolitik. Anhand von sehr theoriebeladenen Abschnitten wird festgestellt, dass der deutsche Arbeitsmarkt an einer Wachstumsschwäche und mangelnder Beschäftigungsdynamik leidet. Zurückzuführen sei dies auf den handlungshemmenden Föderalismus, dem veralteten, an Männern orientierten Bild der Vollbeschäftigung und der Sozialpartnerschaft. Diese Faktoren lassen den Autor pessimistisch in die Zukunft blicken.
Das Verständnis der Wohnungspolitik als Versorgung mit Wohnraum und Geld erklärt die Einstufung der Wohnung als Sozialgut und nicht als Wirtschaftsgut. In diesem Kapitel werden zunächst die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern erläutert: Der Bund hat Mitsprache im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung, ist aber im finanziellen Bereich auf die Zustimmung der Länder angewiesen. Der Autor führt den Leser in drei Instrumente der Wohnungspolitik ein, die zum einen konfliktbehaftet sind (z.B. Mietrecht), konsensual getragen sind (z.B. Wohngeld) und die drittens fragmentiert-überfrachtet sind (z.B. Eigenheimzulage).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Buch "Regieren in der Bundesrepublik Deutschland"?
Das Werk von Schmidt und Zohlnhöfer bietet eine politikfeldspezifische Policy-Analyse der deutschen Innen- und Außenpolitik seit 1949.
Wie oft wurde das deutsche Grundgesetz bisher geändert?
Von 1949 bis 2004 wurde die Verfassung 51 Mal geändert, was im internationalen Vergleich als moderat und stabil eingestuft wird.
Welche Bereiche zählen zu den "Sozialstaatlichen Politikfeldern"?
Dazu gehören unter anderem die Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, Arbeitsmarktpolitik sowie die Bildungs- und Gleichstellungspolitik.
Warum wird die deutsche Sozialpolitik als "Sanierungsfall" bezeichnet?
Trotz extrem hoher Ausgaben stehen die Systeme unter starkem finanziellem und strukturellem Reformdruck, wofür die Arbeit verschiedene politische Akteure verantwortlich macht.
Wie hat sich die Innere Sicherheit in Deutschland gewandelt?
Der Wandel wird durch die Europäisierung, den internationalen Terrorismus und das Ende des staatlichen Gewaltmonopols in bestimmten Sicherheitsbereichen erklärt.
Was ist das Besondere an diesem Einführungswerk?
Im Gegensatz zu anderen Werken wählt es eine Policy-Analyse, die Zusammenhänge zwischen Inhalten, Ergebnissen und Institutionen der Politik untersucht.
- Arbeit zitieren
- Faten EL-Dabbas (Autor:in), 2012, Buchrezension zu: „Regieren in der Bundesrepublik Deutschland - Innen- und Außenpolitik seit 1949“ v. Manfred G. Schmidt und Reimut Zohlnhöfer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196567