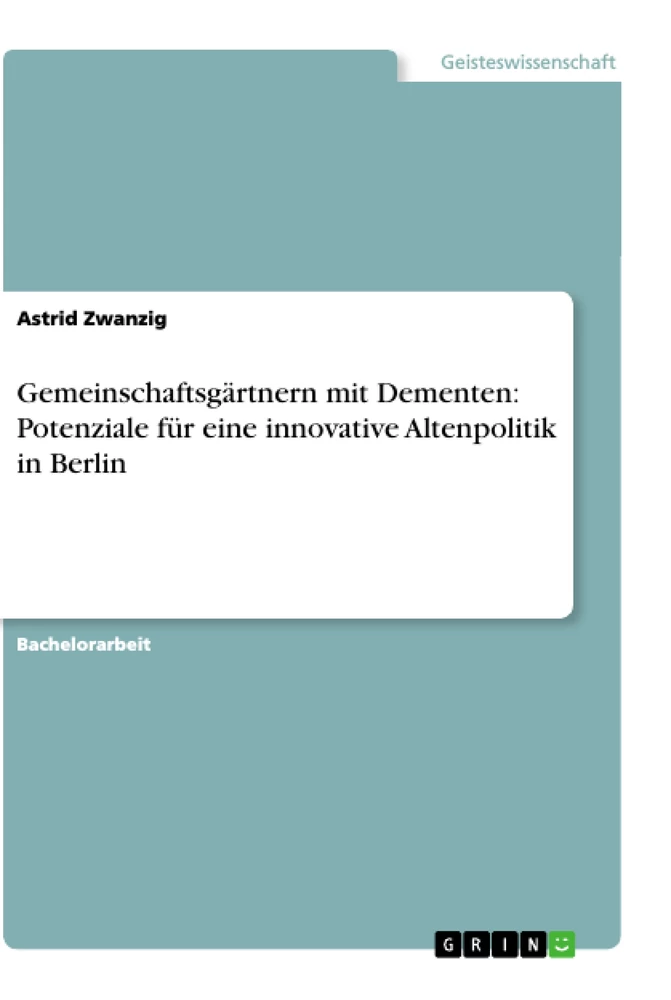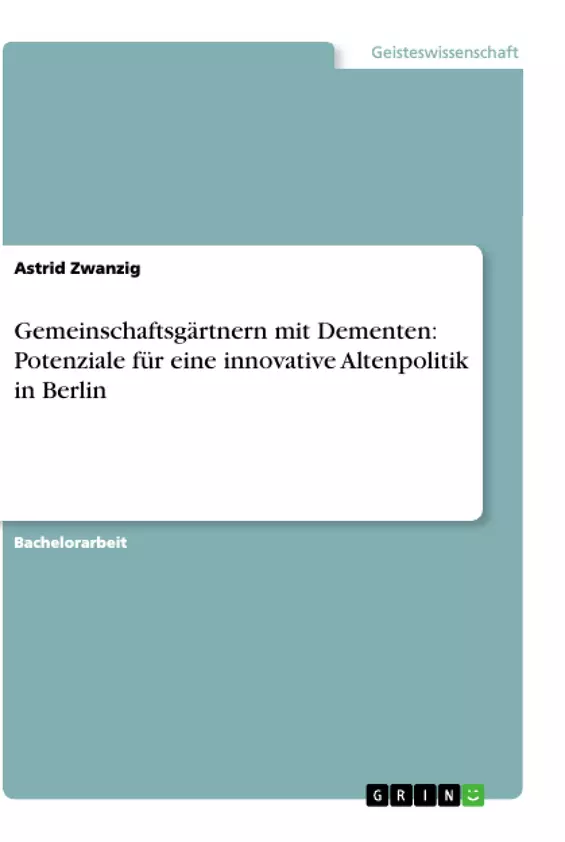Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, ob und wie Gemeinschaftsgärten ein Ansatz sein können, das Wohlbefinden, die Lebensqualität sowie die soziale Teilhabe und Akzeptanz von Menschen mit Demenz zu verbessern.
Im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung vor Ort besteht hier insbesondere kommunalpolitischer Handlungsbedarf. Im Blickpunkt dieser Arbeit steht es deshalb, Anregungen zur Verbesserung der Lebenslage von Menschen mit Demenz auf kommunaler Ebene zu geben.
Zudem ist es Ziel der Arbeit, Ansätze aufzuzeigen, die bei einer Implementierung von Gemeinschaftsgärten für Menschen mit Demenz in der kommunalen Altenpolitik genutzt werden können und wo Weiterentwicklungsbedarf besteht.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Motivation und Anlass
1.2 Problem- und Fragestellung
1.3 Forschungsstand
1.4 Aufbau der Arbeit
2 Grundlagen demenzieller Erkrankungen
2.1 Definition von Demenz
2.1.1 Formen von Demenz
2.1.1.1 Demenz vom Alzheimer Typ
2.1.1.2 Vaskuläre Demenz
2.1.1.3 Die Frontotemporale Demenz
2.1.1.4 Die Levy-Körperchen-Demenz
2.1.2 Symptomatik von Demenz
2.1.3 Stadien der Demenz
3 Zur Lebenswelt von Menschen mit Demenz
3.1 Der Lebensweltansatz nach Thiersch und Grunwald
3.1.1 Annäherung an die Lebenswelt von Menschen mit Demenz
3.1.2 Die Bedürfnisse von Personen mit Demenz
3.1.3 Spezifische Verhaltensweisen im Alltag
3.1.4 Pflegende Angehörige
3.1.5 Ambulante Versorgung
3.1.6 Stationäre Versorgung
3.1.7 Alternative Wohnmodelle
3.2 Fazit
3.3 Lebensqualität von Menschen mit Demenz
4 Soziale und rechtliche Rahmenbedingungen
5 Soziale Arbeit im Handlungsfeld
6 Gemeinschaftgärten
6.1 Gemeinschaftsgärten und Gesellschaft
6.1.1 Begriffsbestimmung
6.1.2 Historischer Rückblick
6.1.3 Formen von Gemeinschaftsgärten
6.1.3.1 Interkulturelle Gärten
6.1.3.2 Nachbarschaftsgärten
6.1.3.3 Mehrgenerationengärten
6.1.4 Gemeinschaftsgärten in Berlin
6.1.5 Potentiale und positive Auswirkungen von Gemeinschaftsgärten
6.1.6 Risiken und negative Auswirkungen von Gemeinschaftsgärten
6.2 Gemeinschaftgärten und Menschen mit Demenz
6.2.1 Potentiale zur Steigerung des Wohlbefindens von Menschen mit Demenz
6.2.2 Anregung der Sinne
6.2.3 Förderung von sozialen Kontakten
6.2.4 Beschäftigung
6.2.5 Training von Koordination und Ausdauer durch körperliche Betätigung
6.2.6 Beruhigung und Entspannung
6.2.7 Gedächtnistraining
6.2.8 Angehörigenarbeit
6.3 Naturgestützte Therapie
6.3.1 Ausstattung und Anforderungen
6.4 Fazit
7 Umsetzung und Potentiale für die kommunale Altenpolitik
7.1 Begriffliche Bestimmungen
7.1.1 Altenpolitik
7.1.2 Altenpolitik in Berlin
7.2 Kommunale Altenhilfeplanung
7.2.1 Partizipative Sozialplanung
7.3 Theoretische Ansätze zur Umsetzung
7.3.1 Sozialraumorientierung
7.3.1.1 Sozialer Raum
7.3.1.2 Prinzipien sozialraumorientierter Arbeit
7.3.1.3 Sozialraumorientierung als Handlungsprinzip für Demenzkranke
7.3.1.4 Fazit
7.3.2 Quartiersmanagement
7.3.3 Netzwerkarbeit
7.3.4 Bürgerschaftliches Engagement
7.3.5 Motivation von Ehrenamtlichen
7.4 Fazit
8 Gesamtzusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick
8.1 Theorieansätze der Sozialen Arbeit und die Arbeit mit Demenzkranken
8.2 Gemeinschaftsgärten für Menschen mit Demenz
8.3 Schlussfolgerungen für die Kommunale Altenpolitik
8.4 Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Politik für Seniorinnen und Senioren – Berliner Leitlinien 2005
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Änderung der Altersstruktur in Berlin von 2009 auf 2030 (%) (Quelle: Bertelsmann Stiftung: Wegweiser-Kommune)
Abbildung 2: Das Alter - Hauptrisiko für Demenz 12 (Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft (o. J).)
Abbidung 3: Die unterschiedlichen Formen der Demenz (Quelle: Möller HJ, Laux G, Deister A (2009) Psychiatrie und Psychotherapie: Duale Reihe. 4. Auflage. Thieme-Verlag: Stuttgart)
Abbildung 4: Vor dem Brandenburger Tor bauen Berlins Bürger Gemüse im 35 Tiergarten an. (Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-M1015-316 / Herbert Donath (o. J.))
Abbildung 5: Interkultureller Garten Lichtenberg (Quelle: Sozialdiakonische Jugendarbeit Lichtenberg e.V. (o. J.))
Abbildung 6: Prinzessinnengärten Berlin-Kreuzberg 2011 (Quelle: Marco Clausen, nomadisch grün)
Abbildung 7: Gartentherapie im Geriatriezentrum "Am Wiederwald" (Quelle: Fritz Neuhauser (o. J.))
Abbildung 8: Green Care (Quelle: Haubenhofer, 2010)
Abbildung 9: Prinzessinnengärten Berlin Kreuzberg (Quelle: nomadisch grün)
Abbildung 10: Strukturveränderung in der Altenhilfe (Quelle: Evangelisches Johanneswerk 2011)
Abbildung 11: Verhältnis der Theoriebezüge zueinander (Eigene Darstellung 2012)
Abbildung 12: Nachbarschaftsgarten Rosa Rose (Quelle: eine-andere-welt-ist pflanzbar.urbanacker.net)
Abbildung 13: Städtische Gärten mit Gemeinsinn. Der Interkulturelle Garten Wilhelmsburg (Quelle: Markus Scholz www.geo.de)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Handlungsempfehlungen Gemeinschaftsgärten für Menschen mit Demenz (Quelle: Eigenen Darstellung 2012)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Salatbeete mitten in Berlin im Tiergarten, auf freien Plätzen oder auf dem Mittelstreifen dürfte die Generation 70 plus noch gut in Erinnerung haben. In der Zeit nach 1945 half diese Form der städtischen Landwirtschaft vielen BerlinerInnen die schwere Hungersnot nach dem Krieg zu lindern.
Heute erlebt die urbane Landwirtschaft eine neue Konjunktur. Gemeinschaftsgärten und begrünte Baumscheiben sprießen vielerorts beinahe schon wie Pilze aus dem Boden. Neben dem Anbau von Pflanzen steht dabei immer mehr das Soziale im Vordergrund, wie beispielsweise in interkulturellen Gärten.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb mit der Frage, ob nicht auch Menschen mit Demenz als Teil der Gemeinschaft von dem derzeitigen Trend profitieren könnten. Zu einer guten Lebensqualität von Menschen mit Demenz gehört m. E. nicht nur, dass man im Zustand der Pflegebedürftigkeit gut versorgt wird, sondern dass man auch mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten eine Funktion und eine den Fähigkeiten entsprechende Aktivität und Teilhabe in der Gesellschaft findet. Um dies erreichen zu können, muss an neuen Strategien im Umgang mit Demenzkranken gearbeitet werden. Eine Strategie könnte möglicherweise Gartenarbeit in Form von Gemeinschaftsgärten sein. Die Arbeit soll deshalb zeigen, welchen Beitrag Gemeinschaftsgärten für ein gutes Leben trotz Demenz leisten können.
In Deutschland wird die Zahl der Demenzerkrankten laut Expertenschätzungen mit rund 1,3 Millionen beziffert. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes wird sich die Zahl der Menschen mit Demenz bis zum Jahr 2050 auf knapp 2,6 Millionen erhöhen. Medizinische Heilungsmöglichkeiten sind nach dem derzeitigen Stand der Forschung in naher Zukunft nicht zu erwarten (BMFSFJ 2010).
Demenzielle Erkrankungen zählen zu den wichtigsten Ursachen für den Verlust der Selbstständigkeit und führen unweigerlich in die Pflegebedürftigkeit. Rund zwei Drittel dieser Demenzkranken werden zu Hause von Angehörigen betreut und gepflegt.
In den letzten Jahren gab es sowohl auf Bundes- als auch auf Länder- und kommunaler Ebene verstärkte Bemühungen, die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zu verbessern. Gleichwohl ist es bisher nur unzureichend gelungen, die gesellschaftliche Isolation, die nicht nur die Betroffenen, sondern auch die pflegenden Angehörigen erfahren, aufzuheben.
Im Folgenden werde ich meine Motivation und den Anlass zum Forschungsthema skizzieren (1.1). Anschließend gehe ich auf die Problem- und Fragestellung ein (1.2) und stelle den Forschungsstand dar (1.3). Am Ende der Einleitung erläutere ich den Aufbau der Arbeit (1.4).
1.1 Motivation und Anlass
Urbanes Gärtnern liegt nicht erst seit kurzem im Trend unserer Zeit. Das zeigen die vielen angelegten Gärten und unzähligen Schrebergartenkolonien in Berlin. Neu ist, dass städtische Brachflächen durch Eigeninitiative einiger StadtbewohnerInnen zunehmend in Gemeinschaftsgärten umgewandelt werden. Mit Interesse verfolgte ich die Entstehung der Prinzessinnengärten am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg.
Die Idee zur Beschäftigung mit Gemeinschaftsgärten im Kontext mit dem Krankheitsbild Demenz entstand durch meine Beobachtung im Pflegebereich, dass die noch vorhandenen Fähigkeiten von Menschen mit Demenz oftmals unzureichend genutzt und gefördert werden. Viele Betroffenen sind im Alltag gerade zu auf der Suche nach Beschäftigung und Gemeinschaft, die Ihnen meiner Ansicht nach nicht in ausreichendem Maß angeboten wird. Im privaten Bereich konnte ich beobachten, dass Gartenarbeit auch Menschen mit Demenz mit tiefer Zufriedenheit erfüllen kann, jedoch für die überwiegende Anzahl von Betroffenen weder im stationären Bereich noch im häuslichen sozialen Umfeld in Berlin Orte zum Gärtnern existieren. Da ich in meinem Erstberuf Krankenschwester bin, war eine Motivation für diese Arbeit auch, medizinisch- pflegerische Aspekte im Umgang mit Demenzkranken mit den beiden Konzepten Lebenswelt- und der Sozialraumorientierung zu verbinden.
1.2 Problem- und Fragestellung
Das Ergebnis der Bevölkerungsprognose der Bertelsmann Stiftung für die Stadt Berlin zeigt, dass die Zahl der über 80-jährigen in Berlin in den nächsten 20 Jahren rapide zunehmen wird (Abb.1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 : Änderung der Altersstruktur in Berlin von 2009 auf 2030 (%)
(Quelle: Bertelsmann Stiftung: Wegweiser-Kommune)
Sofern die Medizin kein Heilmittel gegen Demenz findet, wird auch die Zahl der Personen mit Demenz weiterhin beträchtlich ansteigen. Der vierte Altenbericht der Bundesregierung stellte heraus, dass u.a. in den Bereichen Prävention, ganzheitliche und umfassende Therapie, Pflege und Betreuung sowie der angemessenen Beratung der an Demenz Erkrankten und ihrer pflegenden Angehörigen Defizite in quantitativer sowie qualitativer Hinsicht bestehen (4. Altenbericht 2002, S. 22).
Wenngleich seither zunehmend positive Tendenzen in der Qualitätsentwicklung in der Alten- und Dementenbetreuung erkennbar sind, so erscheint der territoriale Rückzug alter und dementer Menschen in Wohnung oder Altenheim immer noch selbstverständlich hingenommen zu werden (Bönisch 2008, S. 269). Möglichkeiten zur sozialräumlichen Interaktion in Form eines gemeinschaftlich genutzten Gartens für Menschen mit Demenz werden nicht ausgeschöpft. Isoliert von der Gesellschaft leben viele Menschen mit Demenz in Berlin ohne Zugang zur Natur. Entweder, weil sie im unmittelbaren Umfeld schlicht nicht vorhanden ist, oder weil niemand da ist, der mit diesen Menschen naturnahe Orte aufsucht. Pflegeeinrichtungen verfügen in der Regel über einen Garten, doch häufig finden Menschen mit Demenz nicht so recht Bezug zu diesen Gärten, die zu oft, abgesperrt von der Öffentlichkeit, als reine Bewegungs- und Aufenthaltsräume konzipiert sind.
Ausgangspunkt für diese Arbeit ist deshalb die Frage, wie die Betroffenen wieder in die Mitte der Gesellschaft geholt werden können.
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, ob und wie Gemeinschaftsgärten ein Ansatz sein können, das Wohlbefinden, die Lebensqualität sowie die soziale Teilhabe und Akzeptanz von Menschen mit Demenz zu verbessern.
Im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung vor Ort besteht hier insbesondere kommunalpolitischer Handlungsbedarf. Im Blickpunkt dieser Arbeit steht es deshalb, Anregungen zur Verbesserung der Lebenslage von Menschen mit Demenz auf kommunaler Ebene zu geben.
Zudem ist es Ziel der Arbeit, Ansätze aufzuzeigen, die bei einer Implementierung von Gemeinschaftsgärten für Menschen mit Demenz in der kommunalen Altenpolitik genutzt werden können und wo Weiterentwicklungsbedarf besteht.
1.3 Forschungsstand
Im Folgenden wird der Forschungsstand zu Gemeinschaftsgärten und zu Gärten für Menschen mit Demenz im Kontext Sozialer Arbeit und kommunaler Altenpolitik vorgestellt.
Die Erkenntnislage zu demenzbezogenen Themen ist außerordentlich breit gefächert. Umfassende Erkenntnisse zu demenzbezogenen Themen aus dem Blickwinkel der spezifischen Situation von SozialarbeiterInnen sind dagegen bisher kaum vertreten.
In Publikationen für den stationären Pflegebereich wird auf die besonders wichtige Bedeutung von Naturerleben für die Gruppe von Menschen mit Demenz und die positiven Auswirkungen von Gärten für das Wohlbefinden hingewiesen (so z.B. Heeg und Bäuerle 2004). Es finden sich Studien über die heilende Wirkung therapeutischer Gärten für gerontopsychiatrisch erkrankte Personen insbesondere aus Österreich.
Rosol und Madlener beschäftigen sich in ihren Dissertationen mit Gemeinschaftsgärten in Berlin mit den Potentialen und Risiken bürgerschaftlichen Engagement im Grünflächenbereich vor dem Hintergrund des Wandels von Staat und Planung (Rosol 2006, Madlener 2009). Hier lassen sich im Kontext von Bürgerarbeit auch Berührungspunkte mit Sozialer Arbeit finden.
In dem von Christa Müller herausgegebenen Sammelband Urban Gardening bilden politische und soziale Deutungen von Gemeinschaftsgärten in der Stadt wichtige Schwerpunkte (Müller 2011).
In den USA gibt es bereits seit den 70-er Jahren Gemeinschaftsgärten, die von SozialarbeiterInnen geführt werden. Allerdings legen diese den Fokus auf die sozialarbeiterischen Handlungsfelder Kinder- und Jugendarbeit sowie Drogenarbeit.
Eine Literaturrecherche zur Thematik Demenz in Bezug auf die kommunale Entwicklung der Altenpolitik ergab wenige Ansatzpunkte. Gronemeyer und Wißmann konstatieren, dass bei den Verantwortlichen in den Kommunen zwar angekommen ist, die Potentiale des Alterns und insbesondere die „aktiven Alten“ für die kommunale Entwicklung zu nutzen. Diejenigen die mit diesem Altersbild jedoch nicht mithalten können, wie z.B. Menschen mit Demenz, scheinen dabei aus dem Blickfeld geraten zu sein (Gronemeyer/Wißmann 2009, S. 209).
Insgesamt ist festzustellen, dass bislang keine konkreten Erkenntnisse aus Studien über Projekte mit Demenzerkrankten in Gemeinschaftsgärten in Berlin oder anderswo vorliegen. Das Phänomen der Gemeinschaftsgärten im urbanen Raum ist in Deutschland noch recht neu, woraus vermutlich der geringe Forschungsstand resultiert. Die vorliegende Arbeit will durch eine theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke leisten und neue Wege für Gartenprojekte mit Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen eröffnen.
Im Folgenden wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben.
1.4 Aufbau der Arbeit
Nach der Einleitung im ersten Kapitel werden im zweiten Kapitel grundlegende Informationen über das Krankheitssyndrom Demenz dargestellt.
Kapitel drei widmet sich der Lebenswelt von Menschen mit Demenz. Einleitend wird hier der Lebensweltansatz kurz vorgestellt. Daran anschließend findet sich eine Auseinandersetzung mit der Ebene der Betroffenen.
Im vierten Kapitel wird ein Überblick über einige relevante sozialrechtliche Rahmenbedingungen gegeben.
Das fünfte Kapitel wirft einen Blick auf die Frage, welche Ansatzpunkte es für Soziale Arbeit gibt, einen positiven Beitrag für Menschen mit Demenz zu leisten.
Das sechste Kapitel widmet sich dem Thema Gemeinschaftsgärten. Hierbei findet zunächst die allgemeine Bedeutung von Gemeinschaftsgärten für die Gesellschaft Berücksichtigung. Anschließend steht die Bedeutung für Menschen mit Demenz im Fokus der Betrachtung.
Im siebten Kapitel werden im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung von Gemeinschaftsgärten für Menschen mit Demenz die Potentiale für die kommunale Altenpolitik thematisiert.
Die Arbeit schließt im achten Kapitel mit einer Gesamtzusammenfassung, einer Schlussfolgerungen und einem Ausblick.
2 Grundlagen demenzieller Erkrankungen
In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über demenzielle Erkrankungen (2.1), wesentliche Erkrankungsformen (2.2), die Symptomatik (2.3) sowie über den Verlauf (2.4) gegeben.
2.1 Definition von Demenz
Demenzielle Erkrankungen treten in Abhängigkeit vom Alter unterschiedlich häufig auf. Sind es bei den über 65-Jährigen nur etwa 2,5 Prozent, die von einer Demenz betroffen sind, so sind es bei den über 80-Jährigen schon 18 Prozent und bei den 85-Jährigen 36 Prozent (Abb.2). Demenzen gehören damit zu den häufigsten geriatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter.
Das Wort Demenz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „ohne Verstand“. Demenz ist laut Definition nach ICD-10 „ein Syndrom, als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Erkrankung des Gehirns mit Störungen vieler kortikaler Funktionen einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, Sprechen, Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur Entscheidung, wobei das Bewusstsein nicht eingetrübt ist“ (ICD-10- WHO, 2012).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Das Alter - Hauptrisiko für Demenz Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft
2.1.1 Formen von Demenz
Der Begriff Demenz umfasst zahlreiche medizinische Klassifikationen, von denen aufgrund des geringen Umfangs der Arbeit nur auf die häufigsten Formen eingegangen wird. In Bezug auf die Thematik der vorliegenden Arbeit beziehe ich mich auf die Menschen, die an der Alzheimer Demenz oder einer Mischform von Alzheimer-Demenz und Vaskulärer Demenz erkrankt sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Die unterschiedlichen Formen der Demenz (Quelle: Möller HJ, Laux G, Deister A (2009) Psychiatrie und Psychotherapie: Duale Reihe. 4. Auflage. Thieme-Verlag: Stuttgart)
2.1.1.1 Demenz vom Alzheimer Typ
Die Demenz vom Alzheimer Typ ist die häufigste Form von Demenz. Etwa 55-70 Prozent aller Demenzerkrankungen werden der Alzheimer-Erkrankung zugerechnet (Abb.3). Die Alzheimer Demenz ist durch einen schleichenden Krankheitsbeginn charakterisiert, d. h. die kognitiven Leistungseinbußen werden lange verdeckt, indem beispielsweise defizitäre Bereiche gemieden oder Gedächtnisstützen genutzt werden (Schröder 2010,S. 299). Die Erkrankung zeichnet sich dadurch aus, dass aktuelle Ereignisse besonders schnell vergessen werden, während älteres Wissen länger in Erinnerung behalten wird und abgerufen werden kann. Noch lange wird von den Erkrankten eine so genannte „Fassade“ ihrer Persönlichkeit aufrechterhalten. Jedoch werden im Verlauf der Erkrankung alle kognitiven Funktionen gleichmäßig abgebaut. Nur in der Anfangsphase lässt sich der Erkrankungsverlauf medikamentös durch die Gabe von Antidementiva um etwa ein Jahr hinauszögern (Wojnar 2007, S. 177).
2.1.1.2 Vaskuläre Demenz
Von der vaskulären Demenz sind etwa fünfzehn Prozent aller Demenzkranken betroffen. Dieser Form liegt eine Störung der Blutversorgung von wichtigen Nerven zugrunde. Je nachdem in welchem Areal des Gehirns die Durchblutungsstörungen auftreten, unterscheiden sich die Krankheitssymptome. Charakteristisch für die Vaskuläre Demenz im Vergleich zur Alzheimerkrankheit ist ein plötzlicher Beginn der Erkrankung. Durch immer wieder erneut auftretende Durchblutungsstörungen kommt es nach Phasen der Verbesserung der Symptomatik im Verlauf der Erkrankung zu sprunghaften Verschlechterungen der kognitiven Leistungsfähigkeit (Wojnar 2007, S. 177). Zum Teil sind auch Depressionen, starke Stimmungsschwankungen, bei denen die Betroffenen plötzlich und unkontrolliert anfangen zu weinen, für das Krankheitsbild typisch (Schröder 2010, S. 301).
2.1.1.3 Die Frontotemporale Demenz
Das Zustandsbild der Frontotemporalen Demenz ist durch eine starke Veränderung der Persönlichkeit mit Antriebsstörungen, Interessensverlust, Stimmungsschwankungen und Gefühlskälte sowie auffällige Störungen des sozialen Verhaltens geprägt. Als Ursache wird hier ein fortschreitendes Absterben von Hirnzellen im vorderen Hirnbereich zugrundegelegt. Ca. 15 Prozent aller Demenzkranken sind hiervon betroffen (Wojnar 2007, S. 177).
2.1.1.4 Die Levy-Körperchen-Demenz
Diese Form der Demenz, die bei etwa 10-15 Prozent der Menschen mit Demenz vorkommt, ist durch im Tagesverlauf schwankende kognitive Störungen, eine leichte begleitende Parkinson-Symptomatik, optische Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Depressionen charakterisiert (Wojnar 2007, S. 7).
2.1.2 Symptomatik von Demenz
Dementielle Erkrankungen sind zum einen generell gekennzeichnet durch Hirnleistungsstörungen im kognitiven Bereich. Dabei leiden die Betroffenen unter Gedächtnisstörungen, Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, Störungen der Merkfähigkeit, Verlangsamung des Denkens, Orientierungsstörungen, Konzentrationsschwäche, Erkennungsstörungen (Agnosie), Sprachstörungen (Aphasie), Handlungsstörungen (Apraxie), Vergessen von Bewegungsabläufen (Ataxie), Lese- und Rechenstörungen (Alexie, Akalkulie), Verlust des Abstraktionsvermögens bis hin zum Verlust ihrer Identität. Das Bewusstsein und das emotionale Erleben der Betroffenen sind nicht beeinträchtigt (Wojnar, 2007, S.176).
Zum andern sind dementielle Erkrankungen durch Verhaltensstörungen im nichtkognitiven Bereich gekennzeichnet. Als Strategie zur Bewältigung der kognitiven Symptome können Verhaltensauffälligkeiten wie anhaltende Unruhe, Selbst- und Fremdgefährdung wie Schlagen, Weglauftendenz, Schmieren mit Exkrementen oder psychiatrische Symptome wie Depression, wahnhafte Ängste, Halluzinationen oder Distanzlosigkeit auftreten (Wojnar 2007, S. 177).
2.1.3 Stadien der Demenz
In den folgenden Ausführungen werden die unterschiedlichen Ausprägungen der Alzheimer-Demenz kurz dargestellt. Die Alzheimer-Demenz wird in drei Stadien eingeteilt: leichte, mittlere und schwere Demenz. Je nachdem in welchem Stadium sich die oder der Erkrankte befindet, ist die oben dargestellte Symptomatik unterschiedlich ausgeprägt.
Das erreichte Stadium der Demenz lässt sich anhand des Testverfahrens Mini-Mental-Status (MMST), das zur Feststellung kognitiver Defizite eingesetzt wird, erfassen.
Die leichte Demenz zeichnet sich durch Symptome wie Vergesslichkeit, erschwertes Denken, gestörtes räumliches Vorstellungsvermögen, Sprachstörung und ein Antriebsdefizit aus. Im Umgang mit dem betroffenen Menschen, kommt es durch Krankheitsverleugnung, Missverständnissen, Konflikte und einer abnehmenden Fähigkeit zur Selbstversorgung, zu Problemen (Wojnar 2007, S. 177).
Desorientiertheit, hochgradige Vergesslichkeit, Sprachzerfall und Handlungsunfähigkeit treten im mittleren Stadium der Demenz hervor. Das Verhalten ist von Unruhe, Aggressivität, Weglauftendenz, Leben in der Vergangenheit und Hilflosigkeit geprägt (Wojnar 2007, S. 177).
Die schwere Demenz ist gekennzeichnet durch schwersten geistigen Abbau und körperliche Störungen wie Inkontinenz, Schluckstörungen, Gehstörungen. Die Vielzahl der Beeinträchtigungen macht vor allem im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung das Zusammenleben mit anderen Menschen immer schwieriger. An Demenz Erkrankte fühlen sich in Konfliktsituationen mit Nichtdementen nicht verstanden, da sie sich aufgrund ihrer kognitiven Defizite nicht als Konfliktursache betrachten und für eine Konfliktlösungsstrategie nicht erreichbar sind. Als Folge von negativen Reaktionen der Umgebung können Verhaltensstörungen wie beispielsweise Aggression oder Weglauftendenzen entstehen bzw. sich verstärken (Wojnar 2007, S. S. 177).
Demenzkranke mit mittleren bis schweren Ausprägungsgraden sind nur noch sehr begrenzt in der Lage sich ihrer Umwelt anzupassen, das bedeutet, dass sich ihr Umfeld nach ihnen ausrichten muss.
Wojnar weist darauf hin, dass der Verlauf jeder Demenzerkrankung durch Faktoren wie z.B. Begleiterkrankungen, soziale Situation, Persönlichkeitsstruktur, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten, körperliche und geistige Aktivität beeinflusst wird und demnach individuell unterschiedlich abläuft (Wojnar 2007, S. 177).
3 Zur Lebenswelt von Menschen mit Demenz
Nach Ansicht von Klie reicht eine bloße medizinische Betrachtungsweise von Demenz jedoch nicht aus, um Menschen mit Demenz angemessen verstehen und begleiten zu können. Er plädiert dafür, Demenz als Behinderung zu betrachten (Klie 2005, S. 69). Behinderungen zeichnen sich laut ICF der WHO dadurch aus, dass neben gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor allen Dingen Interaktionsstörungen und Einschränkungen zwischen Subjekt und Umwelt (Handycaps) zugrundeliegen, denen mit geeigneten Mitteln entgegengewirkt werden soll (ICF WHO, 2005, S. 13 f.). Hierfür könnte die Lebensweltorientierung ein Ansatzpunkt darstellen. Ausgehend vom theoretischen Ansatz der Lebensweltorientierung konzentriert sich dieses Kapitel auf Lebensverhältnisse von Menschen mit Demenz, in denen Hilfe zur Lebensbewältigung praktiziert wird. Im Folgenden wird zunächst der Lebensweltansatz näher erklärt und in Bezug auf das Arbeitsfeld Altenarbeit bzw. Arbeit mit demenziellerkrankten Menschen konkretisiert.
3.1 Der Lebensweltansatz nach Thiersch und Grunwald
Der Lebensweltansatz, der auch als Alltagsorientierung bezeichnet wird, zeichnet sich laut Grunwald und Thiersch durch eine bestimmte Sichtweise auf die AdressatInnen aus (Grunwald/Thiersch 2011, S. 854). Der Demenzkranke soll sich in seiner Lebenswelt gefördert und wertgeschätzt fühlen. Übergeordnetes Ziel ist es, im kommunalen Gemeinwesen die Rahmenbedingungen den schwierigen Alltagsbedingungen von Menschen mit Demenz anzupassen und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Dabei sollte die Vorstellung der Betroffenen selbst, wie sie ihre Lebenswelt gestalten möchten, Berücksichtigung finden. Das Lebensweltkonzept geht davon aus, dass die Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Leben einen erheblichen Einfluss auf das Leben der AdressatInnen hat. Dabei werden materielle und politische Rahmenbedingen ebenso ins Visier genommen wie persönliche Probleme und Ressourcen, Freiheiten und Einschränkungen, die Gestaltung von Raum, Zeit und sozialen Beziehungen. Ziel ist es, die Potentiale der AdressatInnen in ihrer Lebenswelt zu fördern, Mängel zu bewältigen sowie einen gelingenden Alltag zu ermöglichen und zu erleichtern (Grunwald/Thiersch 2011, S. 854). Im Zentrum steht die Rekonstruktion lebensweltlicher Bewältigungsmuster im Kontext von sozialen und gesellschaftlichen Strukturen (Grunwald/Thiersch 2011, S. 857). Alltägliche Bewältigungsmuster von Menschen mit Demenz unterscheiden sich je nachdem in welchen Lebensräumen sie sich befinden, ob sie z. B. in einem Pflegeheim, in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke oder in der eigenen Wohnung leben.
Eine lebensweltorientierte Soziale Arbeit erscheint auch für die Arbeit mit Demenzkranken angemessen, da sie weniger an der Symptomatik der Erkrankungen anknüpft, sondern anstrebt, sich auf die räumliche, zeitliche und soziale Realität der Betroffenen einzulassen. Alte und demente Menschen werden so mit ihren eigensinnigen Bewältigungsformen, den biografisch herausgebildeten Erfahrungen und Ressourcen angenommen, wodurch normalisierenden, disziplinierenden und pathologisierenden Tendenzen entgegengewirkt werden soll (Kleve/Wirth 2009, S. 177). Da meiner Erfahrung nach Menschen mit Demenz auf kontrollierende und insistierende Arbeitsansätze häufig mit Aggressionen reagieren, erfordert die Arbeit mit und für Menschen mit Demenz Achtung und ein Einlassen auf ihre individuelle Lebenswelt.
Im Hinblick auf eine altenpolitische Erneuerung der Versorgungsstrukturen für Menschen mit Demenz bedeutet eine lebensweltorientierte Herangehensweise, dass bei gegebener Nachfrage mehr alltagsorientierte Hilfeangebote, die in die Lebenswelt der Betroffenen integriert werden, entwickelt werden müssen.
3.1.1 Annäherung an die Lebenswelt von Menschen mit Demenz
Für Wissenschaft und Medien ist das Thema seit einigen Jahren zunehmend von Interesse. Dennoch wird die Erkrankung gesellschaftlich weitestgehend tabuisiert, anstatt offen darüber zu reden und die Versorgung und Begleitung der Betroffenen zu einer allgemein anerkannten kollektiven Aufgabe zu machen (Kruse 2010, S.18). Für die Bearbeitung des Themas der vorliegenden Arbeit ist es unverzichtbar, sich damit zu beschäftigen, wie die Betroffenen mit der Erkrankung leben. Gibt es beispielsweise Aspekte, die trotz vorangeschrittener Erkrankung bleiben und was ändert sich? Wo gibt es Ansatzpunkte um Leben mit Demenz besser zu gestalten?
Gerade im Anfangsstadium der Demenz sind die Betroffenen erschüttert, dass ihnen ein „gelingendes Leben im Alter“ in unserer „Leistungsgesellschaft“ verwehrt bleibt. Sie können ihr Leben immer weniger selbst gestalten und sind deshalb abhängig von der Hilfe anderer, welche die Bedürfnisse der Erkrankten unterschiedlich beachten.
3.1.2 Die Bedürfnisse von Personen mit Demenz
Laut Kidwood verlieren Menschen mit Demenz durch die zum Krankheitsbild gehörenden kognitiven Beeinträchtigungen mehr und mehr ihre Autonomie, weshalb sie zwar nicht zu Kindern werden, aber einem Kind vergleichbare primäre Bindungsbedürfnisse entwickeln (Kitwood 2000, S. 122 f.). Nach dem personenzentrierten Ansatz von Kitwood sind die wichtigsten psychischen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz das zentrale Bedürfnis nach Liebe (im Sinne von bedingungsloser Akzeptanz) sowie die Bedürfnisse nach Trost, Identität, Beschäftigung, Einbeziehung und Bindung (Kitwood 2000, S. 122). Aufgrund der kommunikativen Probleme sind Demenzkranke häufig nicht mehr in der Lage ihre Bedürfnisse verbal auszudrücken. Sie sind darauf angewiesen, dass die Menschen, die sie betreuen, diese grundlegenden Bedürfnisse erkennen und weitestgehend für ihre Erfüllung sorgen.
Das emotionale Erleben ist bei Personen mit Demenz sehr stark ausgeprägt. Sie leiden unter dem Verlust ihres bisherigen Lebens, weshalb sie ein großes Bedürfnis nach Trost in Form von Zuwendung und Körperkontakt haben (Kitwood 2000, S.123).
Das Bedürfnis nach Bindung resultiert daraus, dass sich verwirrte Menschen hochgradig unsicher fühlen. Primäre Bezugspersonen bewirken Kontinuität und Sicherheit. Das verstärkte Bedürfnis nach Bindung bei Personen mit Demenz kann sich in fortgeschrittenen Phasen der Erkrankung beispielsweise durch häufiges Rufen nach der Mutter äußern.
Der Mensch ist in erster Linie ein soziales Wesen und benötigt das Gefühl in eine soziale Gruppe eingebunden zu sein. Menschen mit Demenz wollen nicht alleine gelassen werden und zeigen ihre Bedürftigkeit, indem sie durch lautes Rufen, Anklammern, zielloses Umhergehen oder auch durch aggressive Verhaltensweisen auf sich aufmerksam machen. Wird dieses Bedürfnis ignoriert, wird der Krankheitsverlauf negativ beeinflusst und die Betroffenen isolieren sich von ihrer Außenwelt (Kitwood 2000, S. 124).
Demenzkranke, die sich nicht im Endstadium der Erkrankung befinden, haben auch das Bedürfnis, noch aktiv zu sein und ihre vorhandenen Fähigkeiten erfolgreich einzubringen. Speziell auf den Einzelnen zugeschnittene Beschäftigungsangebote auf freiwilliger Basis, helfen die Selbstachtung zu stärken und die Selbstständigkeit zu fördern.
Das Identitätsgefühl wird bei Personen mit Demenz in besonderer Weise bedroht und in ausgeprägten Fällen sind einige nicht mehr in der Lage sich selbst zu erkennen. Dem Bedürfnis nach Identität wird durch Biografiearbeit, sinnvolle Beschäftigung und insbesondere durch einfühlenden Kontakt, indem der Betroffene als einzigartige Person gesehen wird, Rechnung getragen (Kitwood 2000, S. 125).
3.1.3 Spezifische Verhaltensweisen im Alltag
Das Alltagsverhalten von Menschen mit Demenz ist abhängig von den unterschiedlichen Schweregraden und den Ausprägungen von Demenzerkrankungen sowie von den individuellen biografischen Prägungen der Erkrankten. Unabhängig davon gibt es jedoch typische Verhaltens- und Handlungsweisen, die auf die meisten Betroffen zutreffen. Viele Demenzkranke stellen immer wieder dieselbe Frage oder wiederholen die gleichen Sätze oder Handlungen. Das kann insbesondere für die betreuenden Personen eine Herausforderung bedeuten.
Zu den spezifischen Verhaltensweisen zählen auch realitätsfremde Überzeugungen und Sinnestäuschungen. Aufgrund der eingeschränkten Fähigkeit der Erkrankten, Situationen und Wahrnehmungen richtig zu deuten, werden Erklärungsversuche gesucht, die mit der Wirklichkeit oftmals nicht übereinstimmen. So werden z.B. Angehörige oder Pflegepersonen beschuldigt, Geld gestohlen zu haben. Dies dient den Erkrankten als Erklärung, weil sie ihr Geld nicht mehr finden können. Oder im Verlauf der Erkrankung wird der „alte Mensch“ im Spiegel nicht mehr erkannt, da in der Lebenswelt der Betroffenen nur noch Erinnerungen aus dem Altgedächtnis präsent sind.
So kommt es auch vor, dass sich 95-jährige auf den Weg zur Schule machen wollen und 100-jährige nach ihrer Oma rufen, die ihnen etwas zu essen machen soll. Oftmals können diese Abweichungen zwischen der erlebten Welt der Kranken und der Realitätssicht der Angehörigen zu Konflikten im Betreuungsalltag führen. Mit Fortschreiten der Erkrankung haben viele Erkrankte einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus mit ausgeprägten Unruhephasen, in denen sie scheinbar ziellos umherwandern. Gelegentlich kann es bei Menschen mit Demenz auch zu verbalen oder körperlichen Aggressionen kommen, weil sie aufgrund ihrer erschwerten Lebensbedingungen unter Ängsten leiden, schnell überfordert sind oder sich bedroht fühlen (Zwanzig 2004, S.4 ff.).
3.1.4 Pflegende Angehörige
Den Angehörigen kommt eine besonders wichtige Rolle in der Lebenswelt von Demenzkranken zu. Fast zwei Drittel aller Demenzkranken werden von ihren Angehörigen gepflegt. In einer Studie von 1996 wurden leicht Demente zu 81 Prozent und mittelschwer Demente zu 61 Prozent, schwer Demente jedoch nur noch zu 21,8 Prozent von Familienangehörigen gepflegt (Grond 2004, S. 41). Die Hauptlast tragen Frauen, die über 50 Jahre alt sind. 83 Prozent der Pflegenden sind Frauen, von denen 20,5 Prozent ihre Mutter, etwa 14,2 Prozent ihren Ehemann, 12,3 Prozent ihre Schwiegermutter pflegen. Übernehmen Männer die Pflege, dann pflegen ca. 8 Prozent ihre Ehefrau, 7,5 Prozent ihre Mutter und nur 2,7 Prozent ihren Vater (Grond 2004, S. 41).
Die Übernahme der Pflege eines Familienangehörigen mit Demenz hat tiefgreifende Auswirkungen auf das gesamte Familiensystem und die unterschiedlichen Rollen innerhalb der Familie. Laut Transaktionsanalyse kommt es bei der Pflege von dementen PartnerInnen, Eltern, Schwiegereltern oder Geschwistern zu einer Eltern-Kind-ähnlichen Beziehung. Das fürsorgliche Eltern-Ich und das rationale Erwachsen-Ich der Pflegenden reduzieren den Angehörigen mit Demenz auf die Rolle eines hilflosen Kindes (Grond 2004, S. 42). Der Umgang Pflegender mit dem Familienmitglied kann sehr unterschiedlich sein: von einer liebevoll-aufopfernden Pflege bis hin zu Misshandlungen der dementen Angehörigen. Die Belastung durch die Pflege ist dabei nach Grond mehr von der Qualität der Beziehung als von der Schwere der Demenz abhängig (Grond 2004, S. 44).
Leben die pflegebedürftigen Demenzkranken alleine, brauchen sie insbesondere in den Anfangsstadien der Demenz nicht nur Hilfe bei der Körperpflege, sondern Unterstützung beim Einkaufen, bei der Wäscheversorgung, bei der Nahrungszubereitung, bei der Reinigung ihrer Wohnung, beim Heizen, beim Baden/Duschen oder beim Verlassen der Wohnung. Hierfür nehmen etwa 5,8 Prozent zusätzlich Hilfe von einem ambulanten Pflegedienst in Anspruch (Grond 2004, S. 41). Die Angehörigen übernehmen die Pflege in der Regel über einen langen Zeitraum und gelangen häufig an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit. Die Überlastung von pflegenden Angehörigen, insbesondere, wenn die Pflege und Betreuung „rund um die Uhr“ erforderlich ist, gilt als hauptsächlicher Grund für eine Heimeinweisung der Demenzkranken (Grass-Kapanke et. al. 2008, S. 34). Die häufigste Ursache für die Einweisung in ein Heim ist dabei nicht die Schwere der Demenz, sondern ein unzureichendes soziales Netz (Grond 2004, S. 44). Während heute die Angehörigen die pflegerische und finanzielle Hauptlast tragen, ist es fragwürdig, ob dies aufgrund der zunehmenden Single-Haushalte, sinkender Geburtenrate und familienunfreundlicher Arbeitsplätze in naher Zukunft auch noch so sein wird (Grass-Kapanke et al. 2008, S. 5).
3.1.5 Ambulante Versorgung
Je nach krankheitsbedingter und sozialer Situation können unterschiedliche Versorgungsangebote in Anspruch genommen werden. Die ambulante Versorgung ermöglicht den Demenzkranken so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld zu verbleiben. Die ambulante Versorgungskette gliedert sich in die Bereiche professionelle Hilfen, Selbsthilfe und Ehrenamt.
Erste Anlaufstelle bei „Gedächtnisproblemen“ sind meistens die Hausärzte oder Neurologen, denen eine Schlüsselfunktion bezüglich Diagnose, Behandlung, Beratung und Vermittlung zu anderen Diensten zukommt.
Beratungsangebote für die Betroffenen gibt es von kommunalen, freigemeinnützigen und freien Trägern.
Hervorzuheben sind die in Berlin seit 2009 existierenden Pflegestützpunkte. Pflegestützpunkte, die in gemeinsamer Trägerschaft der Kranken- und Pflegekassen sowie des Landes Berlin stehen, sind wohnortnahe Anlaufstellen für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Sie werden dort nicht nur umfassend zu allen sozialen Themen im Zusammenhang mit der Pflegbedürftigkeit beraten. Kommen für den Einzelnen bestimmte Versorgungs- und Betreuungsangebote in Frage, dann werden diese auch von den Stützpunkten koordiniert und die Betroffenen werden darin unterstützt, die passenden Angebote in Anspruch zu nehmen.
Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe gibt es ehrenamtliche Besuchsdienste. Die Alzheimer Gesellschaft bietet Gesprächsgruppen für Angehörige, HelferInnenkreise und Betreuungsgruppen für Alzheimer-Kranke an (Freter 2003, S. 14). Im frühen Stadium der Erkrankung gibt es vereinzelt PatientInnengruppen, in denen die Betroffenen selbst darüber sprechen können, was sie bewegt.
Um die häusliche Versorgung Demenzkranker aufrechtzuerhalten, gibt es zahlreiche professionelle ambulante Pflegedienste und einige von ihnen haben sich auf die Arbeit mit gerontopsychiatrisch veränderten Menschen spezialisiert. Dennoch herrscht Unzufriedenheit mit der ambulanten pflegerischen Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz.
Nach der Studie DIAS beträgt die übliche Kontaktdauer der MitarbeiterInnen der ambulanten Pflegedienste meist 30-45 Minuten. Diese Zeitspanne wird von vielen Pflegediensten als unzureichend bemängelt (Grass-Kapanke et al. 2008. S.25). Seit einigen Jahren sind in Berlin ambulant betreute Wohngemeinschaften mit pflegebedürftigen demenzkranken Menschen weit verbreitet. Ganz wie in einem privaten Haushalt bestimmen hier die WohngemeinschaftsbewohnerInnen bzw. ihre Angehörigen oder die gesetzlichen BetreuerInnen, wer die Pflege und Betreuung bereitstellt, wie die Pflege, Betreuung und der Tagesablauf strukturiert sein sollen und mit wem die Wohnung geteilt wird. Auch die Ausstattung der Wohnung und das Getränke-und Nahrungsmittelangebot wird individuell bestimmt. Die Demenzkranken sind dabei in ein ganz normales Wohnumfeld integriert. Bedingung für ambulant betreute Wohngemeinschaften sind überdurchschnittlich engagierte BewohnerInnen, Angehörige bzw. gesetzliche BetreuerInnen (Pawletko 2005, S.99). Allerdings ist zu bemängeln, dass bisher für betreute Wohngemeinschaften keine einheitlichen Qualitätskriterien existieren.
3.1.6 Stationäre Versorgung
Wenn Demenzkranke noch von Angehörigen versorgt werden, besteht zu deren Entlastung die Möglichkeit, dass die Betroffenen eine teilstationäre Einrichtung besuchen. Sie werden morgens von einem Fahrdienst in eine gerontopsychiatrische Tagespflege gebracht, wo sie durch gemeinsame Aktivitäten gefördert werden. Nachmittags kommen sie dann wieder in ihre Wohnung zurück. Ist eine Versorgung im Privathaushalt nicht mehr möglich, steht meist eine Unterbringung in einem Pflegeheim an. Hier stehen für dementiell Erkrankte zwei Betreuungsmodelle zur Verfügung: Zum einen die integrative Pflegewohngruppe und zum anderen die segregative Pflegewohngruppe. Bei dem integrativen Prinzip werden mit Hilfe einer aktivierenden Pflege und dem Konzept der Milieugestaltung psychisch Kranke gemeinsam mit psychisch gesunden, jedoch körperlich pflegebedürftigen Menschen betreut. BewohnerInnen mit Demenz werden für mindestens fünf Tage in der Woche durchgehend über acht Stunden gemeinsam betreut (Zwanzig 2004, S. 7 f.)
Ziel des integrativen Wohnmodells ist die Aktivierung und Förderung der gesunden Persönlichkeitsanteile der psychisch kranken Menschen durch das Zusammenleben mit den psychisch gesunden Menschen (Höwler 2007, S. 569).
Die Betreuungsform nach dem segregativen Ansatz bedeutet, dass die Dementen rund-um-die-Uhr in kleinen überschaubaren Gruppen von maximal 12 Personen nach festgelegten Prinzipien zusammen in einem Wohnbereich betreut werden. Bei diesem Wohnmodell stehen die Aktivierung und Erhaltung der gesunden Persönlichkeitsanteile der psychisch kranken Menschen unter Gleichgesinnten im Fokus (Zwanzig 2004, S. 9 f.). Der Kontakt zu geistig gesunden MitbewohnerInnen wird vermieden. Dadurch bleibt die zusätzliche Konfrontation der Demenzkranken mit ihren eigenen Defiziten aus (Höwler 2007, S. 571). Unter Einbeziehung der jeweiligen Ressourcen der BewohnerInnen soll wie in einem normalen Privathaushalt die Mitarbeit der demenzkranken BewohnerInnen bei allen anfallenden Verrichtungen des Alltags wie z. B. Kochen, Tisch decken, Geschirr spülen, etc., dazugehören. Hierbei soll u.a. die innere Unruhe der Betroffenen, die ein Hauptproblem in der Betreuung von Demenzkranken darstellt, gelenkt und abgebaut werden. Die alltäglichen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und die Freizeitaktivitäten stehen im Vordergrund, während den pflegerischen Tätigkeiten nur eine ergänzende Rolle zu kommt (Pawletko 2003, S. 95).
3.1.7 Alternative Wohnmodelle
Als Alternative zum schwächer werdenden familiären Netz gibt es Modelle, bei denen angestrebt wird, dass mehrere Generationen in einem Haus zusammenleben. Die Mieter generationsübergreifender Wohnformen haben dabei jeweils ihre eigene abgeschlossene Wohnung. Zugleich gibt es gemeinschaftlich genutzte Räume, wodurch soziale Isolation vermieden werden soll. Auch wenn das Interesse an dieser Wohnform wächst, so stellen generationsübergreifende Wohnformen bisher noch ein randständiges Phänomen in Berlin dar. Angesichts des zunehmenden Alterns der Bevölkerung wird eine Durchmischung der Lebenswelten als Mittel gegen einen Zustand der Abschottung zwischen den Altersstufen und um nachbarschaftliche Unterstützung zu fördern allerdings unverzichtbar sein.
3.2 Fazit
Die oben aufgeführten Darstellungen verstehen sich als eine Annäherung an die Alltagsrealität von Demenzkranken. Ziel war es, die Lebensbedingungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Der bedeutendste Aspekt in diesem Kapitel ist m. E., dass eine Demenz zwar die kognitive Leistungsfähigkeit einschränkt, die emotionale und sinnliche Ansprechbarkeit und Bedürftigkeit aber voll erhalten bleibt. Neben den vielen Belastungen, welche die Lebenswelt von Menschen mit Demenz beeinträchtigen, ist es deshalb wichtig zu betonen, dass viele Demenzkranke selbst in einer sehr fortgeschrittenen Erkrankungsphase grundsätzlich noch dazu in der Lage sind, Empfindungen wie Freude und Glück zu erleben. Nach Ansicht von Kidwood geht bei Menschen mit Demenz, ausgenommen bei Menschen mit einer Frontallappendemenz, die Persönlichkeit nicht verloren, sondern verstärkt sich teilweise noch (Kidwood 2000, S.55). Um die genannten psychosozialen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz nach ihren Möglichkeiten befriedigen zu können, bedarf es differenzierter Versorgungs- und Betreuungsangebote, die den jeweiligen Bedürfnissen gerecht werden.
Dass Demenz eine „Familienkrankheit“ ist, weil sie auch die Lebenswelten der pflegenden Angehörigen sehr beeinflusst, ist eine wichtige Erkenntnis. Pflegende Angehörige brauchen dringend mehr Entlastungsangebote, um die Folgen von Pflegestress wie z. B. Burnout, soziale Isolation und Misshandlungen zu verhindern. Je nach Schweregrad und Ausprägung der Demenzerkrankung und im Kontext der unterschiedlichen sozialen Situation der Betroffenen und ihren Familien, sind differenzierte Angebote in der ambulanten und stationären Versorgungskette erforderlich. Es gibt immer mehr spezielle stationäre Versorgungsangebote für Menschen mit Demenz. Die Dementen werden so aus ihren Lebenswelten herausgerissen. Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ bewahrt die individuellen Lebensbezüge der Menschen mit Demenz. Auch aus finanziellen Gründen sollte der Grundsatz ambulant vor stationär gelten.
[...]
- Arbeit zitieren
- Astrid Zwanzig (Autor:in), 2012, Gemeinschaftsgärtnern mit Dementen: Potenziale für eine innovative Altenpolitik in Berlin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196724