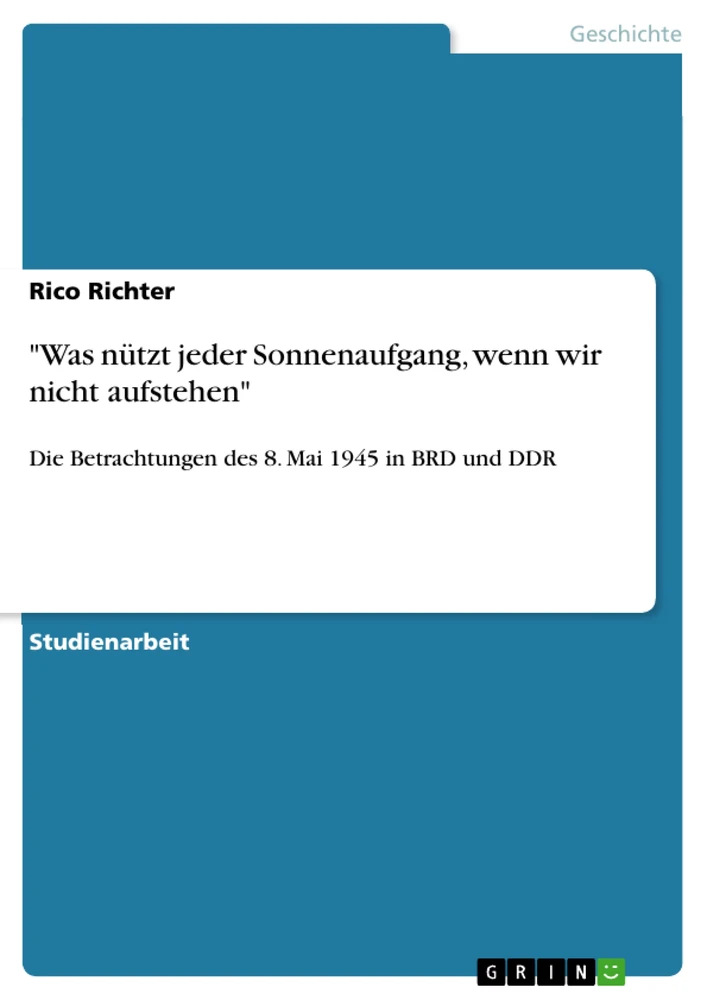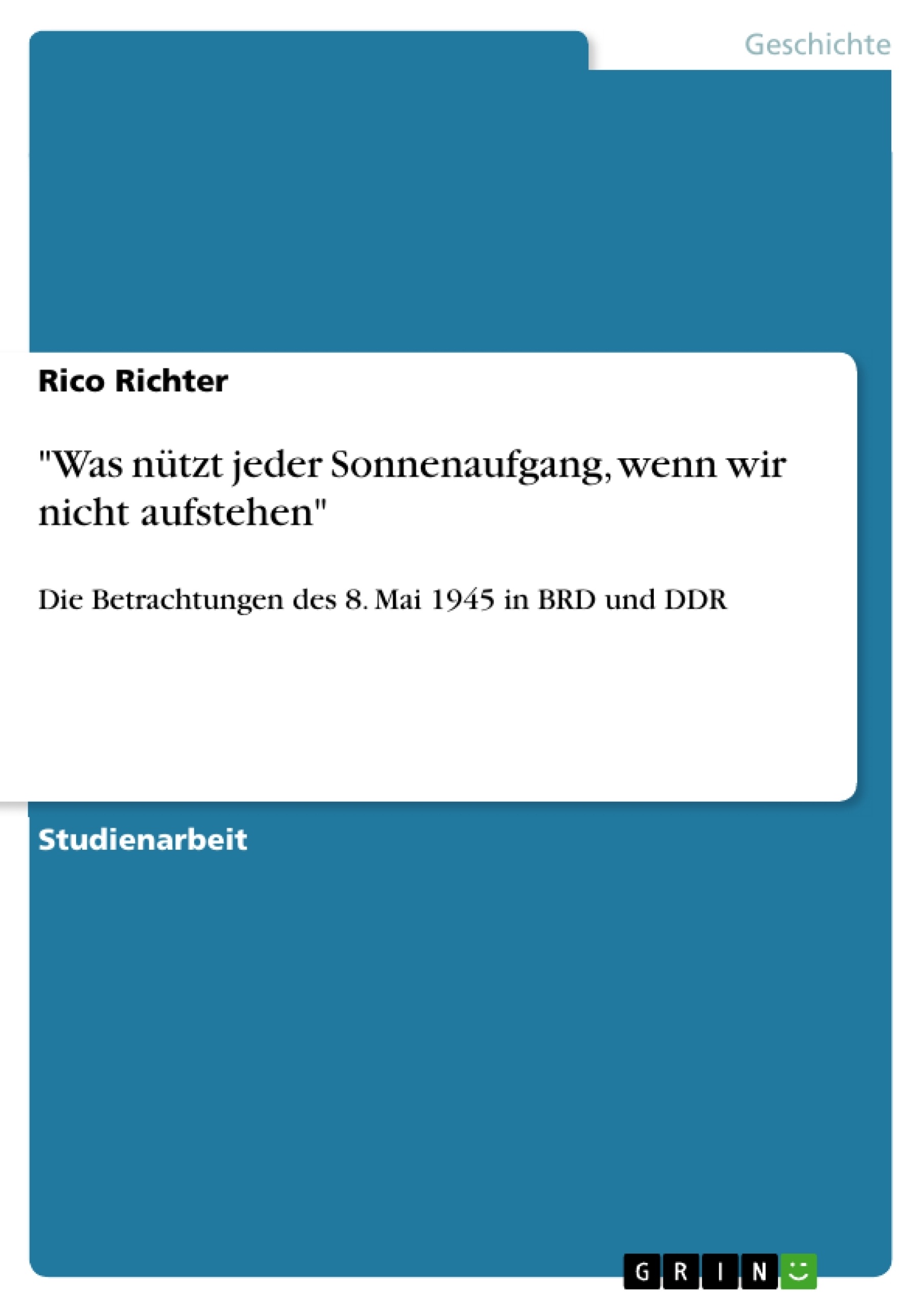Es rankten sich so viele Fragen um den 8. Mai 1945 und dessen Bewältigung innerhalb der Bevölkerung. Und selten wurde ein Thema so erbittert und emotional innerhalb der Wissenschaft geführt.
In einem chinesischen Sprichwort heißt es: „Die eine Generation baut die Straße, auf der die Nächste fährt." So oder so ähnlich verhielt es sich mit den Deutschen und der Bewältigung ihren Krieg – und Nachkriegserfahrungen und dessen Folgen für die nachfolgenden Generationen. Doch welche Grundlagen hatte dieser Bewältigungsprozess und in welche Richtung verlief dieser Prozess? Wie äußerte er sich in der Öffentlichkeit? War jener Prozess in Ost und West gleich? Es ergaben sich sicher noch mehr Fragen, die jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten.
Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Arbeit sollte auf den Geschehnissen um den 8.Mai 1945 und dessen öffentliche Aufbereitung liegen. Es sollte hier keine Bewertung des 8. Mai 1945 vorgenommen werden, dafür lagen die Perspektiven direkter Beteiligter zu weit auseinander.
Zudem traute ich mir als Unbeteiligter, der die Qualen und Verluste nicht miterlebte, kein Urteil zu. Vielmehr jedoch lag es in meinem Interesse, den öffentlichen Umgang zu bewerten.
Dabei sollte der Fokus auf die Jahre 1945-89 gelegt werden, da hier BRD und DDR in ihrer unterschiedlichen Umgang mit dem 8.Mai betrachtet werden sollten und da würde die Zeit nach der Wiedervereinigung aus räumlichen Gründen keinen Sinn machen. Zudem sollte man bei dem zeitlichen Rahmen anmerken, dass nicht die komplette zeitliche Distanz berücksichtigt, sondern vielmehr wichtige Zäsuren als Anhaltspunkte gelten soll.
Die aktuelle Quellenlage ist schon aufgrund des Themas für jeden Forscher und jedem interessierten Laien quasi ein Paradies für Recherchen. Es kommt selten vor, dass ein Forschungsgebiet innerhalb der Geschichte so ausreichend und detailliert mit Protokollen, Dokumenten, Zeitungsartikel und Reden aus jener Zeit, Tonbänder und TV-Ausstrahlungen dokumentiert ist. In dieser Arbeit werden aber hauptsächlich Dokumente und Zeitungsartikel als Beleg dienen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Kurz nach Kriegsende
- 1.1 Befreier oder Sieger? - Aufbaupolitik in der BRD
- 1.2 Rache oder gerechte Strafe? - Der Terror in der Ostzone
- 2. Der 8. Mai '45 in der Öffentlichkeit
- 2.1 Verdrängung, Bewältigung, Transformation - der 8. Mai '45 in der BRD
- 2.2 Wenn man sich nicht erinnern darf - der 8. Mai '45 in der DDR
- 1. Kurz nach Kriegsende
- III. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem 8. Mai 1945 in der BRD und der DDR. Sie untersucht, wie die Ereignisse des Kriegsendes in der Gesellschaft verarbeitet wurden und welche unterschiedlichen Perspektiven in Ost und West dominierten.
- Der öffentliche Umgang mit dem 8. Mai 1945 in der BRD und der DDR
- Die unterschiedlichen Bewältigungsprozesse in Ost und West
- Die Rolle der Politik in der Gestaltung der Erinnerungskultur
- Die Bedeutung der Medien in der öffentlichen Meinungsbildung
- Die Herausforderungen der Vergangenheitsbewältigung in beiden deutschen Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: Wie wurde der 8. Mai 1945 in der BRD und der DDR öffentlich aufgearbeitet? Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas und die Herausforderungen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen des Kriegsendes.
II. Hauptteil
1. Kurz nach Kriegsende
Dieser Abschnitt analysiert die unmittelbare Nachkriegszeit in Ost und West. Die westlichen Alliierten setzten ihre Politik der Denazifizierung, Dekartellisierung, Demilitarisierung und Demokratisierung durch. In der Sowjetischen Besatzungszone hingegen prägte der Terror das Geschehen.
2. Der 8. Mai '45 in der Öffentlichkeit
Dieser Abschnitt untersucht die öffentliche Erinnerung an den 8. Mai 1945 in beiden deutschen Staaten. Die BRD zeigt einen langsamen, aber dennoch erkennbaren Prozess der Bewältigung der Vergangenheit, während die DDR die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Kriegsende verhinderte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind der 8. Mai 1945, die Erinnerungskultur, die Bewältigung der Vergangenheit, die BRD, die DDR, die Medien und die Politik. Die Arbeit beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen des Kriegsendes in Ost und West und analysiert die Rolle der Medien und der Politik in der Gestaltung der Erinnerungskultur.
- Quote paper
- Rico Richter (Author), 2009, "Was nützt jeder Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196725