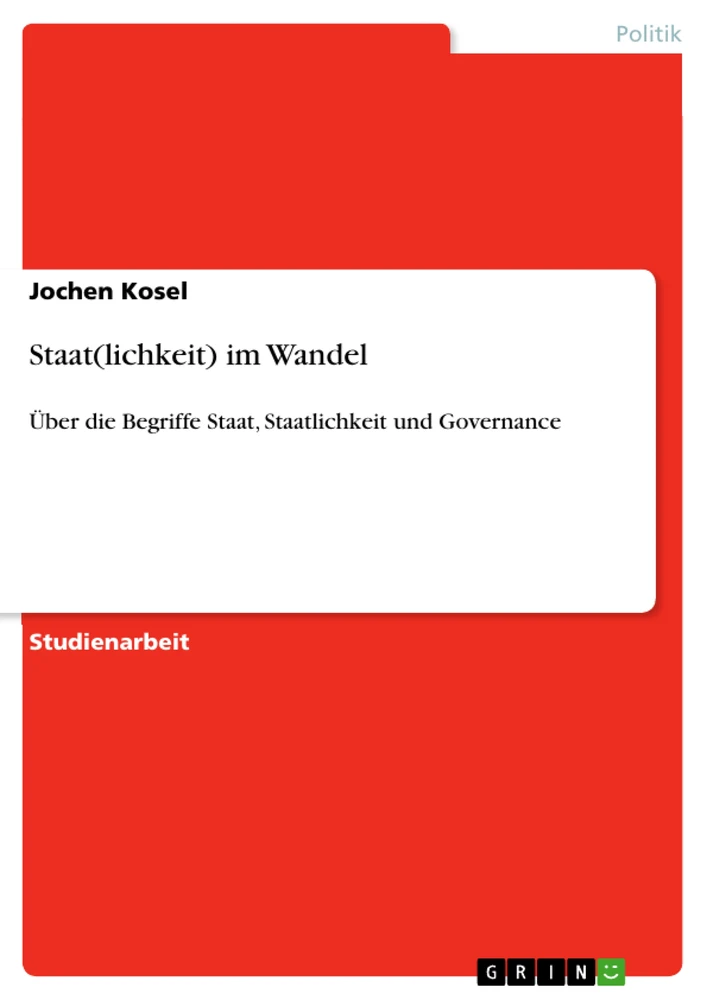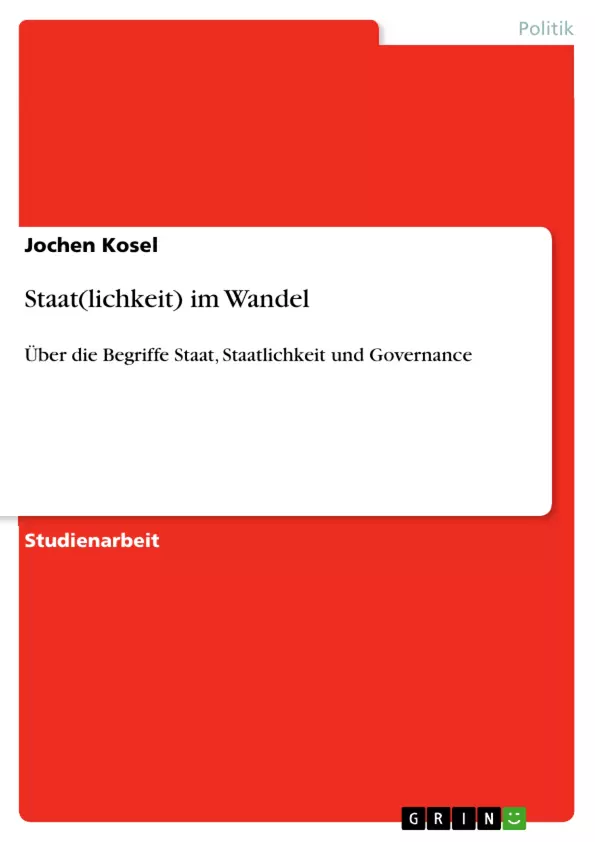Bei den Begriffen „Staat“ und „Staatlichkeit“ handelt es sich um zwei Termini, die vermehrt synonym verwendet werden. „Dies geschieht häufig offenbar eher unreflektiert, jedenfalls ohne dezidierte Erläuterungen zu der Frage, warum der eine oder andere Begriff oder beide nebeneinander Verwendung finden“, befindet Gunnar Folke Schuppert in seiner staatstheoretischen Skizze Staat als Prozess. Allerdings ist dieser synonyme Gebrauch von Staat und Staatlichkeit seiner Meinung nach nicht korrekt, da der Staatlichkeitsbegriff in seiner begrifflichen Bedeutung weit über den des Staates hinausgehe und es somit erlaube, „die mit dem Staatsbegriff notwendig einhergehende Verengung zu überwinden“ . Um dieser Aussage weiter nachzugehen, ist es deshalb notwendig, die beiden Begriffe einer genauen Untersuchung zu unterziehen.
Im Rahmen dieser Arbeit werden daher sowohl der Staats- (Kapitel 2) als auch der Staatlichkeitsbegriff (Kapitel 3) analysiert werden. Ferner wird der Frage nachgegangen, ob und inwiefern Staat und Staatlichkeit miteinander verbunden sind.Einleitend wird die Entstehung des frühneuzeitlichen Territorialstaates anhand zweier zentraler mittelalterlicher Konflikte aufgezeigt und die institutionelle Kompetenz des Staates mit der Drei-Elemente-Lehre Jellineks belegt. Die drei einen Staat definierenden Kriterien werden im Mittelpunkt der Veränderungen im und am Ordnungsmodell Staat (2.2.) stehen.
Im Anschluss daran steht in Kapitel 3 der Staatlichkeitsbegriff im Mittelpunkt, der in einem ersten Schritt vom Staatsbegriff abgegrenzt werden wird. Zunächst soll aufgezeigt werden, wie sich Staatlichkeit vom Staatsbegriff unterscheidet, um erste Anhaltspunkte zur Analyse zu erlangen, bevor man sich der genauen Staatlichkeitsdefinition des Berliner Sonderforschungsbereiches 700 zuwendet und die für diese Definition notwendigen Kriterien dargelegt werden. Mit Hilfe dieser Kriterien werden verschiede-ne Formen von Staatlichkeit aufzeigt werden, denen in Kapitel 3.3 der komplexe Bereich des Wandels von Staatlichkeit folgen wird.
Anhand des externen Wandels von Staatlichkeit (3.3.1.) wird veranschaulicht werden, wie schwierig die Begriffe Staat und Staatlichkeit voneinander zu trennen sind und dass es an bestimmten neuralgischen Punkten zu Überschneidungen kommt. Abschließend wird in Kapitel 4 der Frage nachgegangen, ob der Governancebegriff ein geeigneter Ansatz ist, diese Schwierigkeiten zu überwinden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Staatsbegriff
- Die Entstehung und Beschaffenheit des Staates
- Veränderungen im und am Ordnungsmodell Staat
- Hybridisierung des Staates
- Alternation des Souveränitätsbegriffs
- Der Begriff der Staatlichkeit
- Definition, Kriterien & Formen von Staatlichkeit
- Wandel von Staatlichkeit
- Externer Wandel
- Interner Wandel
- Governance
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Begriffen „Staat“ und „Staatlichkeit“ und untersucht ihre Bedeutung und ihre wechselseitige Beziehung. Die Analyse soll die Unterscheidung der beiden Begriffe verdeutlichen und die Entwicklung von Staat und Staatlichkeit im Wandel der Zeit beleuchten.
- Die Entstehung und Entwicklung des frühneuzeitlichen Territorialstaates
- Die drei Elemente des Staates nach Jellinek und ihre Veränderungen
- Die Definition und Abgrenzung des Staatlichkeitsbegriffs
- Die verschiedenen Formen von Staatlichkeit
- Die Rolle von Governance im Kontext von Staat und Staatlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 analysiert den Staatsbegriff. Dazu werden die Entstehung des Staats im Kontext mittelalterlicher Konflikte und die Beschaffenheit des Staatsmodells erörtert. Anschließend werden Veränderungen im und am Ordnungsmodell Staat beleuchtet, wobei die Hybridisierung des Staats und die Alternation des Souveränitätsbegriffs im Fokus stehen.
Kapitel 3 widmet sich dem Begriff der Staatlichkeit. Es wird zunächst eine Abgrenzung vom Staatsbegriff vorgenommen und die Definition des Berliner Sonderforschungsbereiches 700 vorgestellt. Die verschiedenen Formen von Staatlichkeit werden aufgezeigt, bevor der Wandel von Staatlichkeit untersucht wird. Dieser Wandel wird in die Kategorien des internen und externen Wandels eingeteilt.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Governancebegriff und untersucht seine Bedeutung für das Verständnis von Staat und Staatlichkeit.
Schlüsselwörter
Staat, Staatlichkeit, Governance, Territorialstaat, Jellinek, Hybridisierung, Souveränität, Wandel, Externer Wandel, Interner Wandel.
- Quote paper
- M.A. Jochen Kosel (Author), 2010, Staat(lichkeit) im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196799