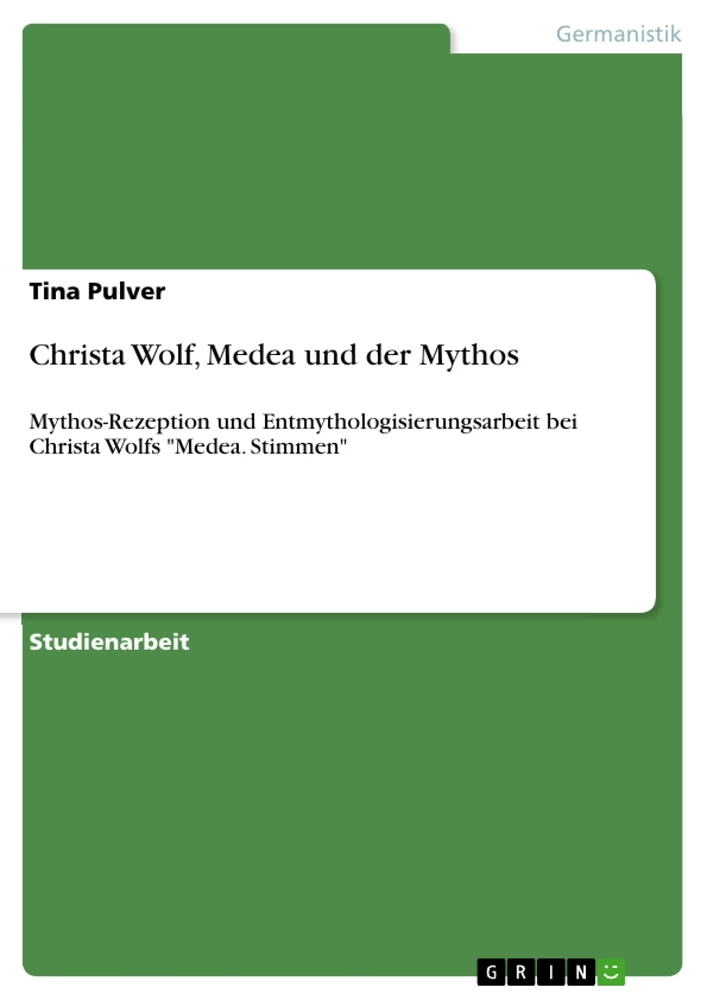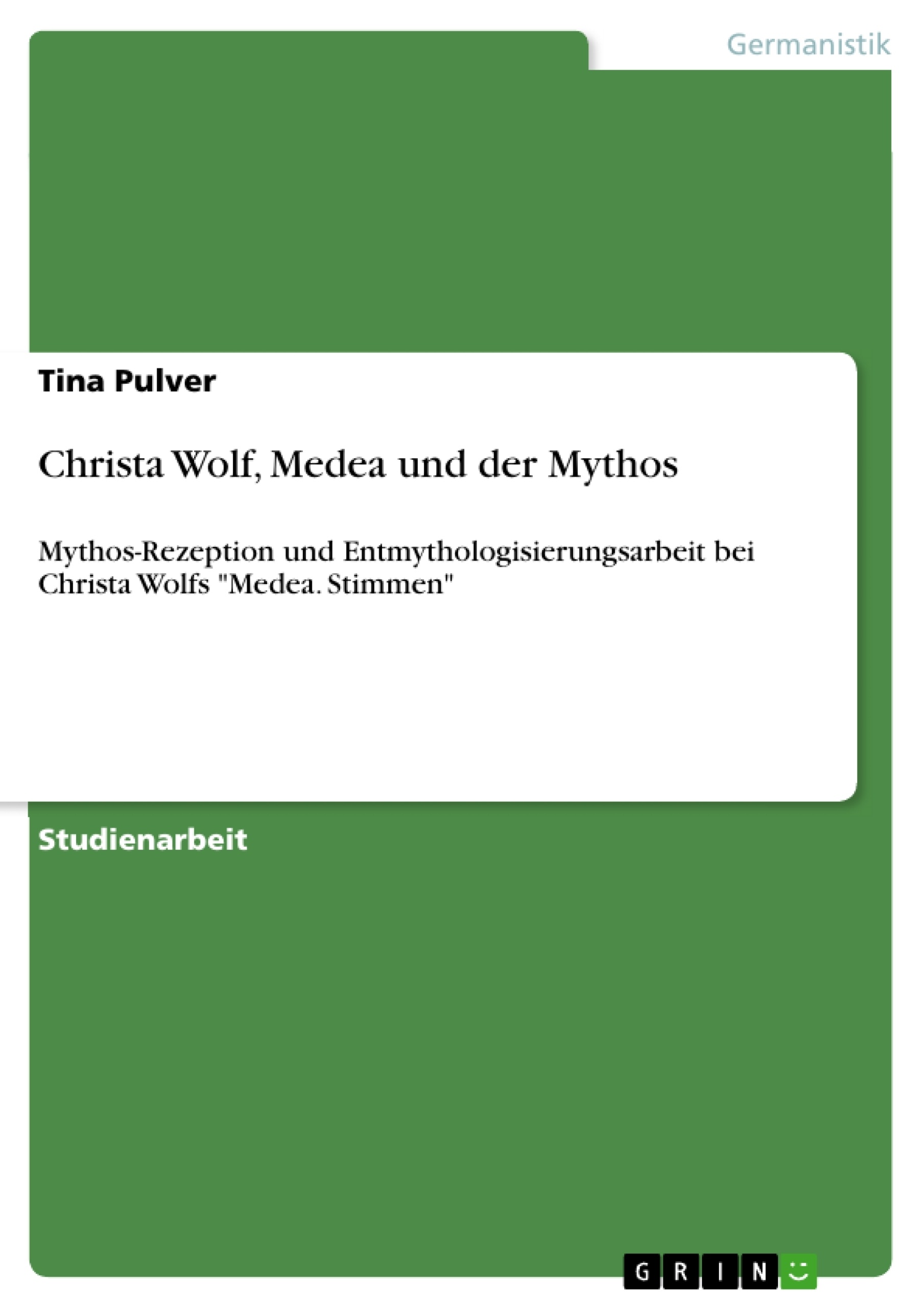Auszug aus der Einleitung: Deshalb wird im ersten Schritt dieser Arbeit die Begrifflichkeit „Mythos“ näher untersucht. Dabei sollen auch seine Funktionen beleuchtet werden. Im Folgenden wird belegt, was „Arbeit am Mythos“ allgemein bedeutet und welche Konsequenzen dies für die Literaturwissenschaft darstellt, um sich dann speziell mit Christa Wolfs am Mythos in "Medea. Stimmen" beschäftigen zu können. Bevor das geschieht, werden die Voraussetzungen für Wolfs Mythos-Rezeption geklärt. Außerdem soll die Entmythologisierungsarbeit Wolfs im Roman umfassend untersucht werden. Darauf folgend soll eine Zusammenfassung von Wolfs Mythos-Rezeption erfolgen. In diesem Teil werden auch einige kritische Stimmen zu Wort kommen. Im Anschluss sollen die Ergebnisse in einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung noch einmal aufgegriffen werden.
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Mythos
2.1 Begriff und Funktionen des Mythos: Zum Problem der Definition
2.2 Arbeit am Mythos
3. Voraussetzungen für Christa Wolfs Mythos-Rezeption
4. Christa Wolfs „Arbeit am Mythos“ in Medea. Stimmen
4.1 Entmythologisierung
4.2 Momente der Entmythologisierung in Medea. Stimmen
4.3 Mythos-Rezeption bei Christa Wolf – Zusammenfassung
5. Schlussbetrachtung
6. Literaturverzeichnis
- Citar trabajo
- Tina Pulver (Autor), 2012, Christa Wolf, Medea und der Mythos, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196854